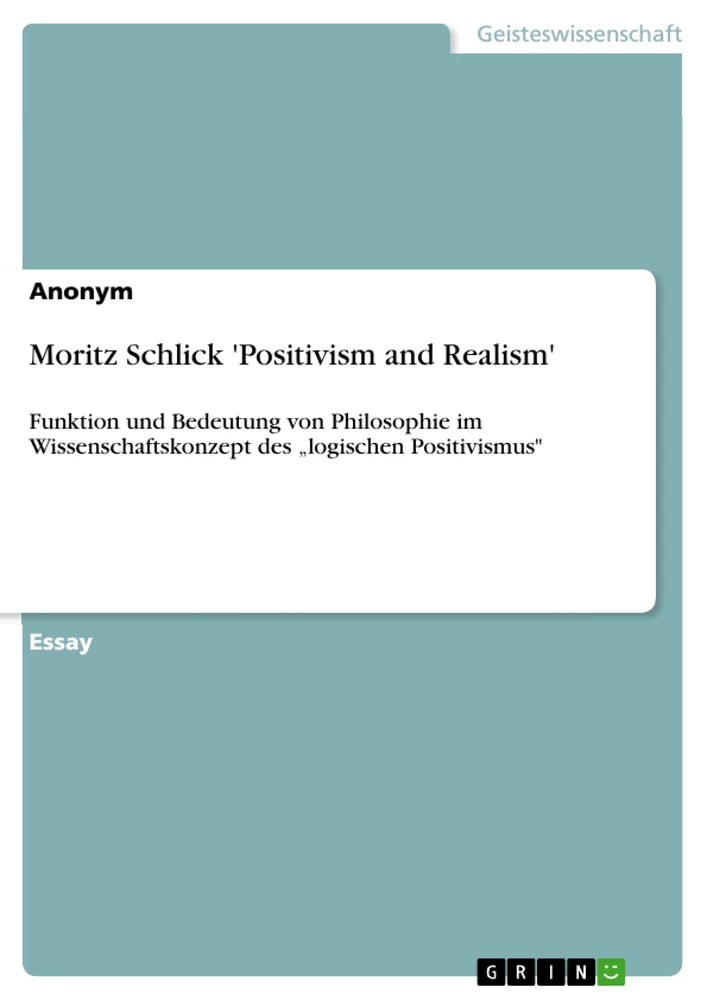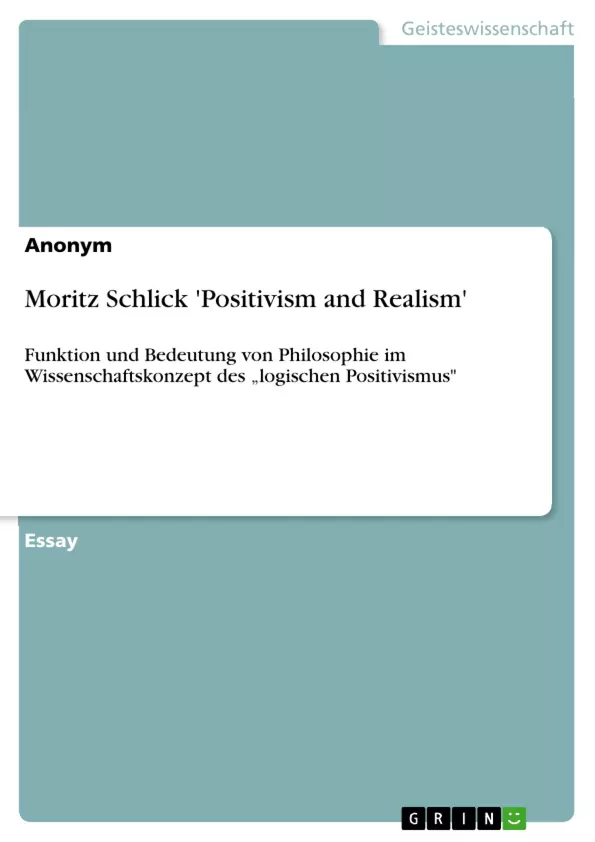Es war die Philosophie, der Aristoteles den höchsten Rang unter den Wissenschaften
einräumte. „Das Seiende, sofern es Seiendes ist, (hat) ihm eigentümlich zukommende
Bestimmungen, und diese nun sind es, über die die Wahrheit zu ermitteln die Aufgabe des
Philosophen bildet.“, schrieb er in seiner „Metaphysik“. Ziel philosophischer Erkenntnis
müsse es also sein, „die Prinzipien und Ursachen der reinen Wesenheit zu erfassen“2. In
Fortführung des aristotelischen Modells galt die Philosophie auch später im abendländischen
Kulturraum lange als „Mutter aller Wissenschaften“. Dies änderte sich erst in dem Maß, in
dem die von Weber konstatierte „Entzauberung der Welt“ durch die Naturwissenschaften
ihren Lauf nahm – Wirklichkeit schien zunehmend wissenschaftlich quantifizierbar, also auf
messbare Phänomene zurückführbar zu sein, deren additiv-logische Verknüpfung die Welt
erschöpfend zu erklären schien – und die Philosophie in eine „Identitätskrise“ stürzte.
Inhaltsverzeichnis
- Funktion und Bedeutung von Philosophie im Wissenschaftskonzept des „logischen Positivismus“
- Das philosophische Dilemma: Ontologische und epistemologische Fragen
- Logisch-positivistische Grundprinzipien und wissenschaftliche Erkenntnis
- Schlicks Auseinandersetzung mit dem philosophischen Realismus
- Ein interdisziplinäres Wissenschaftskonzept
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht Moritz Schlicks Aufsatz „Positivism and Realism“ und analysiert dessen Beitrag zum Verständnis der Funktion und Bedeutung der Philosophie im Kontext des logischen Positivismus. Es wird beleuchtet, wie Schlick die Rolle der Philosophie im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess neu definiert und wie sich dies von der traditionellen aristotelischen Auffassung unterscheidet.
- Die „Identitätskrise“ der Philosophie im Angesicht der Naturwissenschaften
- Schlicks Kritik an traditionellen ontologischen und epistemologischen Fragestellungen
- Die logisch-positivistischen Grundprinzipien der Wissenschaftsbetrachtung
- Die Abgrenzung des Positivismus zum Realismus bei Schlick
- Die Neudefinition der Philosophie als Teildisziplin der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Funktion und Bedeutung von Philosophie im Wissenschaftskonzept des „logischen Positivismus“: Der Text beginnt mit einer historischen Betrachtung der Philosophie als „Mutter aller Wissenschaften“ und ihrer sich verändernden Rolle mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften. Er führt in das Konzept des logischen Positivismus ein und kündigt die Analyse von Schlicks Beitrag zu diesem Konzept an. Die Einleitung etabliert den Kontext und die Problemstellung, die im weiteren Verlauf des Textes behandelt wird – die „Identitätskrise“ der Philosophie und die Notwendigkeit einer Neudefinition ihrer Funktion innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses.
Das philosophische Dilemma: Ontologische und epistemologische Fragen: Dieses Kapitel analysiert Schlicks Diagnose der Hauptursachen des philosophischen Dilemmas. Schlicks Ablehnung der Metaphysik wird hier im Detail untersucht. Es wird betont, dass diese Ablehnung nicht als ontologische Grundaussage, sondern als methodologische Prämisse zu verstehen ist. Die Konzentration traditioneller Philosophie auf ontologische und epistemologische Fragen wird als problematisch dargestellt, da diese Fragen für Schlick bedeutungslos sind und nicht durch empirische Mittel verifiziert werden können. Schlicks Fokus liegt auf der Bedeutung von Sätzen und Fragen.
Logisch-positivistische Grundprinzipien und wissenschaftliche Erkenntnis: Dieses Kapitel erläutert die Grundprinzipien der logisch-positivistischen Wissenschaft nach Schlick. Die empirisch beobachtbare Welt der „Erfahrungen“ bildet den Ausgangspunkt. Die Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Aussagen ist zentral; nur Aussagen, deren Inhalt direkt auf die Empirik verweist und verifiziert werden kann, sind sinnvoll. Die Philosophie übernimmt hier die Rolle der Prüfung der Sinnhaftigkeit und der Deutung von Sätzen, während die Verifikation selbst Aufgabe der Spezialwissenschaften ist. Das Kapitel betont die Bedeutung der logischen Analyse in diesem Kontext.
Schlicks Auseinandersetzung mit dem philosophischen Realismus: Hier wird Schlicks Auseinandersetzung mit dem philosophischen Realismus analysiert. Obwohl Schlick von ähnlichen Grundannahmen wie die Realisten ausgeht (eine grundsätzlich materielle Welt), kritisiert er deren epistemologische Irrwege, insbesondere die Teilung der Welt in „innen“ und „außen“. Die Frage nach der Existenz einer transzendentalen Welt wird als sinnlos erachtet, da sie weder verifiziert noch falsifiziert werden kann.
Ein interdisziplinäres Wissenschaftskonzept: Der Text schließt mit der Darstellung von Schlicks interdisziplinärem Wissenschaftskonzept. Der Forschungsprozess wird in die Generierung von Wissen mittels wissenschaftsspezifischer Methoden und die Bildung, Prüfung und Deutung von Theorien mittels logischer Analyse aufgeteilt. Die Philosophie wird als wissenschaftliche Teildisziplin positioniert, deren Bedeutung in der Diskussion wissenschaftstheoretischer Voraussetzungen und der Interpretation von wissenschaftlichen Sätzen besteht. Die Grenzen und Anwendbarkeit dieses Konzepts, besonders im Hinblick auf heutige Sozial- und Geisteswissenschaften, werden angedeutet.
Schlüsselwörter
Logischer Positivismus, Moritz Schlick, Positivismus und Realismus, wissenschaftliche Erkenntnis, empirische Verifikation, ontologische Fragen, epistemologische Fragen, Metaphysik, Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Aussagen, philosophische Analyse, Wissenschaftskonzept.
Häufig gestellte Fragen zu "Positivismus und Realismus" von Moritz Schlick
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert Moritz Schlicks Aufsatz "Positivism and Realism" und untersucht dessen Beitrag zum logischen Positivismus. Im Fokus steht die Neudefinition der Philosophie im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess durch Schlick und der Vergleich mit der traditionellen aristotelischen Auffassung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die "Identitätskrise" der Philosophie angesichts der Naturwissenschaften, Schlicks Kritik an traditionellen ontologischen und epistemologischen Fragen, die logisch-positivistischen Grundprinzipien der Wissenschaftsbetrachtung, die Abgrenzung des Positivismus zum Realismus bei Schlick und die Neudefinition der Philosophie als Teildisziplin der Wissenschaft.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Funktion und Bedeutung der Philosophie im logischen Positivismus (historischer Kontext, Einführung in den logischen Positivismus und Schlicks Beitrag); 2. Das philosophische Dilemma: Ontologische und epistemologische Fragen (Schlicks Ablehnung der Metaphysik als methodologische Prämisse und Kritik an traditionellen Fragen); 3. Logisch-positivistische Grundprinzipien und wissenschaftliche Erkenntnis (empirische Beobachtung, Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Aussagen und die Rolle der logischen Analyse); 4. Schlicks Auseinandersetzung mit dem philosophischen Realismus (Kritik an epistemologischen Irrwegen des Realismus); 5. Ein interdisziplinäres Wissenschaftskonzept (Aufteilung des Forschungsprozesses und Positionierung der Philosophie als wissenschaftliche Teildisziplin).
Welche Rolle spielt die Philosophie laut Schlick im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess?
Schlick definiert die Philosophie neu als Teildisziplin der Wissenschaft. Ihre Aufgabe besteht in der Prüfung der Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Aussagen und der logischen Analyse und Interpretation wissenschaftlicher Sätze, während die empirische Verifikation den Spezialwissenschaften obliegt.
Wie unterscheidet sich Schlicks Philosophie von traditionellen Auffassungen?
Schlick lehnt traditionelle ontologische und epistemologische Fragen als bedeutungslos ab, da sie nicht empirisch verifizierbar sind. Im Gegensatz zur traditionellen Philosophie, die sich mit metaphysischen Fragen auseinandersetzt, konzentriert sich Schlick auf die Bedeutung von Sätzen und die Analyse der Sprache der Wissenschaft.
Was sind die zentralen Prinzipien des logischen Positivismus nach Schlick?
Zentrale Prinzipien sind die empirische Verifizierbarkeit wissenschaftlicher Aussagen, die Bedeutung der logischen Analyse und die Ablehnung metaphysischer Spekulationen. Nur Aussagen, deren Inhalt direkt auf die Empirik verweist und verifiziert werden kann, sind sinnvoll.
Wie positioniert Schlick den Positivismus gegenüber dem Realismus?
Schlick teilt mit den Realisten die Annahme einer grundsätzlich materiellen Welt. Er kritisiert jedoch deren epistemologische Irrwege, insbesondere die Teilung der Welt in "innen" und "außen", und betrachtet die Frage nach einer transzendentalen Welt als sinnlos.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Logischer Positivismus, Moritz Schlick, Positivismus und Realismus, wissenschaftliche Erkenntnis, empirische Verifikation, ontologische Fragen, epistemologische Fragen, Metaphysik, Sinnhaftigkeit wissenschaftlicher Aussagen, philosophische Analyse, Wissenschaftskonzept.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2004, Moritz Schlick 'Positivism and Realism', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132391