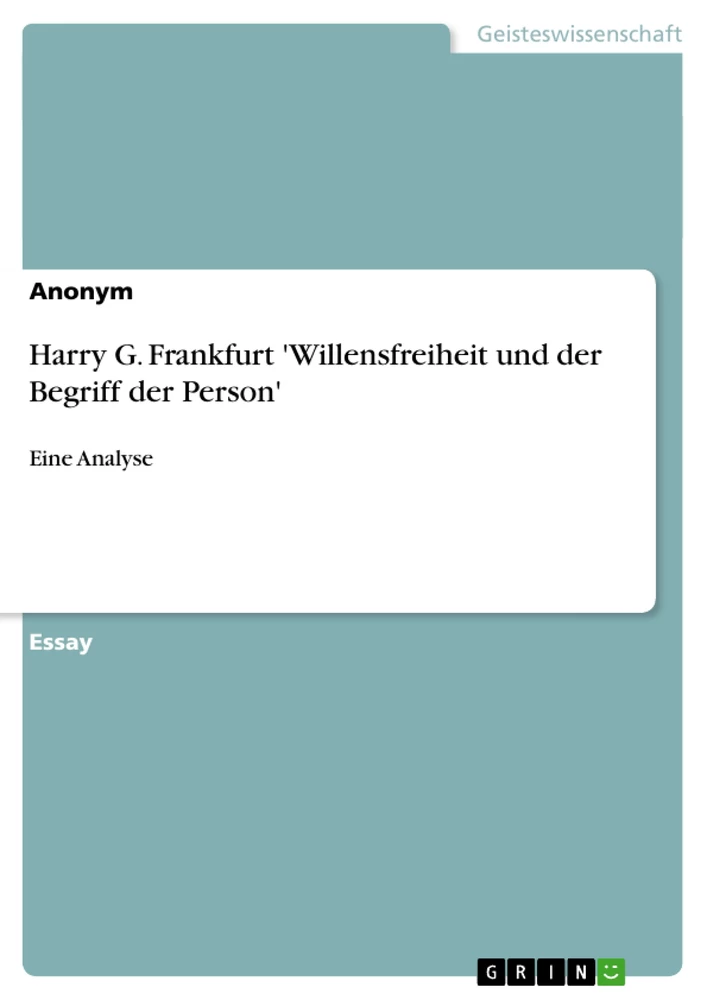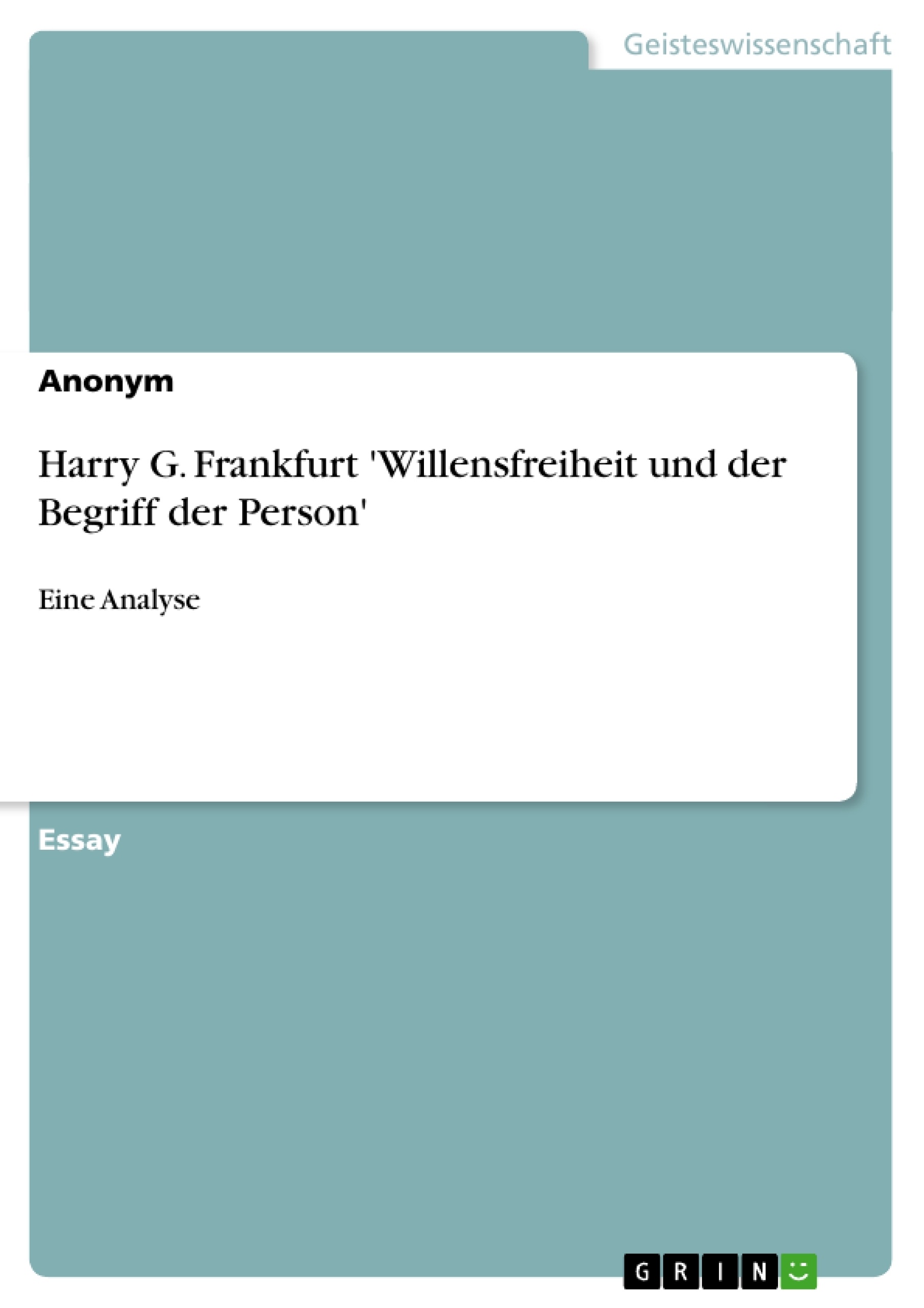Ein Essay zu Harry G. Frankfurts Konzeption von Personalität, die für ihn von der Fähigkeit abhängt, einen Willen auszubilden. Der Begriff der „Person“ ist aus dem Lateinischen entlehnt. „Persona“ hieß dort ursprünglich
„Maske“, wurde dann jedoch auch im Sinn von „Rolle von Schauspielern“ und schließlich –
so etwa bei Cicero – von Rollen von Individuen im gesellschaftlichen Kontext verwendet. Im
Rechtsbereich dagegen war die Bedeutungsdimension eine etwas andere. Eine Person war
dadurch definiert, dass sie im Gegensatz zur Sache – „res“ – über sich selbst verfügen und das
eigene Handeln bestimmen konnte. Auf dieser Ebene setzt auch die Definition von Harry G.
Frankfurt an. Der Autor wendet sich in seinem Aufsatz zunächst vor allem gegen das psychophysische
Konzept, das er bei Philosophen wie Ayer und Strawson diagnostiziert. Diese Definition
stelle, so Frankfurt, einen „Sprachmissbrauch“ dar. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Willensfreiheit und der Begriff der Person
- Der Begriff der „Person“
- Wunsch und Wille
- Wünsche erster und zweiter Stufe
- Volition und Willensfreiheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay von Harry G. Frankfurt zielt darauf ab, den Begriff der „Person“ neu zu definieren und von der bisherigen, unzureichenden psycho-physischen Betrachtungsweise abzugrenzen. Er untersucht die Willensstruktur des Menschen als konstitutives Element der Personalität.
- Differenzierung zwischen Wunsch und Wille
- Konzept der Wünsche erster und zweiter Stufe
- Die Rolle der Volition für die Ausbildung von Personalität
- Der Begriff der Willensfreiheit im Kontext der Personalität
- Unterscheidung zwischen Menschsein und Personsein
Zusammenfassung der Kapitel
Willensfreiheit und der Begriff der Person: Frankfurt kritisiert bestehende Definitionen der „Person“ als unzureichend und prägt einen neuen Ansatz. Er unterscheidet zwischen „Wünschen erster Stufe“ (konkrete Handlungsziele) und „Wünschen zweiter Stufe“ (Wünsche über die eigenen Wünsche). Die Fähigkeit, Wünsche zweiter Stufe zu bilden und diese handlungswirksam zu priorisieren – die „Volition“ – ist für Frankfurt konstitutiv für die Personalität. Ein Mensch kann eine Person sein, auch wenn er seine Wünsche nicht immer in die Tat umsetzt, solange er die Fähigkeit zur Volition besitzt. Der Essay beleuchtet die Differenz zwischen Menschsein (rationales Handeln) und Personsein (volitionäres Handeln) und postuliert Willensfreiheit als ein dem Menschen immanentes, ideales Ziel. Frankfurts Modell ist nicht moralisch wertend, sondern kulturianthropologisch angelegt, indem er die Ausbildung solcher Willensstrukturen als naturgegeben für den Menschen darstellt und die damit verbundene Zufriedenheit als Ziel menschlicher Existenz erachtet.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Person, Wunsch, Wille, Wünsche erster Stufe, Wünsche zweiter Stufe, Volition, Selbstreflexion, Handlung, Personalität, Mensch, Menschsein, Personsein.
Häufig gestellte Fragen zu Frankfurts Essay "Willensfreiheit und der Begriff der Person"
Was ist das zentrale Thema von Frankfurts Essay?
Frankfurts Essay befasst sich mit der Neudefinition des Begriffs „Person“ und grenzt ihn von bisherigen, unzureichenden psycho-physischen Betrachtungsweisen ab. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der menschlichen Willensstruktur als konstitutives Element der Personalität.
Welche zentralen Konzepte werden in dem Essay entwickelt?
Der Essay entwickelt die Konzepte der „Wünsche erster Stufe“ (konkrete Handlungsziele) und der „Wünsche zweiter Stufe“ (Wünsche über die eigenen Wünsche). Die Fähigkeit, Wünsche zweiter Stufe zu bilden und handlungswirksam zu priorisieren – die „Volition“ – wird als konstitutiv für die Personalität angesehen. Der Essay unterscheidet außerdem zwischen „Menschsein“ (rationales Handeln) und „Personsein“ (volitionäres Handeln).
Wie definiert Frankfurt den Begriff der „Person“?
Frankfurt kritisiert bestehende Definitionen der „Person“ als unzureichend. Seine Definition basiert auf der Fähigkeit zur Volition, also der Fähigkeit, Wünsche zweiter Stufe zu haben und diese handlungswirksam zu machen. Ein Mensch kann somit eine Person sein, selbst wenn er seine Wünsche nicht immer in die Tat umsetzt, solange er die Fähigkeit zur Volition besitzt.
Welche Rolle spielt die Willensfreiheit in Frankfurts Argumentation?
Willensfreiheit wird als ein dem Menschen immanentes, ideales Ziel postuliert. Frankfurts Modell ist nicht moralisch wertend, sondern kulturianthropologisch angelegt; er sieht die Ausbildung von Willensstrukturen als naturgegeben für den Menschen und die damit verbundene Zufriedenheit als Ziel menschlicher Existenz.
Wie unterscheidet Frankfurt zwischen Menschsein und Personsein?
Menschsein wird mit rationalem Handeln gleichgesetzt, während Personsein durch volitionäres Handeln definiert wird. Die Fähigkeit zur Volition, also die Fähigkeit, über die eigenen Wünsche zu reflektieren und diese zu kontrollieren, ist der entscheidende Unterschied zwischen Menschsein und Personsein.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Essays relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Willensfreiheit, Person, Wunsch, Wille, Wünsche erster Stufe, Wünsche zweiter Stufe, Volition, Selbstreflexion, Handlung, Personalität, Mensch, Menschsein, Personsein.
Welche Kritikpunkte an bestehenden Definitionen der Person werden im Essay genannt?
Der Essay kritisiert bestehende Definitionen der Person als unzureichend, da sie die komplexe Willensstruktur des Menschen nicht angemessen berücksichtigen. Frankfurt argumentiert, dass diese Definitionen zu oberflächlich sind und das Wesen der Personalität nicht erfassen.
Welche Schlussfolgerung zieht Frankfurt in seinem Essay?
Frankfurt schlussfolgert, dass die Fähigkeit zur Volition, die Fähigkeit, Wünsche zweiter Stufe zu bilden und diese handlungswirksam zu machen, konstitutiv für die Personalität ist. Diese Fähigkeit ist ein zentrales Element des Menschseins, das zu Zufriedenheit und dem Erreichen eines idealen Ziels (Willensfreiheit) führt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2004, Harry G. Frankfurt 'Willensfreiheit und der Begriff der Person', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132389