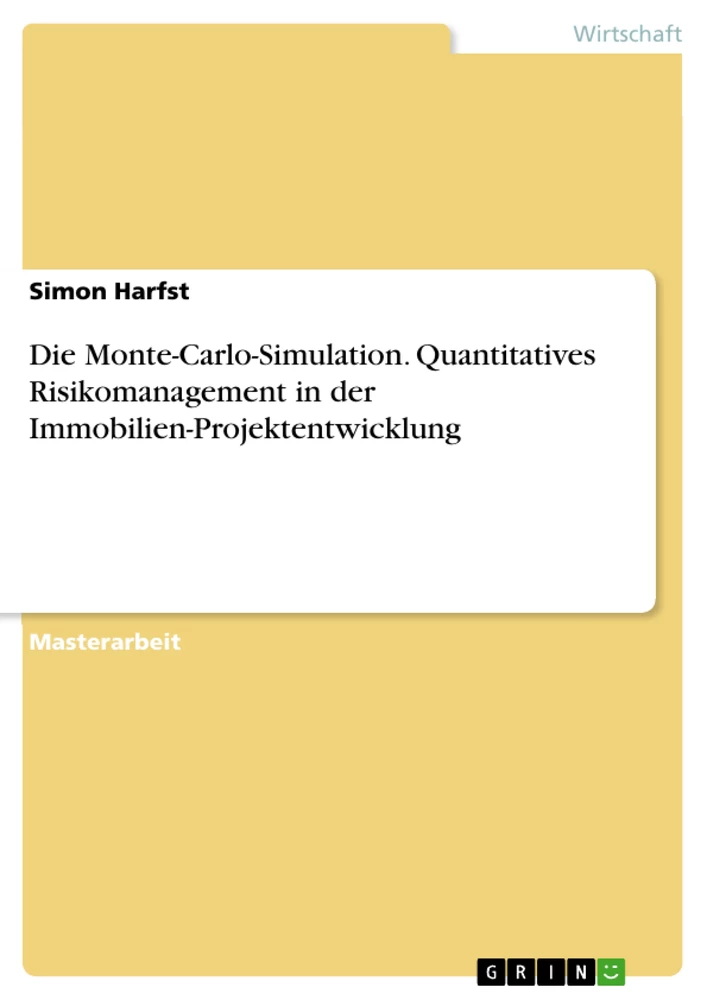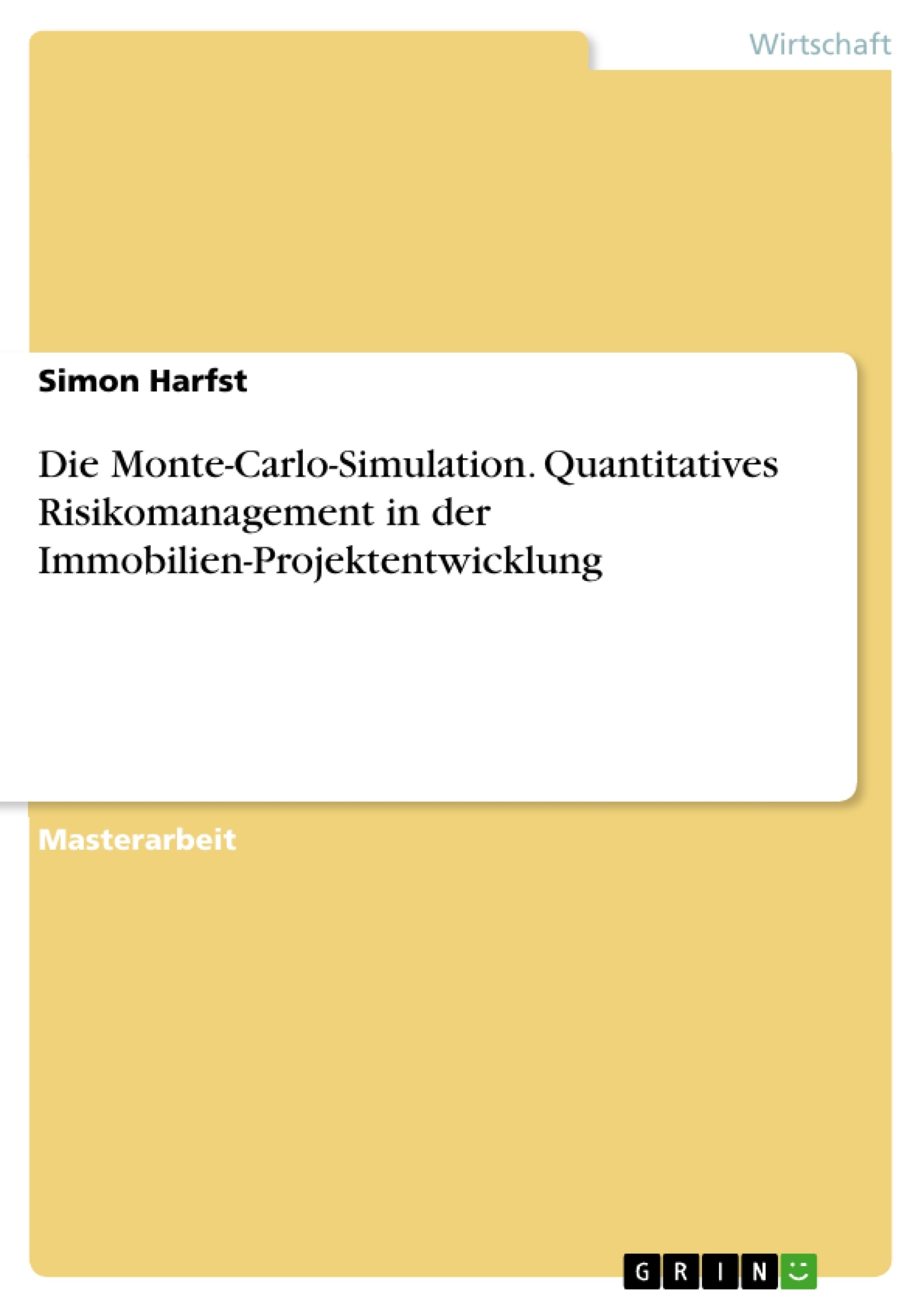Die essenzielle Frage in der Immobilien-Projektentwicklung ist jene, ob sich angesichts der systemisch bedingten Risiken eine Investition lohnt oder nicht. Darüber hinaus gilt es, zu bestimmen, auf welcher Grundlage eine Entscheidung getroffen werden kann, wenn insbesondere am Anfang des Projektes die meisten Parameter unklar und ungewiss sind. Dementsprechend gilt es, die wirklichen Risiken zu bestimmen, zu bewerten sowie im Rahmen des Risikomanagements zu steuern.
Die Monte-Carlo-Simulation ist in der Projektentwicklung bezüglich der Erfassung der Risiken ein immer wiederkehrender Begriff, ohne jedoch als Verfahren im breiten Praxiseinsatz etabliert zu sein. Ein Grund hierfür liegt durchaus in der hohen Komplexität der mathematisch-methodischen Grundlagen und deren Anwendung, was im Gegensatz zu der sehr praxisorientierten Branche steht.
Zu Anfang dieser Arbeit wird daher die These aufgestellt, dass die sogenannte Monte-Carlo-Methode ein adäquates, zielgerichtetes Verfahren zur Erfassung und Bewertung von Risiken im Rahmen der Projektentwicklung ist. Ausgehend von dieser These wird im Weiteren die Monte-Carlo-Methode näher beleuchtet, auf die Immobilienprojektentwicklung transferiert und anhand eines Referenzprojektes untersucht. Hierbei gilt es anfangs die Fragen zu beantworten, wie sich Risiko definiert, wie Risiken entstehen und welche Ausprägungen diese in der Projektentwicklung haben können. Ergänzend soll beleuchtet werden, wie das Risikomanagement in der Projektentwicklung erfolgen kann.
Davon ausgehend ist, bezogen auf die Monte-Carlo-Methode, zu erörtern, worauf diese basiert und wie sich diese definiert sowie wie diese in Grundzügen funktioniert. Im Detail soll dann erläutert werden, welche Bestandteile eine Monte-Carlo-Simulation hat und wie man erkannte Risiken der Projektentwicklung in deren Systematik überträgt. Ferner soll ein Vergleich zu anderen Prognoseverfahren gezogen und aufgezeigt werden, wie man die Ergebnisse einer Simulation interpretieren und kommunizieren kann. Anhand eines Beispielprojektes wird die oben aufgestellte These beantwortet, indem die Möglichkeiten und Vorteile verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Fragestellungen
- Struktur der Arbeit
- Risiken in der Projektentwicklung
- Übergeordnete Begriffsbestimmung
- Untergliedernde Begriffsbestimmung
- Herkunft von Risiken
- Thematische Kategorisierung
- Beispiele für Risiken
- Prognostizierende Fortschreibung
- Prozessualer Fortschritt
- Risikomanagement
- Zusammenfassung
- Einführung in die Monte-Carlo-Simulation
- Begriffsbestimmung
- Historische Entwicklung
- Methodische und mathematische Hintergründe
- Anwendungen in der Projektentwicklung
- Schematischer Ablauf
- Gegenüberstellung Prognoseverfahren
- Einbindung Risikomanagement
- Elemente einer Monte-Carlo-Simulation
- Modelle
- Typisierung
- Herleitung
- Übersetzung der Eingabevariablen
- Besonderheiten bei Eingabewerten
- Simulation
- Sampling
- Pseudo-Zufallszahlen
- Iterationen und Konvergenz
- Ausgabewerte
- Typen von Ausgabewerten
- Lageparameter
- Grafische Darstellung
- Detaillierungsgrade
- Beispielprojekt als Case-Study
- Referenz aus der Literatur
- Design
- Definition Modelle
- Definition der Sub-Units
- Durchführung
- Cost-Analysis
- Schedule-Analysis
- Cost-Schedule-Analysis
- Ergebnisse
- Ergebnisse Cost-Analysis
- Ergebnis Schedule-Analysis
- Ergebnis Cost-Schedule-Analysis
- Diskussion
- Ausblick für weitergehende Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Monte-Carlo-Simulation als Methode des quantitativen Risikomanagements in der Immobilien-Projektentwicklung. Ziel ist es, die Funktionsweise und Anwendung der Monte-Carlo-Simulation in diesem Kontext zu erläutern und ihre Bedeutung für die Entscheidungsfindung im Projektmanagement zu verdeutlichen.
- Einführung in die Monte-Carlo-Simulation und ihre Funktionsweise
- Analyse von Risiken in der Immobilien-Projektentwicklung
- Anwendung der Monte-Carlo-Simulation im Risikomanagement von Immobilienprojekten
- Bewertung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Monte-Carlo-Simulation
- Diskussion von Herausforderungen und Potenzialen der Monte-Carlo-Simulation in der Immobilienbranche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die Zielsetzung und die Struktur der Arbeit darlegt. Anschließend wird das Thema Risiken in der Projektentwicklung umfassend behandelt, wobei verschiedene Begriffsbestimmungen, Herkunftsfaktoren, Kategorien und Beispiele vorgestellt werden. Die Arbeit geht dann auf die Monte-Carlo-Simulation als Methode des quantitativen Risikomanagements ein und erläutert ihre historische Entwicklung, methodischen Hintergründe und Anwendungen in der Immobilien-Projektentwicklung. Im Detail werden die Elemente einer Monte-Carlo-Simulation, wie Modelle, Eingabewerte, Simulation und Ausgabewerte, sowie verschiedene Detaillierungsgrade analysiert. Ein Beispielprojekt dient als Case-Study, um die praktische Anwendung der Monte-Carlo-Simulation in der Immobilien-Projektentwicklung zu demonstrieren. Die Arbeit endet mit einer Diskussion der Ergebnisse und einem Ausblick auf weitergehende Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Immobilien-Projektentwicklung, Monte-Carlo-Simulation, Quantitative Analyse, Entscheidungsunterstützung, Kosten, Zeitplan, Cashflow, Sensitivitätsanalyse, Szenarioanalyse, Risikobereitschaft, Risikotoleranz, Risikobewertung, Risikocontrolling.
- Quote paper
- Simon Harfst (Author), 2019, Die Monte-Carlo-Simulation. Quantitatives Risikomanagement in der Immobilien-Projektentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1323680