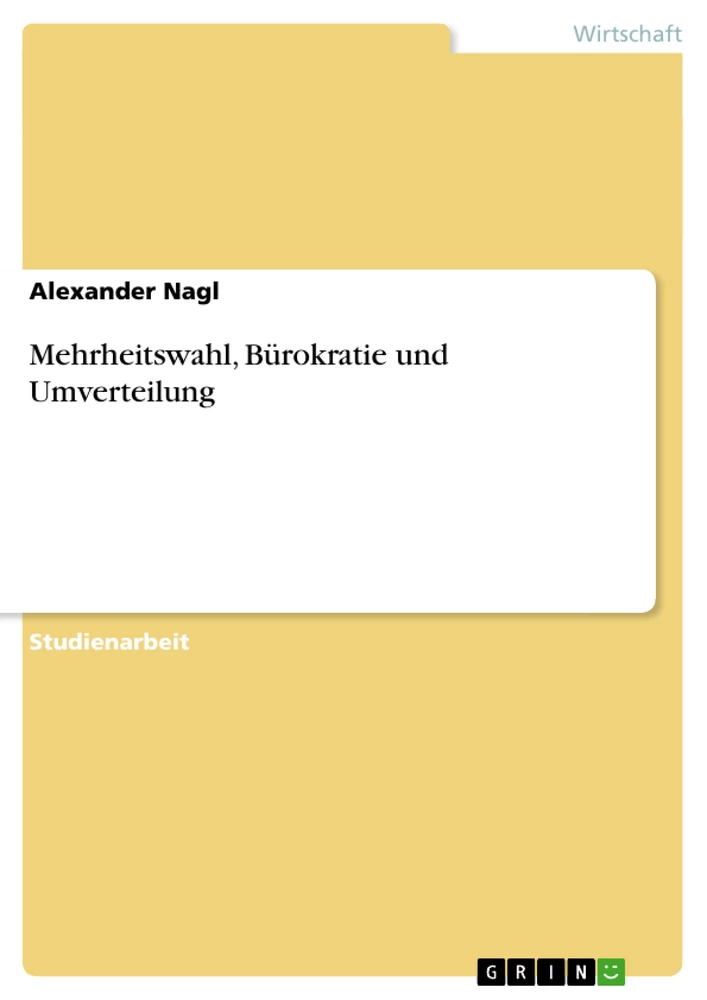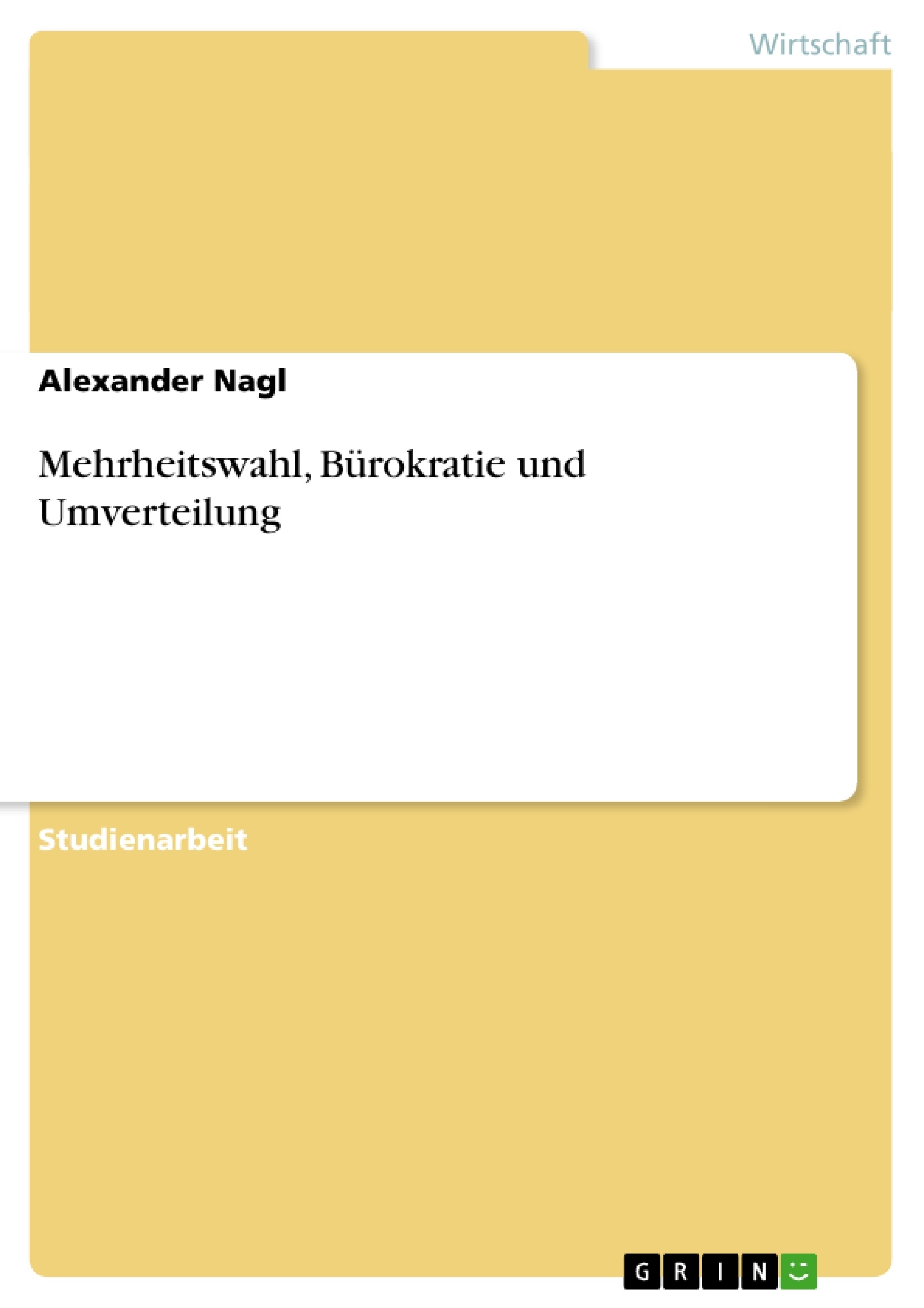In den Vereinigten Staaten von Amerika spielen direktdemokratische Elemente in dem Prozess der politischen Ressourcenallokation eine wichtige Rolle. So werden auf
bundesstaatlicher sowie auf lokaler Ebene regelmäßig Referenden durchgeführt, die über die Höhe bestimmter öffentlicher Ausgaben entscheiden. Thomas Romer und Howard Rosenthal entwickeln in ihrem Aufsatz „Bureaucrats versus Voters: On the Political Economy of Resource Allocation by Direct Democracy” ein Modell für die Höhe öffentlicher Budgets bei direkter Demokratie. Kernaussage des Papiers ist, dass die Ausgaben grundsätzlich höher sind, als es der „traditionelle“ Medianwähler-Ansatz
voraussagt.
Meine Arbeit hat das Ziel, die Annahmen und Grundzüge des Modells von Romer und Rosenthal darzustellen, um so diese zentrale These zu begründen. Ich beginne mit einem groben Überblick über den Medianwähler-Ansatz (zweites Kapitel) und führe anschließend das Monopolmodell von Romer und Rosenthal ein (drittes Kapitel). Kapitel vier und fünf beschäftigen sich mit der Höhe öffentlicher
Ausgaben bei Sicherheit beziehungsweise bei Unsicherheit über die Wahlbeteiligung. Im sechsten Kapitel soll geklärt werden, ob die Ergebnisse des Monopolmodells empirisch bestätigt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Medianwähler-Ansatz
- 3. Einführung des Monopolmodells
- 3.1 Allgemeine Annahmen
- 3.2 Individuelle Präferenzen
- 3.3 Bedeutung des Rückfallpunktes
- 4. Ausgabenniveau bei Sicherheit
- 5. Ausgabenniveau bei Unsicherheit
- 5.1 Einführung von Wahrscheinlichkeiten
- 5.2 Budgetmaximierung des Agenda-Setters
- 5.3 Wahlwiederholungen
- 6. Empirische Analyse
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Modell von Romer und Rosenthal zur Bestimmung öffentlicher Ausgaben bei direkter Demokratie. Ziel ist es, die Annahmen und Grundzüge des Modells darzustellen und die These zu begründen, dass die Ausgaben höher sind als vom traditionellen Medianwähler-Ansatz vorhergesagt.
- Der Medianwähler-Ansatz und seine Grenzen
- Das Monopolmodell der Bürokratie als Agenda-Setter
- Einfluss von Sicherheit und Unsicherheit auf die Ausgabenhöhe
- Analyse der individuellen Präferenzen und deren Auswirkungen
- Empirische Überprüfung des Modells
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit analysiert das Modell von Romer und Rosenthal, welches die Höhe öffentlicher Budgets bei direkter Demokratie untersucht. Im Fokus steht die These, dass die Ausgaben über dem Niveau liegen, das der Medianwähler-Ansatz prognostiziert. Die Arbeit gliedert sich in eine Darstellung des Medianwähler-Ansatzes, die Einführung des Monopolmodells von Romer und Rosenthal, die Betrachtung des Ausgabenniveaus unter Sicherheits- und Unsicherheitsbedingungen sowie eine empirische Analyse und ein Fazit.
2. Medianwähler-Ansatz: Dieses Kapitel erläutert das Medianwähler-Theorem, welches besagt, dass bei eindimensionalen Entscheidungsproblemen und eingipfligen Präferenzen die Idealposition des Medianwählers bei Mehrheitsentscheidungen nicht verlieren kann. Es wird argumentiert, dass sich die öffentlichen Ausgaben aufgrund des Wettbewerbs um Wählerstimmen an der Präferenz des Medianwählers orientieren sollten. Dies dient als Grundlage für den Vergleich mit dem Modell von Romer und Rosenthal.
3. Einführung des Monopolmodells: Dieses Kapitel führt das Monopolmodell von Romer und Rosenthal ein, das vom Medianwähler-Ansatz abweicht und die Rolle der Bürokratie als zentralen Akteur betont. Die Bürokratie agiert als einziger Anbieter eines öffentlichen Gutes und als „Agenda-Setter“, indem sie den Wählern Budgetvorschläge unterbreitet. Die Annahme einer Budgetmaximierung der Bürokratie bildet die Grundlage des Modells. Die individuellen Präferenzen der Wähler werden in Bezug auf den Konsum privaten und öffentlichen Gutes modelliert, um das Wahlverhalten bei gegebenen Budgetvorschlägen zu erklären.
4. Ausgabenniveau bei Sicherheit: [Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel in dem bereitgestellten Auszug.]
5. Ausgabenniveau bei Unsicherheit: [Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel in dem bereitgestellten Auszug.]
6. Empirische Analyse: [Der Text liefert keine Informationen zu diesem Kapitel in dem bereitgestellten Auszug.]
Schlüsselwörter
Medianwähler-Theorem, direkter Demokratie, öffentlicher Ausgaben, Monopolmodell, Bürokratie, Agenda-Setter, Ressourcenallokation, politische Ökonomie, Volksentscheid, Referendum, individuelle Präferenzen, Nutzenfunktion, Budgetmaximierung, Unsicherheit, Wahlbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Öffentliche Ausgaben bei direkter Demokratie
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Modell von Romer und Rosenthal zur Bestimmung öffentlicher Ausgaben bei direkter Demokratie. Im Mittelpunkt steht die These, dass die Ausgaben höher sind als vom traditionellen Medianwähler-Ansatz vorhergesagt.
Welche Modelle werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht den traditionellen Medianwähler-Ansatz mit dem Monopolmodell von Romer und Rosenthal. Der Medianwähler-Ansatz dient als Ausgangspunkt und Vergleichsmaßstab für das Modell von Romer und Rosenthal, welches die Rolle der Bürokratie als Agenda-Setter betont.
Was ist der Medianwähler-Ansatz?
Der Medianwähler-Ansatz besagt, dass bei eindimensionalen Entscheidungsproblemen und eingipfligen Präferenzen die Idealposition des Medianwählers bei Mehrheitsentscheidungen nicht verlieren kann. Im Kontext öffentlicher Ausgaben bedeutet dies, dass sich die Ausgaben aufgrund des Wettbewerbs um Wählerstimmen an der Präferenz des Medianwählers orientieren sollten.
Was ist das Monopolmodell von Romer und Rosenthal?
Das Monopolmodell von Romer und Rosenthal weicht vom Medianwähler-Ansatz ab und betrachtet die Bürokratie als zentralen Akteur. Die Bürokratie agiert als einziger Anbieter eines öffentlichen Gutes und als „Agenda-Setter“, indem sie den Wählern Budgetvorschläge unterbreitet. Die Annahme einer Budgetmaximierung der Bürokratie bildet die Grundlage des Modells.
Welche Rolle spielt die Unsicherheit im Modell?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Sicherheit und Unsicherheit auf die Höhe der öffentlichen Ausgaben. Im Kontext des Modells wird analysiert, wie sich die Einführung von Wahrscheinlichkeiten und die Berücksichtigung von Wahlwiederholungen auf die Budgetmaximierung des Agenda-Setters auswirken.
Welche Aspekte der individuellen Präferenzen werden berücksichtigt?
Die individuellen Präferenzen der Wähler werden in Bezug auf den Konsum privaten und öffentlichen Gutes modelliert, um das Wahlverhalten bei gegebenen Budgetvorschlägen zu erklären. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen dieser Präferenzen auf die Ausgabenhöhe.
Wie wird das Modell empirisch überprüft?
Die Arbeit enthält eine empirische Analyse, um das Modell von Romer und Rosenthal zu überprüfen. Details zur konkreten Vorgehensweise sind im bereitgestellten Auszug jedoch nicht enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Medianwähler-Theorem, direkte Demokratie, öffentliche Ausgaben, Monopolmodell, Bürokratie, Agenda-Setter, Ressourcenallokation, politische Ökonomie, Volksentscheid, Referendum, individuelle Präferenzen, Nutzenfunktion, Budgetmaximierung, Unsicherheit, Wahlbeteiligung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst die Kapitel: Einleitung, Medianwähler-Ansatz, Einführung des Monopolmodells (inkl. Allgemeine Annahmen, Individuelle Präferenzen, Bedeutung des Rückfallpunktes), Ausgabenniveau bei Sicherheit, Ausgabenniveau bei Unsicherheit (inkl. Einführung von Wahrscheinlichkeiten, Budgetmaximierung des Agenda-Setters, Wahlwiederholungen), Empirische Analyse und Fazit.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass die öffentlichen Ausgaben im Modell von Romer und Rosenthal höher sind als vom traditionellen Medianwähler-Ansatz vorhergesagt.
- Quote paper
- Alexander Nagl (Author), 2007, Mehrheitswahl, Bürokratie und Umverteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132133