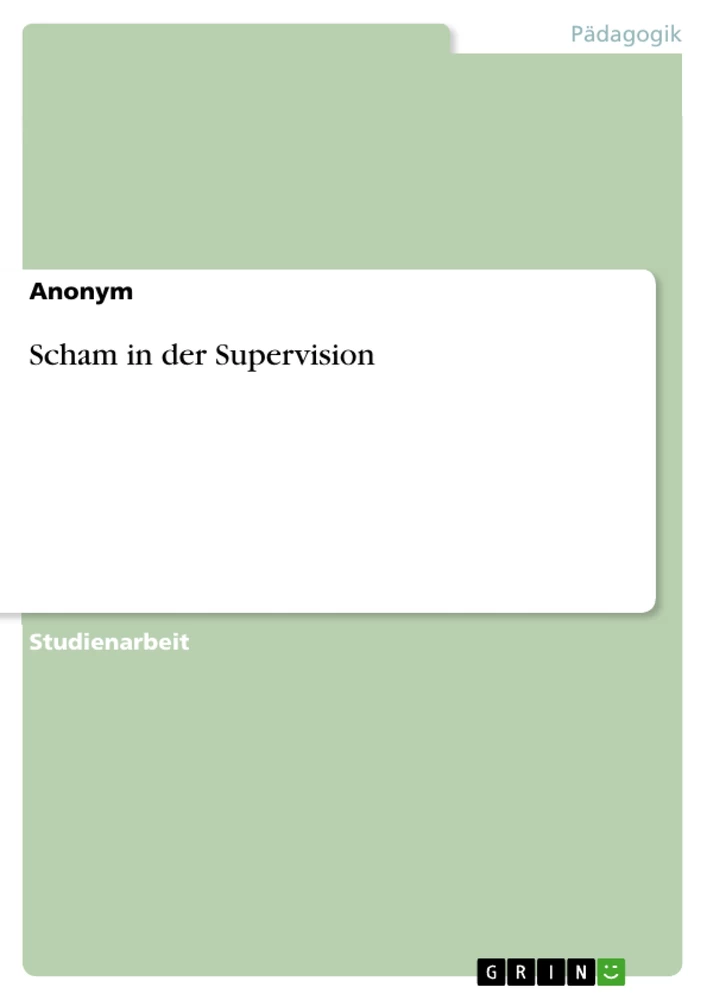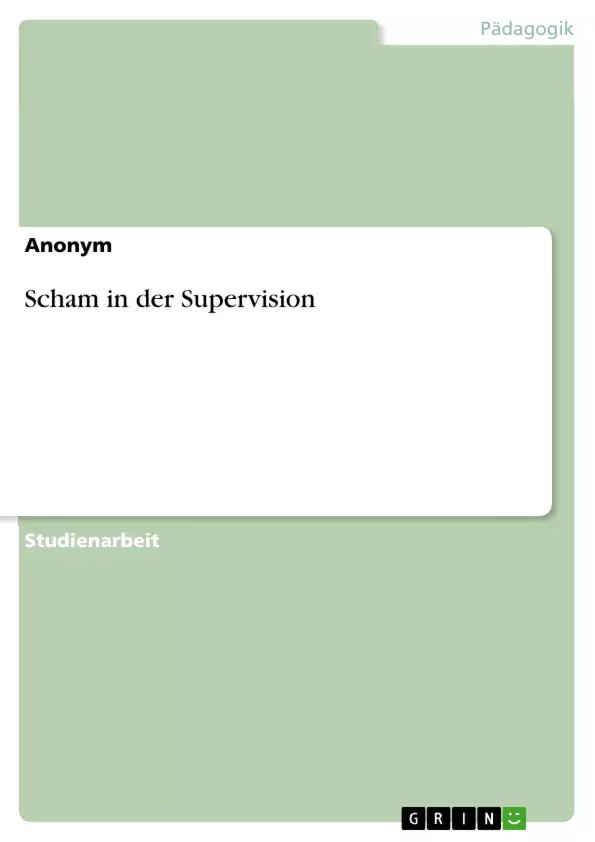Welche Bedeutung hat Scham im Supervisionsprozess?
Hierfür wird zunächst auf das Thema Scham eingegangen, indem phänomenologische und soziale Aspekte der Scham, Schamangst und Selbstwertgefühl, Schamaffekte und psychoanalytische sowie soziologische Sichtweisen dargestellt werden. Im Anschluss wird der Supervisionsprozess erläutert, um in Kapitel vier die potentiellen Schamquellen und -situationen in der Supervision darzustellen, wobei der Fokus auf Gruppensettings liegt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verständnis für die schamsensible Beratungssituation zu erhalten.
Insbesondere im beruflichen Alltag wird das Erleben von Scham tabuisiert und verdrängt, obwohl sie vor allem in den Berufsfeldern, in denen Konkurrenz und Leistung relevant sind, von besonderer Bedeutung ist.
Das Wort Scham stammt ursprünglich von der germanischen Wurzel „skam/ skem“ und bedeutet „Schamgefühl, Beschämung, Schande“ (Wurmser 1990). Dieses indogermanische Wort steht für das Verschleiern und Verbergen. Scham ist mit der Vorstellung, sich selbst zu verbergen verbunden, um die eigene Person zu schützen.
Supervision ist ein Konzept, welches sich mit der Beratung von Organisationen und Institutionen (und daher auch mit Leistung und Konkurrenz) befasst, sodass die Merkmale von Scham(-dynamiken) in der Supervision berücksichtigt werden sollten. Im Verlauf der Arbeit wird dargestellt, welche zentrale Rolle unteranderem Rahmenbedingungen des Supervisionsprozesses hinsichtlich des Entstehens der Scham darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Scham
- Phänomenologische Aspekte der Scham
- Schamangst, Schamaffekt und Scham als vorbeugende Haltung
- Der soziale Aspekt der Scham
- Die acht Schamaffekte
- Schamangst und Selbstwertgefühl
- Scham aus psychoanalytischer Sicht
- Scham aus soziologischer Sicht
- Supervision
- Gegenstand der Supervision
- Ziele der Supervision
- Das Phasenmodell
- Erstkontakt
- Sondierungsgespräch
- Kontrakt
- Prozessverlauf und Auswertung
- Gegenstand der Supervision
- Scham im Supervisionsprozess
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Scham im Supervisionsprozess. Sie analysiert, wie Schamdynamiken im beruflichen Alltag, insbesondere in Konkurrenz- und Leistungsorientierten Feldern, relevant sind. Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Scham, einschließlich phänomenologischer und sozialer Aspekte, Schamangst und Selbstwertgefühl, Schamaffekte sowie psychoanalytische und soziologische Perspektiven. Darüber hinaus wird der Supervisionsprozess beleuchtet, um die potentiellen Schamquellen und -situationen in der Supervision, insbesondere in Gruppensettings, aufzuzeigen.
- Die Rolle von Scham im beruflichen Kontext
- Phänomenologische und soziale Aspekte der Scham
- Schamdynamiken im Supervisionsprozess
- Schamquellen und -situationen in Gruppensettings
- Das Verständnis für die schamsensible Beratungssituation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Scham und deren Relevanz im beruflichen Alltag, insbesondere in Leistungs- und Konkurrenzfeldern, vor. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Aspekte der Scham, wie die phänomenologische und soziale Perspektive, Schamangst und Selbstwertgefühl, Schamaffekte sowie psychoanalytische und soziologische Sichtweisen, diskutiert. Kapitel drei befasst sich mit dem Konzept der Supervision und seinen verschiedenen Phasen. Schließlich analysiert Kapitel vier die potentiellen Schamquellen und -situationen im Supervisionsprozess, wobei der Fokus auf Gruppensettings liegt. Das Ziel der Arbeit ist es, ein Verständnis für die schamsensible Beratungssituation zu erlangen.
Schlüsselwörter
Scham, Supervision, Beratung, Gruppensetting, Leistung, Konkurrenz, Selbstwertgefühl, Schamaffekte, Psychoanalyse, Soziologie, Phänomenologie, Schamangst.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Scham im beruflichen Alltag?
Scham wird oft tabuisiert und verdrängt, ist aber besonders in Berufsfeldern mit hohem Konkurrenz- und Leistungsdruck von großer Bedeutung.
Was bedeutet das Wort Scham ursprünglich?
Es stammt von der germanischen Wurzel "skam" ab und steht für das Verschleiern und Verbergen zum Schutz der eigenen Person.
Warum ist Scham in der Supervision ein Thema?
Da Supervision oft Leistungen und Dynamiken in Organisationen berät, können Schamsituationen entstehen, die den Beratungserfolg beeinflussen.
Welche Aspekte der Scham werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit beleuchtet phänomenologische, soziale, psychoanalytische und soziologische Sichtweisen sowie Schamangst und Selbstwertgefühl.
Was ist das Ziel einer schamsensiblen Beratung?
Das Ziel ist es, ein Verständnis für Schamdynamiken zu entwickeln, um in der Supervision professionell und schützend damit umzugehen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Scham in der Supervision, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1320348