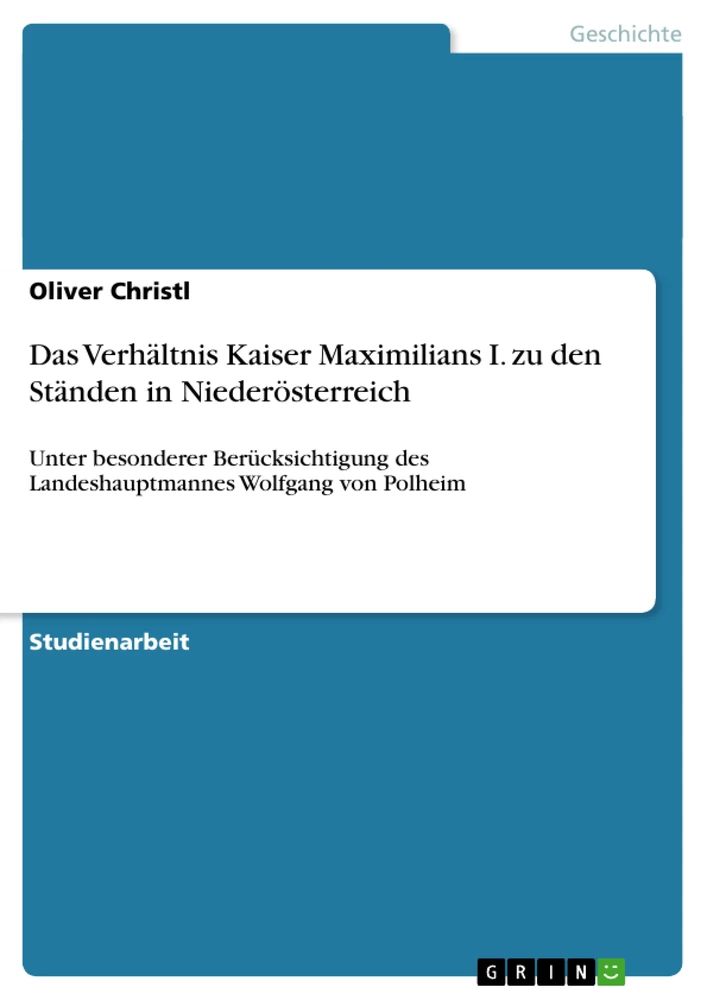Die Landesherrschaft war im Mittelalter geprägt von einem starken Dualismus: der Herrscher war in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den wichtigsten Gliedern seines Herrschaftsbereiches eingebunden. Diese taten ihre Forderungen, aber auch ihre Bereitschaft zur Unterstützung des Herrschers, in Form von Ständeversammlungen kund. Gegen Ende des Mittelalters war der Einfluss der Landstände gegenüber dem jeweiligen Landesherrn in einem Maße gewachsen, dass der deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I. versuchte, seine Herrschaft ohne die Einflussnahme der Stände zu bestreiten. Auf welche Weise und weshalb Maximilian die Stände einzugrenzen versuchte, und wie diese ihre im Laufe der Jahre angewachsene Machtstellung zu behaupten vermochten, soll im Folgenden untersucht werden.
Nach einer einleitenden Beschreibung der Verwaltungsreform Maximilians I. soll im nachfolgenden Teil die ständisch geprägte Herrschaftsausübung seiner Vorgänger beschrieben werden. Die anschließende Untersuchung zum Verhältnis Maximilians zu den Ständen wird durch eine Beschreibung der Situation Niederösterreichs unter der Führung des von Maximilian eingesetzten Hauptmannes Wolfgang von Polheim abgeschlossen.
Die Geschichte des Hauses Habsburg hat in besonderem Maß die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen und dementsprechend Einzug in eine immense Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten gehalten. Zur Zeit Maximilians I. ist im Besonderen das fünfbändig Werk Hermann Wiesfleckers als grundlegend zu betrachten. Die vielgestaltigen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte zur Entwicklung des Herrschaftsbegriffes im Mittelalter basieren allesamt auf der richtungsweisenden Monographie „Land und Herrschaft“ von Otto Brunner. Die Verwaltungsgeschichte Österreichs wurde vielfach untersucht, etwa von Fellner und Kretschmayer oder auch O. Stolz und, speziell zur Verwaltungsreform Maximilians I., durch Th. Mayer.
Die zugrunde liegenden Quellen in Form von unzähligen Aktenstücken, Briefen und Dokumenten sind leider nur schwer zugänglich, da sie in den Archiven der verschieden österreichischen Stadt- und Staatsarchive lagern. Sie sind in der vorliegenden Fachliteratur aber ausgiebig untersucht und bearbeitet worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verwaltungsreform unter Maximilian I.
- Österreich unter den frühen Habsburgern
- Situation des österreichischen Adels
- Konsequenzen
- Verhältnis zum Herrscher
- Organisation der Stände
- Situation unter Maximilian I.
- Maximilian I. und die Stände
- Niederösterreichisches Regiment unter Wolfgang von Polheim
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Versuch Maximilians I., den Einfluss des österreichischen Adels und der Stände einzuschränken, sowie die Gegenreaktionen der Stände. Der Fokus liegt auf der Verwaltungsreform Maximilians I. und deren Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Herrscher und Ständen in Österreich, insbesondere in Niederösterreich.
- Verwaltungsreform Maximilians I. und deren Ziele
- Die Situation des österreichischen Adels unter den frühen Habsburgern
- Das Verhältnis zwischen Maximilian I. und den Landständen
- Die Rolle des Niederösterreichischen Regiments unter Wolfgang von Polheim
- Die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Depression auf den Adel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den starken Dualismus zwischen Landesherrschaft und Landständen im Mittelalter und die wachsende Macht der Stände bis zum Versuch Maximilians I., diese einzuschränken. Sie umreißt die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit, welche die Verwaltungsreform Maximilians I., die Situation des Adels unter den frühen Habsburgern und das Verhältnis Maximilians I. zu den Ständen untersucht. Die Einleitung verweist auf wichtige Forschungsliteratur wie die Arbeiten von Hermann Wiesflecker und Otto Brunner und skizziert die Herausforderungen bei der Quellenarbeit.
Verwaltungsreform unter Maximilian I.: Dieses Kapitel beschreibt die Verwaltungsreform Maximilians I., die auf bereits bestehenden Strukturen in Tirol aufbaute und später auf Niederösterreich ausgedehnt wurde. Maximilian I. etablierte ein Kollegium von Statthaltern, die die politischen, gerichtlichen und finanziellen Geschäfte führten und die lokale Verwaltung reformierten. Diese Statthalter waren zunächst aus den alten Regimentern rekrutiert, wurden aber zunehmend durch landesfremde Beamte ersetzt. Diese Maßnahmen zielten auf eine Stärkung der landesfürstlichen Kontrolle und einen Rückgang des Einflusses des Adels und der Stände. Das Kapitel erläutert die Motivation Maximilians I. für diese Reformen im Kontext der bestehenden Verwaltungsstrukturen und den Vergleich zu anderen europäischen Herrschaftsmodellen.
Österreich unter den frühen Habsburgern: Dieses Kapitel analysiert die Situation des österreichischen Adels unter den frühen Habsburgern. Der Adel bestand hauptsächlich aus herzoglichen Dienstmannen, die in einem Untertanenverhältnis zum Landesfürsten standen, aber dennoch bestimmte Privilegien und politische Rechte behielten. Sie hatten ein Mitspracherecht in politischen und rechtlichen Fragen und konnten sogar bei Streitigkeiten um die Nachfolge des Landesfürsten mitbestimmen. Das Kapitel beschreibt auch die Besonderheiten der Landwirtschaft in Niederösterreich mit ihrem zersplitterten Grundbesitz und die Herausforderungen, die dies für die Kontrolle der Untertanen und die Durchsetzung der Obrigkeitsrechte mit sich brachte. Der landwirtschaftliche Niedergang des 14. und 15. Jahrhunderts verschärfte die Krise des Adels, insbesondere des Kleinadadels.
Schlüsselwörter
Maximilian I., Verwaltungsreform, österreichischer Adel, Landstände, Niederösterreich, Habsburger, Herrschaftsausübung, Ständeversammlung, landesfürstliche Kontrolle, Landwirtschaft, Grundherrschaft, Ministerialität, Privilegien.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Verwaltungsreform unter Maximilian I. und der österreichische Adel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verwaltungsreform Maximilians I. und deren Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen dem Herrscher und dem österreichischen Adel, insbesondere in Niederösterreich. Im Fokus steht der Versuch Maximilians I., den Einfluss des Adels und der Stände einzuschränken, sowie die Reaktionen der betroffenen Gruppen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verwaltungsreform Maximilians I. und deren Ziele, die Situation des österreichischen Adels unter den frühen Habsburgern, das Verhältnis zwischen Maximilian I. und den Landständen, die Rolle des Niederösterreichischen Regiments unter Wolfgang von Polheim und die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Depression auf den Adel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Verwaltungsreform unter Maximilian I., ein Kapitel zu Österreich unter den frühen Habsburgern (mit Fokus auf die Situation des Adels), und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Wie beschreibt die Arbeit die Verwaltungsreform Maximilians I.?
Die Arbeit beschreibt die Verwaltungsreform als einen Versuch Maximilians I., die landesfürstliche Kontrolle zu stärken und den Einfluss des Adels und der Stände zu reduzieren. Die Reform baute auf bestehenden Strukturen auf, etablierte ein Kollegium von Statthaltern und führte zu einem zunehmenden Ersatz von adeligen Beamten durch landesfremde. Die Motivation Maximilians I. wird im Kontext der bestehenden Verwaltungsstrukturen und im Vergleich zu anderen europäischen Herrschaftsmodellen erläutert.
Welche Rolle spielte der österreichische Adel?
Die Arbeit beschreibt den österreichischen Adel als hauptsächlich aus herzoglichen Dienstmannen bestehend, die ein Untertanenverhältnis zum Landesfürsten hatten, aber dennoch Privilegien und politische Rechte besaßen. Ihr Mitspracherecht in politischen und rechtlichen Fragen und ihre Rolle bei Nachfolgestreitigkeiten werden thematisiert. Der landwirtschaftliche Niedergang des 14. und 15. Jahrhunderts verschärfte die Krise des Adels, besonders des Kleinadadels.
Wie wird das Verhältnis zwischen Maximilian I. und den Landständen dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den Versuch Maximilians I., den Einfluss der Landstände einzuschränken, im Kontext der Verwaltungsreform. Sie analysiert die Reaktionen der Stände auf diese Maßnahmen und untersucht das Machtverhältnis zwischen dem Herrscher und den Ständen in Niederösterreich.
Welche Bedeutung hat das Niederösterreichische Regiment unter Wolfgang von Polheim?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Niederösterreichischen Regiments unter Wolfgang von Polheim im Kontext der Verwaltungsreform Maximilians I. Es wird beleuchtet, wie dieses Regiment in die Reform eingebunden war und welche Bedeutung es für die Durchsetzung der landesfürstlichen Kontrolle hatte.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Einleitung verweist auf wichtige Forschungsliteratur, wie die Arbeiten von Hermann Wiesflecker und Otto Brunner, und skizziert die Herausforderungen bei der Quellenarbeit. Die genauen Quellen sind nicht im vorliegenden HTML-Ausschnitt aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Maximilian I., Verwaltungsreform, österreichischer Adel, Landstände, Niederösterreich, Habsburger, Herrschaftsausübung, Ständeversammlung, landesfürstliche Kontrolle, Landwirtschaft, Grundherrschaft, Ministerialität, Privilegien.
- Citation du texte
- Oliver Christl (Auteur), 2004, Das Verhältnis Kaiser Maximilians I. zu den Ständen in Niederösterreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131991