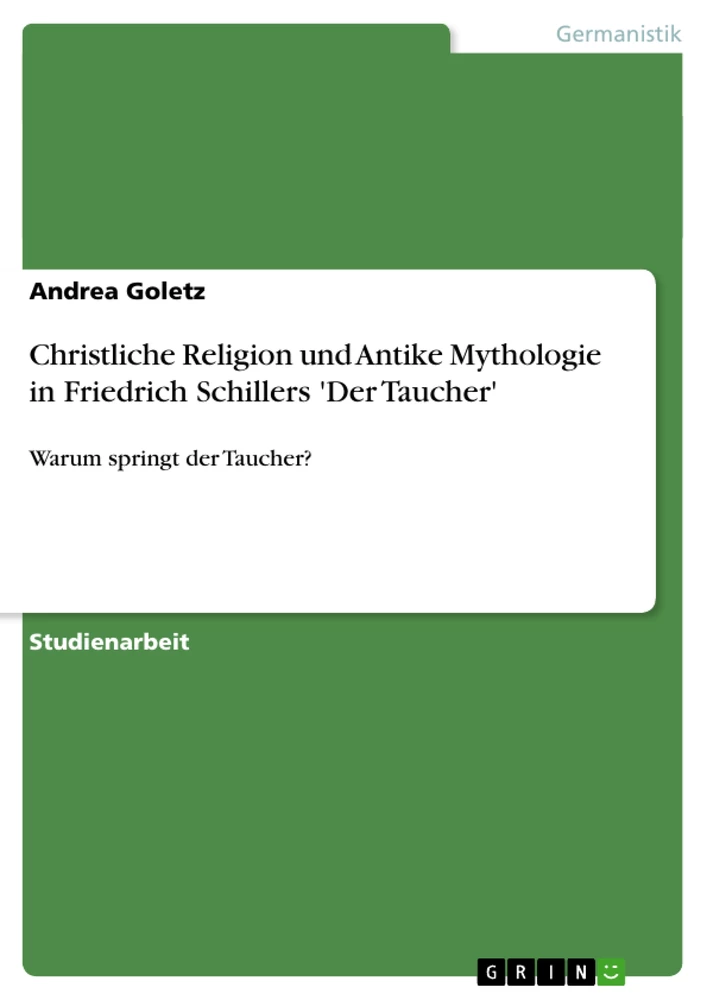Zunächst verfolgt die Arbeit eine begründete Einordnung in die Gattung der Balladen. Daraufhin soll die Verwendung von antiker Mythologie und christlichen Motiven zuerst näher betrachtet werden. Schillers Ballade spielt scheinbar in der Zeit des Mittelalters, in der die Antike zwar teilweise präsent war, aber dennoch keine Hauptrolle spielte; viel eher übernahm die christliche Religion letzteres. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Verwendung dieser verschiedenen Denk- und Glaubensweisen zu erläutern und in einen Zusammenhang zu bringen. Nach einer genauen Betrachtung dessen wird auf weitere gegensätzliche und zusammenhängende Themenbereiche eingegangen werden, bevor die Schlussbetrachtung ein Fazit zieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung in die Gattung der Ballade
- 3. Antike und Christentum
- 4. Kontrast und Intertextualität
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade „Der Taucher“. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ballade in ihren gattungsspezifischen Kontext einzuordnen, die Verwendung antiker und christlicher Motive zu untersuchen und gegensätzliche sowie zusammenhängende Themenbereiche zu beleuchten.
- Gattungseigenschaften der Ballade „Der Taucher“
- Interaktion von antiker Mythologie und christlichen Motiven
- Analyse der Zahlensymbolik (insbesondere der Zahl Drei)
- Motiv der Hybris und die Überwindung der Natur
- Zusammenhang zwischen Belohnung, Ansehen und dem Sprung in den Tod
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie erwähnt die positive Rezeption der Ballade durch Goethe und Körner und betont die aktuelle Relevanz des Themas „Erforschung des Unbekannten“. Die Arbeit kündigt die geplante Einordnung der Ballade in die Gattung der Balladen, die Analyse der antiken und christlichen Motive sowie die Untersuchung gegensätzlicher und zusammenhängender Themenbereiche an, bevor sie im Fazit eine Schlussbetrachtung vornehmen wird. Die Einleitung legt den Grundstein für die detaillierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten von Schillers Werk.
2. Einordnung in die Gattung der Ballade: Dieses Kapitel untersucht die Einordnung von Schillers „Der Taucher“ in die Gattung der Balladen. Es werden die epischen, dramatischen und lyrischen Elemente des Textes analysiert, unter Berücksichtigung des Erzählerkommentars, des dramatischen Aufbaus (Einhaltung der aristotelischen Einheiten, Wendepunkt, Höhepunkte), sowie der lyrischen Elemente wie Reim, Strophenform, Stilmittel (Enjambements, Anaphern, Onomatopoetika). Die Diskussion über die mögliche Zuordnung zu Naturballaden oder anthropologischen Balladen wird geführt, wobei die ambivalenten Aspekte der Naturgewalt und die hybrische Herausforderung des Königs hervorgehoben werden. Das Kapitel schließt mit der Feststellung, dass eine eindeutige Zuordnung zu einer Balladengattung nicht zwingend notwendig und angesichts der Vielschichtigkeit des Werkes auch nicht sinnvoll ist.
3. Antike und Christentum: Das Kapitel analysiert die Verschränkung antiker und christlicher Motive in der Ballade. Die Erwähnung der Charybdis aus der Odyssee, die dreimalige Aufforderung des Königs an den Taucher und die parallelen Bezüge zur dreimaligen Verleugnung Christi durch Petrus sowie zur dreimaligen Versuchung Jesu durch den Teufel werden detailliert untersucht. Die Zahlensymbolik der Drei und ihre Bedeutung im Kontext der Handlung und des christlichen Glaubens werden hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Verhaltens des Tauchers mit dem Verhalten Jesu, insbesondere im Hinblick auf die Versuchung und die Entscheidung, sich Gott zu übergeben. Das Kapitel verdeutlicht, wie Schiller antike und christliche Elemente miteinander verwebt, um die Motivationen und das Schicksal des Tauchers zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Der Taucher, Ballade, Gattungsmerkmale, Antike, Christentum, Zahlensymbolik, Hybris, Naturgewalt, Motiv der Versuchung, menschliche Grenzen.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers Ballade "Der Taucher"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade "Der Taucher". Sie untersucht die Einordnung der Ballade in ihren gattungsspezifischen Kontext, die Verwendung antiker und christlicher Motive und beleuchtet gegensätzliche sowie zusammenhängende Themenbereiche. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Einordnung in die Gattung der Ballade, eine Analyse der antiken und christlichen Motive, eine Schlussbetrachtung und ein Kapitel zu Kontrast und Intertextualität.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Gattungseigenschaften der Ballade, der Interaktion von antiker Mythologie und christlichen Motiven, der Analyse der Zahlensymbolik (insbesondere der Zahl Drei), dem Motiv der Hybris und der Überwindung der Natur sowie dem Zusammenhang zwischen Belohnung, Ansehen und dem Sprung in den Tod.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Einordnung in die Gattung der Ballade, Antike und Christentum, Kontrast und Intertextualität und Schlussbetrachtung. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Ballade, wobei die Kapitel 2 und 3 die Hauptanalyse bilden.
Was wird in Kapitel 2 ("Einordnung in die Gattung der Ballade") behandelt?
Kapitel 2 analysiert die epischen, dramatischen und lyrischen Elemente des Textes, den Erzählerkommentar, den dramatischen Aufbau (Aristotelische Einheiten, Wendepunkt, Höhepunkte) und lyrische Elemente wie Reim, Strophenform und Stilmittel. Es diskutiert die mögliche Zuordnung zu Naturballaden oder anthropologischen Balladen und hebt die ambivalenten Aspekte der Naturgewalt und die hybrische Herausforderung des Königs hervor. Eine eindeutige Zuordnung zu einer Balladengattung wird als nicht zwingend notwendig erachtet.
Was wird in Kapitel 3 ("Antike und Christentum") behandelt?
Kapitel 3 analysiert die Verschränkung antiker und christlicher Motive. Es untersucht die Erwähnung der Charybdis, die dreimalige Aufforderung des Königs und die Parallelen zur dreimaligen Verleugnung Christi durch Petrus und zur dreimaligen Versuchung Jesu. Die Zahlensymbolik der Drei und ihre Bedeutung werden hervorgehoben. Der Vergleich des Verhaltens des Tauchers mit dem Verhalten Jesu im Hinblick auf Versuchung und Entscheidung wird detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Der Taucher, Ballade, Gattungsmerkmale, Antike, Christentum, Zahlensymbolik, Hybris, Naturgewalt, Motiv der Versuchung, menschliche Grenzen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine abschließende Interpretation der Ballade "Der Taucher". (Der genaue Inhalt der Schlussbetrachtung ist in der gegebenen Vorschau nicht detailliert beschrieben.)
- Quote paper
- Andrea Goletz (Author), 2009, Christliche Religion und Antike Mythologie in Friedrich Schillers 'Der Taucher', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131986