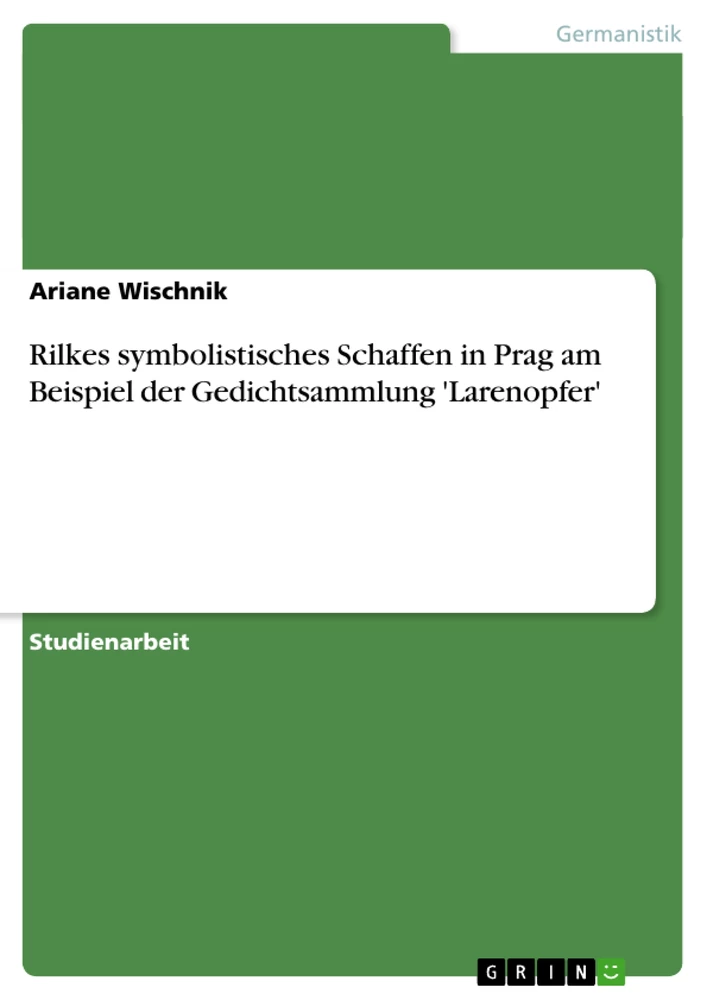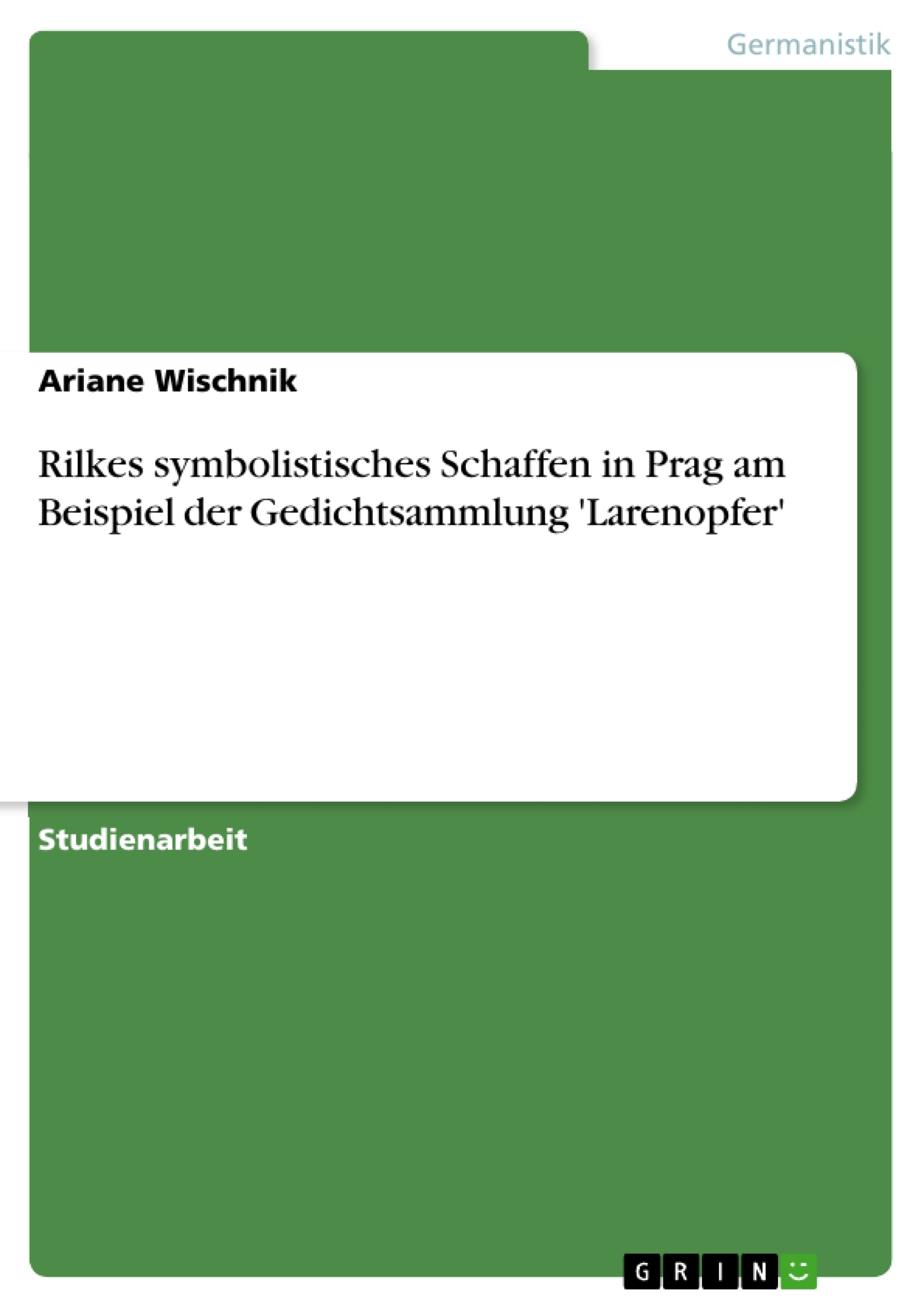Rainer Maria Rilke war schlecht für diese Zeit geeignet. Dieser große Lyriker hat nichts getan, als dass er das deutsche Gedicht zum ersten mal vollkommen gemacht hat; er war kein Gipfel dieser Zeit, er war eine der Erhöhungen, auf welchen das Schicksal des Geistes über Zeiten wegschreitet...“1
Kein geringerer als Robert Musil äußert sich so lobend über den Dichter der Jahrhundertwende, dessen lyrisches Werk bis heute weniger den Verstand als den Geist seiner Leser anspricht. Bis zu der Vollkommenheit seiner späten Werke legte Rilke jedoch einen langen Weg zurück. Die „Duineser Elegien“ und die „Sonette an Orpheus“, Werke, die in der heutigen Rezeption große Anerkennung genießen, entstanden erst in den letzten Jahren seines Lebens, als er auf den reichen Erfahrungsschatz seines literarischen Schaffens zurückblicken konnte. Die Gedichte seiner Jugend und seine ersten literarischen Gehversuche versinken in Vergessenheit. Sie spiegeln wieder, was die Literaturkritik an dem jungen Rilke zu bemängeln findet; der junge Autor stand seinen literarischen Zeitgenossen wir Stefan George und Hugo von Hofmannsthal in Bildung und Ausdruck deutlich nach, konnte sich mit deren Werken im gleichen Alter nicht messen2. Rilke selbst schätzte in späteren Jahren seine ersten Veröffentlichungen nicht mehr allzu hoch ein.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit einem von Rilkes ersten Gedichtbänden. Anhand zweier ausgewählter Gedichte des „Larenopfer“ soll aufgezeigt werden, in welchem Maße sich die symbolistische Darstellungskunst, der Rilke bis zu seinem Lebensende treu blieb, bereits in diesem Frühwerk niederschlägt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Leben und Werk
- Die Jahrhundertwende
- Grundzüge der Epoche
- Das Wilhelminische Zeitalter
- Industrielle Revolution und Naturalismus
- Der Symbolismus
- Die Kunst um der Kunst Willen
- Sprachliche Umsetzung und Motivwahl
- Larenopfer
- Entstehungsbedingungen
- Gestaltung
- Symbolismus im Larenopfer
- Der Träumer
- Nachtbild
- Schlussbetrachtung
- Grundzüge der Epoche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit widmet sich der Analyse von Rainer Maria Rilkes symbolistischem Schaffen in Prag, insbesondere anhand der Gedichtsammlung „Larenopfer". Sie untersucht, wie sich Rilkes symbolistische Darstellungskunst bereits in diesem frühen Werk manifestiert und welche Bedeutung sie im Kontext der Zeit und seiner Biografie erlangt.
- Die symbolistische Strömung und ihre Bedeutung im Kontext der Jahrhundertwende
- Rilkes literarische Entwicklung im Spannungsfeld von Tradition und Moderne
- Die Analyse ausgewählter Gedichte aus „Larenopfer“ und ihre symbolische Ausdeutung
- Der Einfluss von Rilkes persönlicher Lebensgeschichte auf seine literarische Arbeit
- Die Rezeption und Wirkung von „Larenopfer“ in der Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Rilkes Werk in den Kontext der Literaturgeschichte und führt die Relevanz seiner symbolistischen Dichtung aus. Das zweite Kapitel beleuchtet Rilkes Leben und Werk, mit besonderem Augenmerk auf die Entstehung von „Larenopfer“ und die prägenden Einflüsse seiner frühen Karriere. Das dritte Kapitel widmet sich den historischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Jahrhundertwende, die den Hintergrund für Rilkes literarisches Schaffen bildeten. Es werden die wichtigsten Strömungen und Tendenzen der Zeit, wie der Wilhelminismus und der Naturalismus, beleuchtet. Der vierte Abschnitt befasst sich mit dem Symbolismus und seiner Kunstauffassung, insbesondere der „Kunst um der Kunst Willen“, sowie der sprachlichen Umsetzung und der Motivwahl dieser literarischen Strömung. Das fünfte Kapitel erläutert die Entstehung und Gestaltung des „Larenopfer“ und analysiert die symbolistische Gestaltung dieses Gedichtbandes. Das sechste Kapitel beleuchtet die Symbolisierung des Träumers und des Nachtbildes in Rilkes Gedichten. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst und ihre Bedeutung für das Gesamtwerk Rilkes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, Symbolismus, Jahrhundertwende, „Larenopfer“, Kunst um der Kunst Willen, Sprachliche Umsetzung, Motivwahl, Träumer, Nachtbild, Prag, Leben und Werk, Historischer Kontext, Literaturgeschichte,
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Larenopfer“ von Rainer Maria Rilke?
Es ist eine frühe Gedichtsammlung Rilkes, die seiner Heimatstadt Prag gewidmet ist und bereits deutliche symbolistische Züge trägt.
Welche Merkmale des Symbolismus finden sich in diesem Werk?
Typisch sind die „Kunst um der Kunst Willen“, eine subjektive Motivwahl (wie Träume und Nachtbilder) und eine bildhafte, suggestive Sprache.
Wie wurde Rilkes Frühwerk von der Literaturkritik aufgenommen?
Im Vergleich zu Zeitgenossen wie Hofmannsthal wurde der junge Rilke oft als weniger gebildet und ausdrucksstark kritisiert; er selbst schätzte diese Werke später gering ein.
Welchen Einfluss hatte Prag auf Rilkes Dichtung?
Prag diente als atmosphärische Kulisse für seine frühen Gedichte und prägte seine Auseinandersetzung mit Tradition, Geschichte und Identität.
Was bedeutet „L'art pour l'art“ im Kontext Rilkes?
Es beschreibt die Auffassung, dass Kunst keinen moralischen oder sozialen Zweck erfüllen muss, sondern einen Eigenwert besitzt.
- Citation du texte
- Ariane Wischnik (Auteur), 2002, Rilkes symbolistisches Schaffen in Prag am Beispiel der Gedichtsammlung 'Larenopfer', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13189