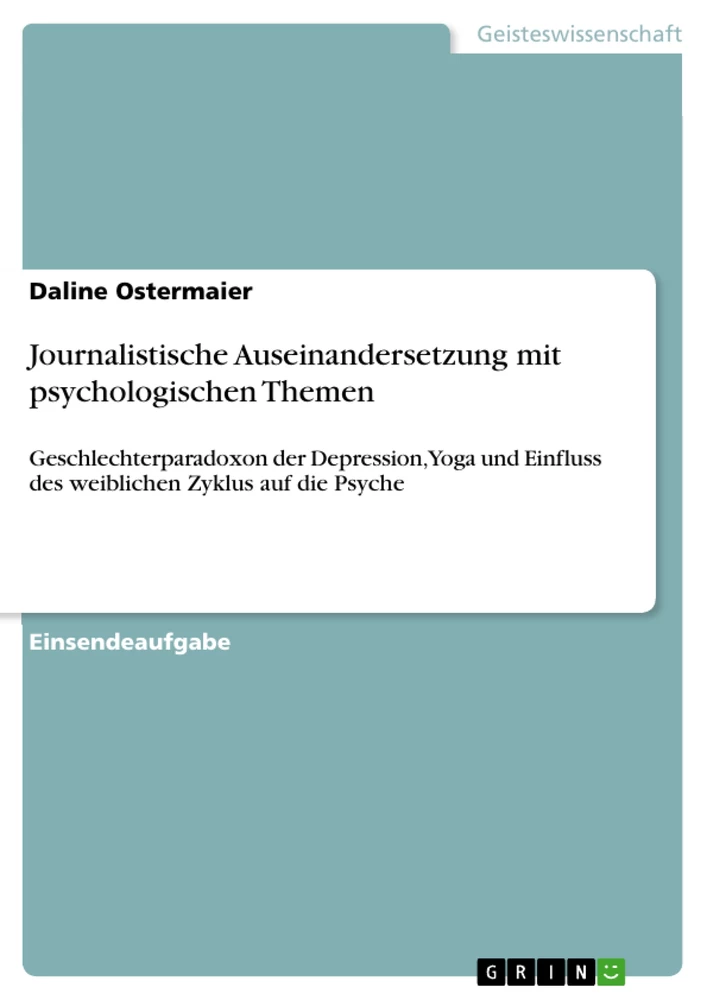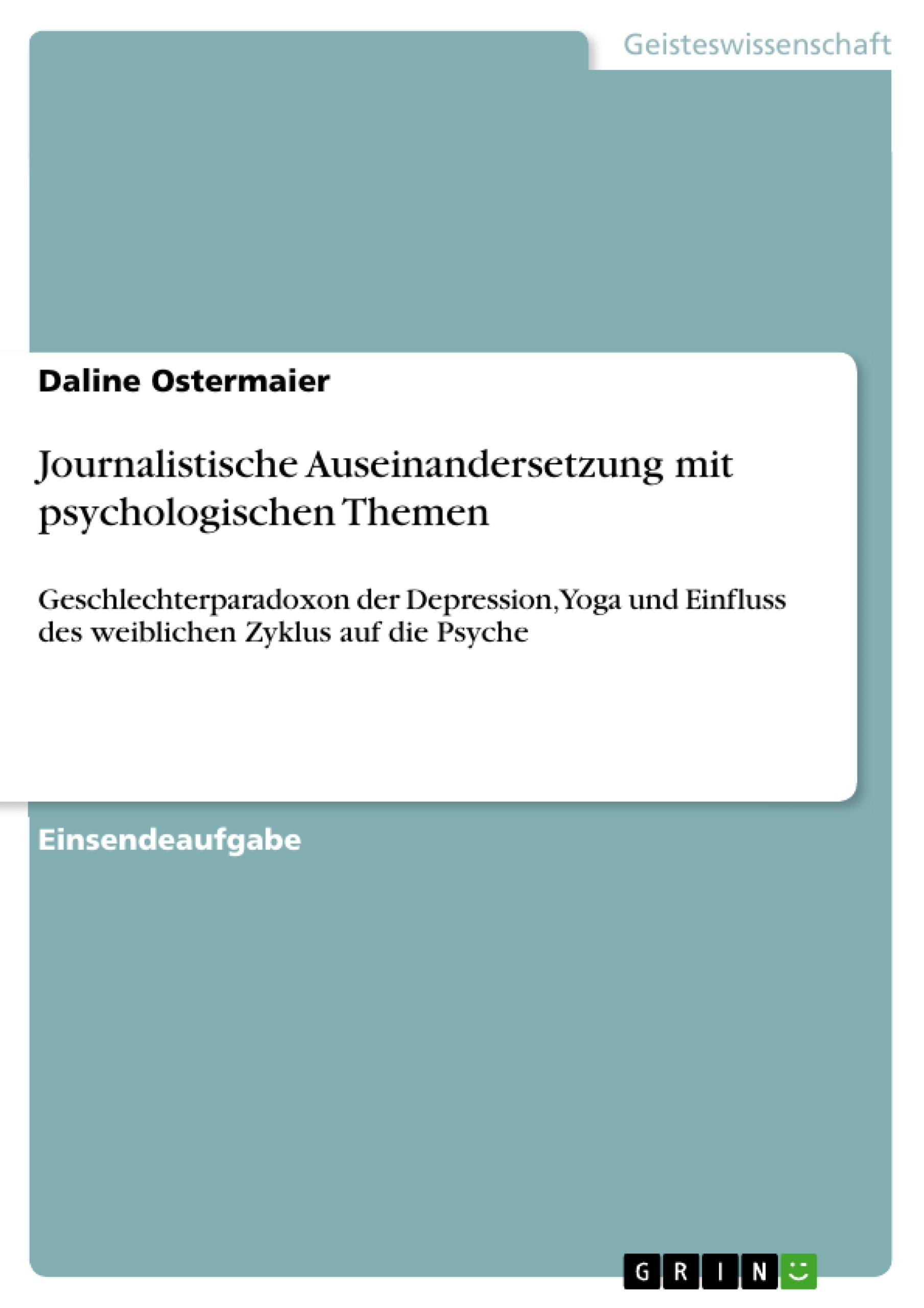Im Rahmen dieser Arbeit beschäftigte sich der Autor mit fünf unterschiedlichen Themen, wobei das psychologische Wissen in Form von Blog-Artikeln aufbereitet wurde.
Der erste Beitrag setzt sich mit dem Tabuthema "Psychotherapeuten mit psychischen Störungen" auseinander. Im zweiten Beitrag wird das Geschlechterparadoxon der Depression untersucht. Das Thema des dritten Artikels ist Yoga. Es wird der Frage nachgegangen, welches Potenzial die Praxis in der psychischen Gesundheitsfürsorge hat. Die transorbitale Lobotomie aus dem Zeitalter der Psychochirurgie wird im vierten Beitrag beleuchtet. Der fünfte Artikel geht darauf ein, wie Social Media zu Selbstdiagnosen von AD(H)S und anderen psychischen Störungen führt. Schließlich wird im Rahmen des sechsten und letzten Beitrags der Einfluss des weiblichen Zyklus auf die Psyche dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Tabuthema: Psychotherapeuten mit psychischen Störungen
- Beitrag
- Quellen
- Das Geschlechterparadoxon der Depression – was es uns lehrt
- Beitrag
- Quellen
- Yoga - Welches Potenzial hat es in der psychischen Gesundheitsfürsorge?
- Beitrag
- Quellen
- Transorbitale Lobotomie - zum Zeitalter der Psychochirurgie
- Beitrag
- Quellen
- Social Media und AD(H)S - Durch Tik Tok zur Selbstdiagnose?
- Beitrag
- Quellen
- Der Menstruationszyklus – Psychische Achterbahnfahrt im Alltag
- Beitrag
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit verschiedenen Themen aus dem Bereich der Psychologie und Mentalen Gesundheit. Ziel ist es, auf relevante Fragestellungen aufmerksam zu machen und die Diskussion über wichtige Themen in der Gesellschaft anzuregen.
- Psychische Gesundheit von Psychotherapeuten
- Geschlechterunterschiede bei Depression
- Potenzial von Yoga in der psychischen Gesundheitsversorgung
- Psychochirurgie und ihre Geschichte
- Social Media und Selbstdiagnose von AD(H)S
Zusammenfassung der Kapitel
Tabuthema: Psychotherapeuten mit psychischen Störungen
Dieses Kapitel beleuchtet das Tabuthema psychischer Störungen bei Psychotherapeuten. Es analysiert die Stigmatisierung und die Auswirkungen auf die Betroffenen, sowie die Präventionsmaßnahmen und Lösungsansätze.
Das Geschlechterparadoxon der Depression – was es uns lehrt
Dieses Kapitel untersucht das Geschlechterparadoxon der Depression und diskutiert die Ursachen und Folgen dieses Phänomens.
Yoga - Welches Potenzial hat es in der psychischen Gesundheitsfürsorge?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Potenzial von Yoga in der psychischen Gesundheitsversorgung und erörtert die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu seiner Wirksamkeit.
Transorbitale Lobotomie - zum Zeitalter der Psychochirurgie
Dieses Kapitel stellt die Transorbitale Lobotomie und ihre historische Bedeutung vor. Es beleuchtet die ethischen und wissenschaftlichen Kontroversen um diese medizinische Praxis.
Social Media und AD(H)S - Durch Tik Tok zur Selbstdiagnose?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss von Social Media auf die Selbstdiagnose von AD(H)S und analysiert die Risiken und Chancen dieser Entwicklung.
Der Menstruationszyklus – Psychische Achterbahnfahrt im Alltag
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss des Menstruationszyklus auf die psychische Gesundheit und diskutiert die vielfältigen Auswirkungen auf das alltägliche Leben.
Schlüsselwörter
Psychische Gesundheit, Psychotherapie, Stigmatisierung, Depression, Geschlechterunterschiede, Yoga, Psychochirurgie, Social Media, Selbstdiagnose, AD(H)S, Menstruationszyklus.
- Citar trabajo
- Daline Ostermaier (Autor), 2022, Journalistische Auseinandersetzung mit psychologischen Themen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1314026