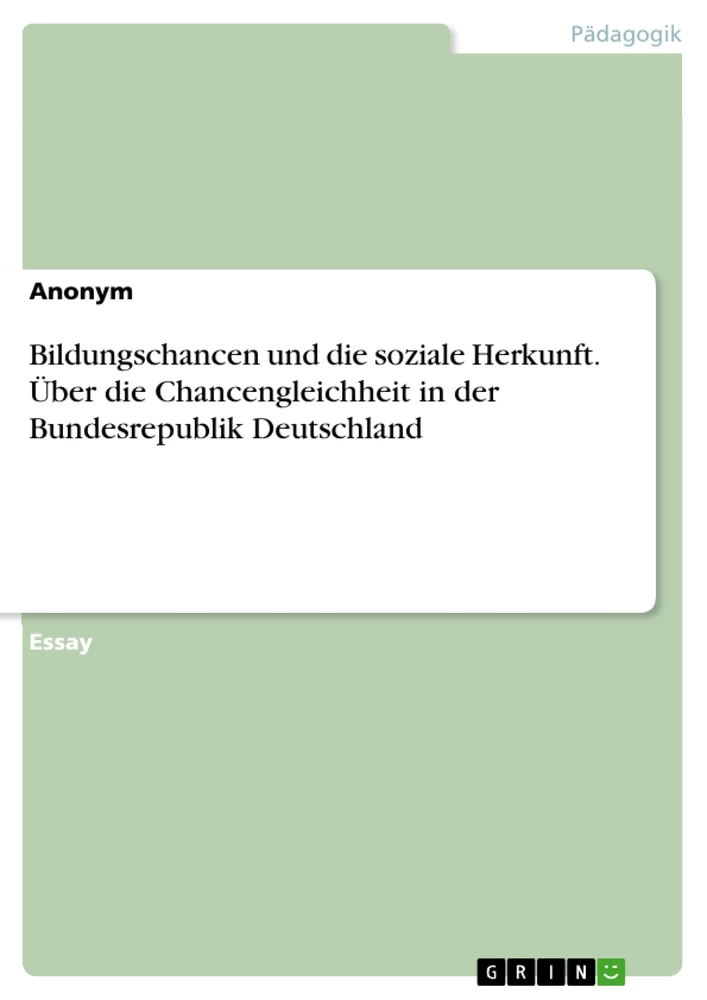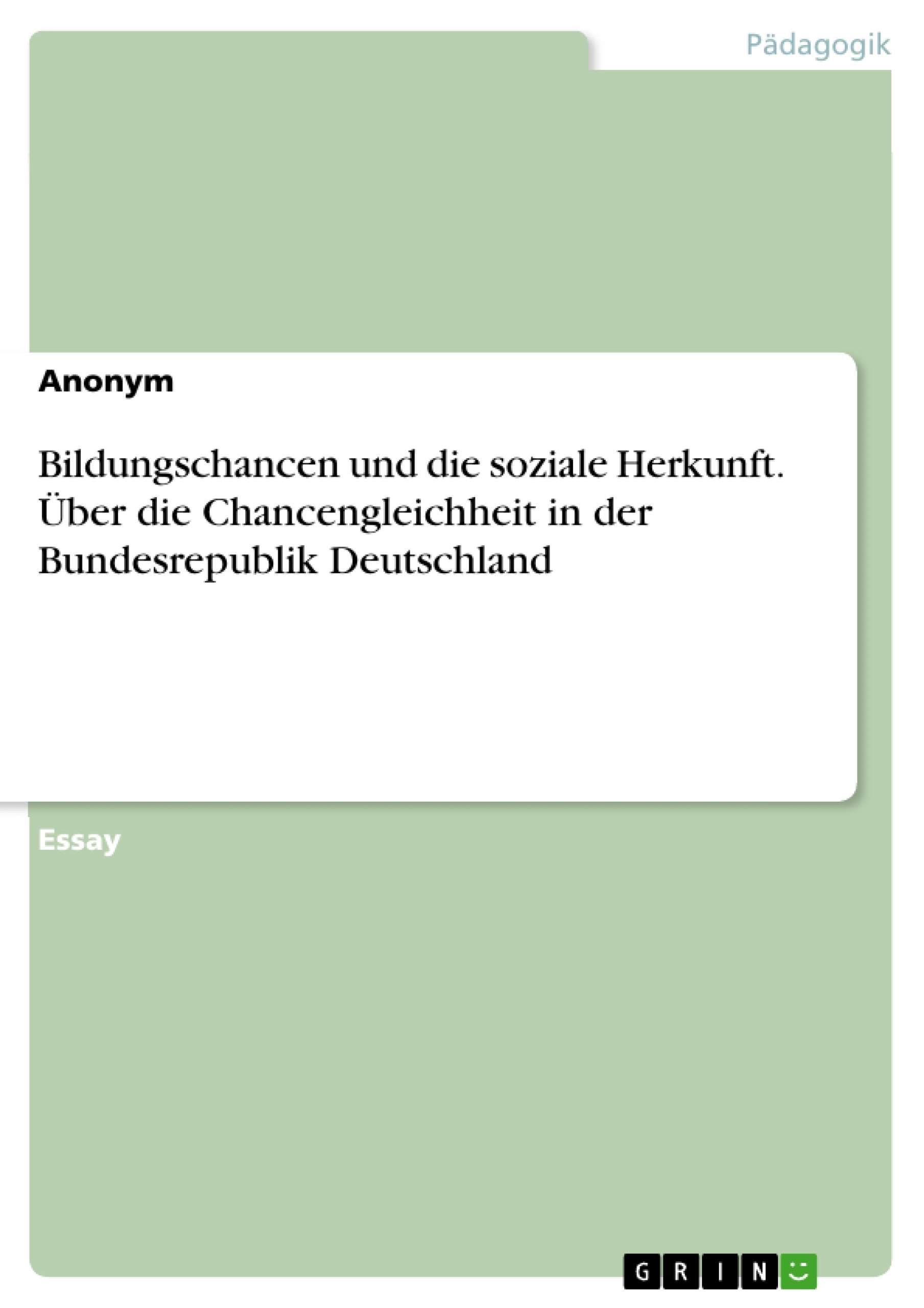Ein Essay über die soziale Frage und die Bildungsgleichheit im Zusammenhang mit dieser Frage.
Der PISA-Schock im Jahre 2000 verdeutlichte, dass Deutschland im europäischen und internationalen Vergleich nicht so gut abschnitt, wie erhofft. Gerade für Deutschland macht die Studie jedoch einen weiteren Fakt deutlich: Die Bildung von Kindern hängt vor allem vom Elternhaus ab. So titelt die Süddeutsche Zeitung 18 Jahre nach dem PISA-Schock 2000: „In Deutschland entscheidet noch immer die Herkunft über den Bildungserfolg“ (Hoffmann, 2018).
Inhaltsverzeichnis
- Bildungschancen und die soziale Herkunft
- Soziale Gleichheit und Ungleichheit
- Politische Gleichheit
- Soziale Gleichheit
- Der Reproduktionsansatz nach Bourdieu
- Kapitalsorten nach Bourdieu
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Inkorporiertes kulturelles Kapital
- Objektiviertes kulturelles Kapital
- Institutionalisiertes kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Übergangsempfehlungen und Leistung
- Die PISA-Studie
- Chancengleichheit in der Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem Thema der Bildungschancen und ihrer Abhängigkeit von der sozialen Herkunft in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von sozialer Ungleichheit und den Mechanismen, die dazu beitragen, dass Bildungschancen nicht für alle Menschen gleichermaßen zugänglich sind.
- Soziale Ungleichheit im Bildungssystem
- Der Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungserfolg
- Kapitalsorten nach Bourdieu und ihre Auswirkungen
- Die Rolle von Übergangsempfehlungen und Leistung in der Schule
- Kritik an der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel beginnt mit der Definition von sozialer Gleichheit und Ungleichheit, wobei der Schwerpunkt auf der sozialen Gleichheit liegt. Es wird erläutert, wie Bildung als Ressource eine wichtige Rolle im Bildungssystem spielt.
- Der Reproduktionsansatz nach Bourdieu wird vorgestellt, der den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Einstellung zur Bildung und den schulischen Erfolg beleuchtet. Die Rolle des Habitus und der Statusreproduktion wird dabei hervorgehoben.
- Bourdieus Kapitalsorten werden definiert: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital (inkorporiert, objektiviert, institutionalisiert) und soziales Kapital. Der Essay erläutert, wie diese Kapitalsorten ineinandergreifen und welche Bedeutung sie für den Bildungsweg von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten haben.
- Es wird ein Zusammenhang zwischen Übergangsempfehlungen und der real erbrachten Leistung von SchülerInnen aufgezeigt, der aufzeigt, wie stark die soziale Herkunft den Bildungserfolg beeinflusst. Kinder aus höheren Schichten erhalten bei gleicher Leistung häufiger eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus unteren Schichten.
- Die PISA-Studie und die Ergebnisse der internationalen Vergleichbarkeit werden vorgestellt, die belegen, dass der Bildungserfolg nicht nur von schulischen Leistungen, sondern auch von der sozialen Herkunft der SchülerInnen abhängt. Die Studie zeigt auch die Bedeutung des sozioökonomischen Status und des kulturellen Kapitals auf.
- Abschließend wird die Chancengleichheit im Bildungssystem kritisch beleuchtet. Es wird deutlich, dass die Schule Unterschiede in den Kompetenzen von SchülerInnen nicht ausgleicht, sondern sie sogar noch verstärkt. Die Schere zwischen den unterschiedlichen sozialen Schichten geht durch ungleiche Bildungschancen immer weiter auseinander.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungschancen, soziale Herkunft, Reproduktionsansatz, Bourdieu, Kapitalsorten, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, Übergangsempfehlungen, Leistung, PISA-Studie, Chancengleichheit, Bildungssystem
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Bildungschancen und die soziale Herkunft. Über die Chancengleichheit in der Bundesrepublik Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311496