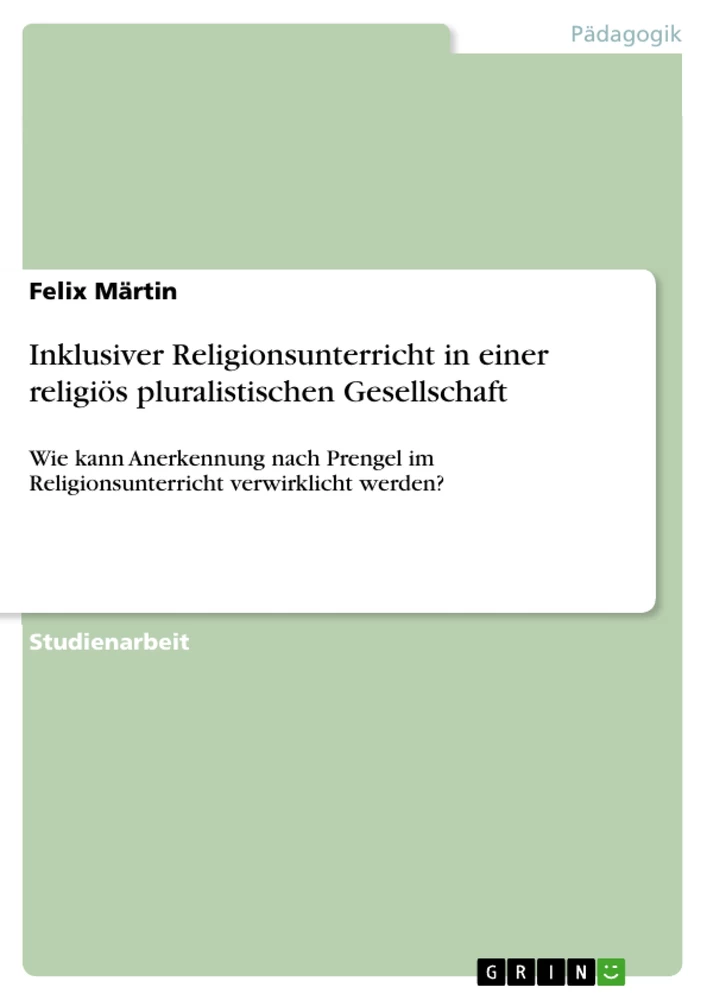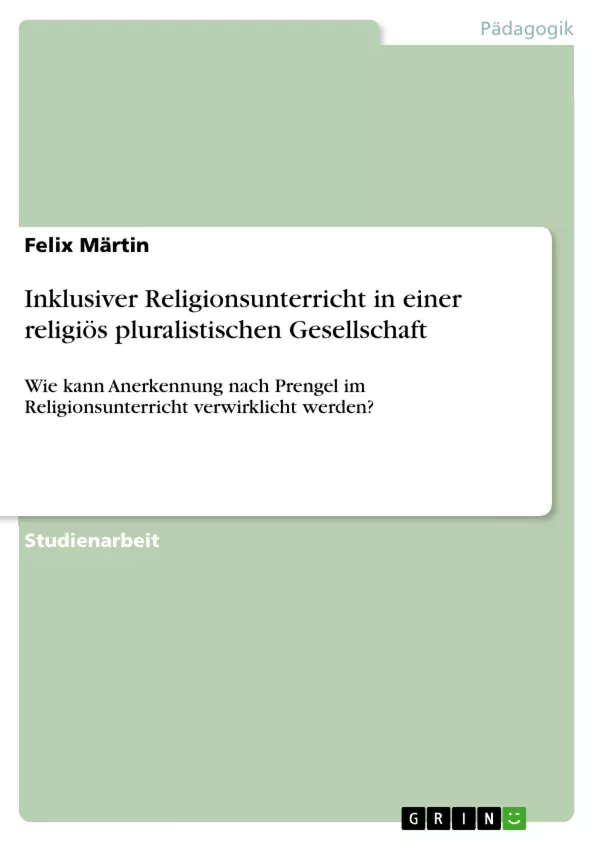Vor dem Hintergrund einer sich im Sinne zunehmender Multikulturalität und -Religiosität wandelnden Gesellschaft ist die Erwartung gegenüber einer Weiterentwicklung religiöser Bildung hin zu einer interreligiösen Bildung weit verbreitet und bezieht sich sowohl auf das Schulfach Religion als auch auf jegliche anderen Formen religiöser Bildung. Die heutigen Vorrausetzungen verweisen auf die neue pädagogische Aufgabe, die herkömmliche Bildung und Erziehung, die sich nur auf die der eigenen Herkunft entsprechenden Religion bezieht, zu erweitern. Neben den zunehmenden Pluralisierungstendenzen ist auch aus (religions-)pädagogischer Sicht ein gemeinsames Lernen unausweichlich. Es sei unerlässlich, den Umgang mit der Andersartigkeit des Anderen zu erlernen und eine grenzübergreifende Verständigung einzuüben.
Obwohl Schulklassen eine sehr große Vielfalt der Schüler*innen aufweisen, versuchen Schulen diese Verschiedenheit oftmals zu verringern. In Anlehnung an Prengel muss in der Schule im Gegensatz zur gesellschaftlich-kulturellen Vielfalt weiterhin von einer „Monokultur“ gesprochen werden. An Regelschulen hat der Unterricht oftmals den Charakter einer Mittelschichtinstitution, die auf weiße, mitteleuropäische Schüler*innen zugeschnitten ist. Der konfessionelle Religionsunterricht hat sich in seiner Vergangenheit dieser Praxis ohne Einschränkung angeschlossen.
Mit diesem Einstieg darüber, wie in einer pluralistischen Gesellschaft ein Leitbild religiöser Erziehung begründet wird, ist der Religionsunterricht an der Schule ein interessantes Studienobjekt für die Frage, wie Schule unter Berücksichtigung einer Pädagogik der Vielfalt religiöser Pluralität begegnen sollte. Um dieser Frage nachzugehen, soll im Anschluss an die Einleitung das Konzept der Pädagogik der Vielfalt (PdV) nach der Erziehungswissenschaftlerin Annedore Prengel vorgestellt werden. Im Folgenden werden zwei Interreligiöse Bildungsansätze vorgestellt, bevor dann im zweiten Hauptteil beurteilt werden soll, ob die Gedanken des neueren Konzepts der „Kultur- und Religionssensiblen Bildung“ den Kerngedanken der PdV Rechnung tragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönlicher Bezug und Relevanz des Themas – Problemskizze
- Religionsunterricht in Deutschland
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- Kirchliche & schulische Rahmenbedingungen
- Fragestellung & Vorgehensweise
- Der Weg zu einem inklusiven Religionsunterricht
- Anerkennung nach Annedore Prengel – Pädagogik der Vielfalt
- Inklusive und interkulturelle Pädagogik
- Was ist Vielfalt? - Gleichheit und Verschiedenheit
- Kernpunkte der PdV
- Voraussetzung von PdV
- Interkulturelle und interreligiöse Bildungsansätze
- Hamburg: Religionsunterricht für alle
- Baden-Württemberg: konfessionell-kooperativer Religionsunterricht
- Zwischenfazit
- Kultur- und religionssensible Bildung (KuRs.B)
- Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Anerkennung im Religionsunterricht im Sinne von Annedore Prengels verwirklicht werden kann. Dabei wird der Fokus auf die Herausforderungen und Chancen eines inklusiven Religionsunterrichts in einer religiös pluralistischen Gesellschaft gelegt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene pädagogische Konzepte und Ansätze, die zur Verwirklichung einer inklusiven und interkulturellen Lernumgebung beitragen können.
- Anerkennung von Vielfalt und Differenz im Religionsunterricht
- Konzepte der Inklusion und interkulturellen Pädagogik im Kontext des Religionsunterrichts
- Der Beitrag des Religionsunterrichts zur Förderung von Toleranz, Respekt und Dialogfähigkeit
- Interreligiöse Bildungsansätze in Deutschland und ihre Implikationen für den Religionsunterricht
- Die Rolle des Religionsunterrichts in einer pluralen Gesellschaft und seine Bedeutung für die Identitätsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den persönlichen Bezug und die Relevanz des Themas dar. Es wird die Problematik der Anerkennung von Vielfalt und Differenz im Religionsunterricht beleuchtet und die Notwendigkeit eines inklusiven Ansatzes in einer pluralistischen Gesellschaft hervorgehoben.
- Kapitel 1 gibt einen Überblick über die gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen des Religionsunterrichts in Deutschland. Es wird die Bedeutung des Religionsunterrichts für die Gestaltung eines friedlichen und toleranten Gemeinwesens hervorgehoben und die Herausforderungen im Kontext zunehmender Pluralisierung und Konfessionslosigkeit thematisiert.
- Kapitel 2 widmet sich dem Konzept der Pädagogik der Vielfalt nach Annedore Prengel. Es werden die zentralen Elemente der Pädagogik der Vielfalt erläutert und deren Bedeutung für die Gestaltung eines inklusiven und interkulturellen Religionsunterrichts beleuchtet. Es werden verschiedene interkulturelle und interreligiöse Bildungsansätze in Deutschland vorgestellt.
- Kapitel 3 beschreibt den Ansatz der Kultur- und religionssensiblen Bildung (KuRs.B) und dessen Relevanz für den Religionsunterricht.
Schlüsselwörter
Inklusiver Religionsunterricht, Pädagogik der Vielfalt, Annedore Prengel, Anerkennung, Vielfalt, Differenz, Interkulturelle Pädagogik, Interreligiöse Bildung, Pluralistische Gesellschaft, Dialogfähigkeit, Toleranz, Respekt, Kultur- und religionssensible Bildung (KuRs.B)
- Citation du texte
- Felix Märtin (Auteur), 2022, Inklusiver Religionsunterricht in einer religiös pluralistischen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1310105