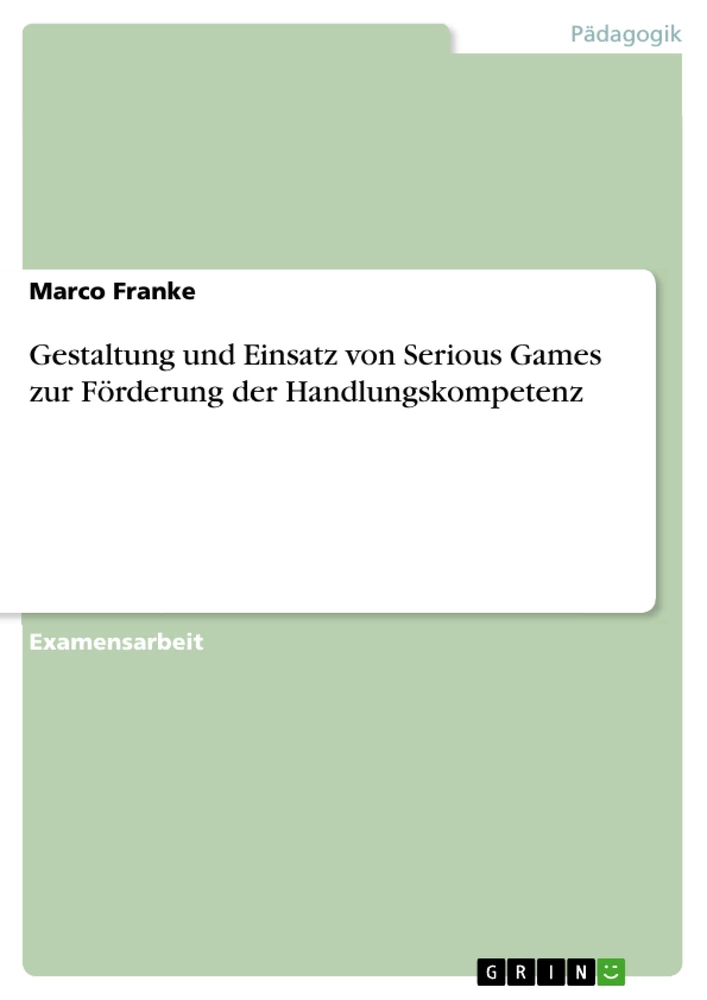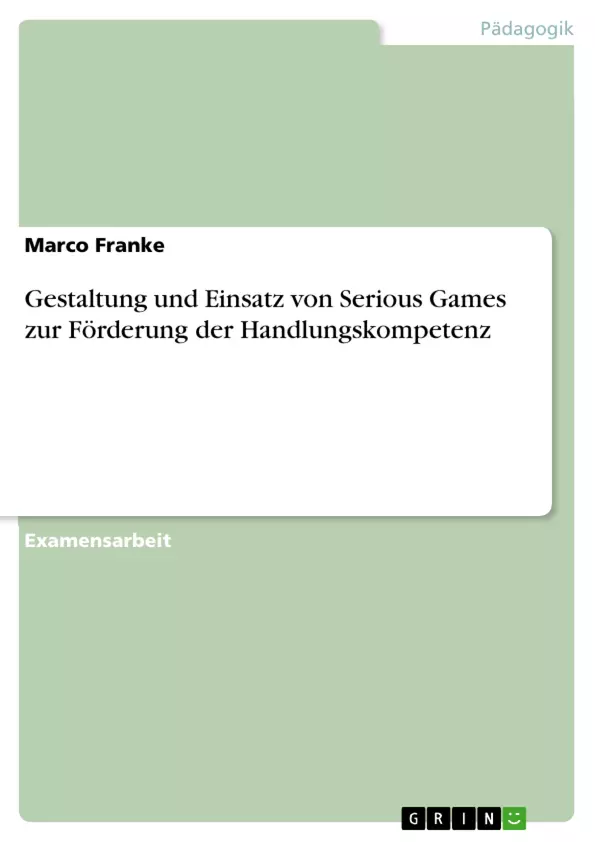Das immense Wachstum der Nutzung von Computerspielen in den vergangenen Jahren führte unter anderem zu einer starken Zentrierung des Interesses in den Bereichen der Erziehungswissenschaften. Einer der Gründe dafür ist das auffallende Motivationspotential, das von Computerspielen ausgeht. Neben diesem Effekt wird darüber diskutiert, ob und wie Computerspiele Schülern dabei helfen können vorhandene Kompetenzen zu trainieren und damit einhergehend zu verbessern. Die Ausbildung von neuen Kompetenzen ist dabei ein weiteres Anliegen der Erziehungswissenschaften. Der genaue Blick auf das Computernutzungsverhalten von Kindern und Jungendlichen zeigt, dass bereits 97 Prozent der 12- bis 19-Jährigen (unabhängig vom Bildungsstand und Geschlecht) sich privat mindestens einmal im Monat selbstständig mit dem Medium Computer beschäftigen (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest, 2008, S. 35). Dieser Anteil ist in den letzten Jahren unverändert, es kommt jedoch zu deutlichen Zuwächsen bei der Nutzungsfrequenz. Dabei wird der Computer vornehmlich für schulische Zwecke verwendet. Computerspiele folgen jedoch im kurzen Abstand auf Platz zwei (ebd., S. 37). Dies belegt die enorme Anziehungskraft dieses Medium für Kinder und Jugendliche in diesem Alter.
Trotz dieser auffälligen Tendenzen ist es notwendig zu erwähnen, dass es große individuelle Unterschiede im Spielverhalten gibt. Mädchen und Jungen unterscheiden sich z.B. im Computerspielverhalten deutlich voneinander. Während fast die Hälfte der Jungen mehrmals die Woche spielt, sind es bei Mädchen lediglich 13 Prozent (ebd. S. 38). Es sollte weiterhin darauf hingewiesen werden, dass sich neben den motivierten Computerspielern ebenso diesbezüglich desinteressierte Kinder und Jugendliche befinden, die sich in ihrer Freizeit vorrangig mit anderen Vorlieben auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung/Problemstellung
- Das Spiel
- Definition
- Kategorisierung von Spielen
- Aktualität des Themas: Lernpotentiale von Computerspielen
- Definition und historischer Wandel der Serious Games
- Der Beginn der Serious Games: nicht-technologische Spielvarianten
- Begriffsneuordnung
- Serious Games – eigenständiges Genre?
- Abgrenzung zu verwandter Software
- Zwischenfazit: Sind Serious Games eigentlich Spiele?
- Abschließende Begriffsklärung (Serious Games als eigenständiges Genre?)
- Lernziele und Kompetenzentwicklung durch den Einsatz von Serious Games
- Bildungserzieherische Serious Games
- Serious Games des Militärs
- Unterhaltungsspiele
- Serious Games der Wirtschaft/ des Managements
- Politische Serious Games
- Serious Games des Gesundheitswesens
- Fazit der Lernziele und Kompetenzentwicklungsprozesse von Serious Games
- Handlungskompetenz
- Die gegenwärtige Situation der Unterrichtsmethoden in der Schule und die aktuelle didaktische Diskussion
- Der handlungsorientierte Unterricht
- Der Prozess der Erlernung von Handlungskompetenz
- Zwischenfazit: Eignen sich Serious Games für die Erlangung von Handlungskompetenz?
- Motivation und Transfer
- Motivation
- Definition von Motivation und ihre Erscheinungsweisen
- Motivation beim Spielen: das „flow-Erlebnis“ und die „Self-determination theory“
- Das „flow-Erlebnis“
- Die „Self-determination theory“
- Transfer-Effekte
- Begriffsklärung und Bedeutsamkeit von Transfer-Effekten
- Transfer-Effekte durch Computerspiele
- Bewertung ausgewählter Serious Games
- „Dr. Kawashimas Gehirnjogging“
- „America's Army“
- „September 12th“
- „Geograficus“
- Ausblick (Lernen durch Spieledesigning)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Potential von Serious Games zur Förderung der Handlungskompetenz im schulischen Kontext. Sie analysiert, ob und wie Serious Games Lernziele unterstützen und Kompetenzen verbessern können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Motivation und dem Transfer von im Spiel erworbenen Fähigkeiten in reale Situationen.
- Definition und Einordnung von Serious Games
- Analyse der Lernziele und Kompetenzentwicklung durch Serious Games
- Bedeutung von Handlungskompetenz im Unterricht
- Motivation und Transfer von Lernerfahrungen aus Serious Games
- Bewertung ausgewählter Serious Games
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung/Problemstellung: Die Einleitung beleuchtet das rapide Wachstum der Computerspielnutzung und die damit verbundene Frage nach deren didaktischem Potenzial. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung von Serious Games zur Förderung der Handlungskompetenz und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Definition des Spielbegriffs über die Analyse von Serious Games bis hin zur Bewertung ausgewählter Beispiele reicht. Der hohe Anteil von Jugendlichen, die Computerspiele nutzen, wird hervorgehoben, ebenso wie die Notwendigkeit, individuelle Unterschiede im Spielverhalten zu berücksichtigen. Die Arbeit konzentriert sich auf Serious Games, um zu analysieren, wie diese Lernziele unterstützen und Kompetenzen verbessern können.
Das Spiel: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Auseinandersetzung mit Serious Games, indem es den Begriff „Spiel“ definiert und verschiedene Spielkategorien erläutert. Es wird untersucht, welche Faktoren ein Spiel charakterisieren und in welchen Formen das Spielen möglich ist. Dies dient als Grundlage für die spätere Einordnung von Serious Games und die Beantwortung der Frage, ob Serious Games den Kriterien eines Spiels entsprechen.
Definition und historischer Wandel der Serious Games: Hier wird der Begriff „Serious Games“ definiert und seine Entwicklung historisch nachgezeichnet, beginnend mit nicht-technologischen Spielvarianten. Es wird die Begriffsbildung und die Abgrenzung zu anderen Softwareformen beleuchtet, um ein klares Verständnis für das Genre zu schaffen. Die Frage nach der Eigenständigkeit von Serious Games als Genre steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Serious Games – eigenständiges Genre?: Dieses Kapitel vertieft die Abgrenzung von Serious Games zu verwandten Softwareformen und diskutiert kritisch, ob Serious Games die Kriterien eines Spiels erfüllen und somit als eigenständiges Genre betrachtet werden können. Es fasst die vorangegangenen Überlegungen zusammen und liefert eine abschließende Begriffsklärung.
Lernziele und Kompetenzentwicklung durch den Einsatz von Serious Games: In diesem Kapitel werden die Lernziele und Kompetenzentwicklungsprozesse von Serious Games in verschiedenen Bereichen (Bildung, Militär, Wirtschaft, Politik, Gesundheit) analysiert. Es wird untersucht, wie Serious Games zur Erreichung spezifischer Lernziele eingesetzt werden und welche Kompetenzen sie fördern können. Das Kapitel endet mit einem Fazit zu den Lernzielen und Kompetenzentwicklungsprozessen von Serious Games.
Handlungskompetenz: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Begriff der Handlungskompetenz. Es analysiert die aktuelle Situation des Unterrichts und die didaktische Diskussion um handlungsorientierten Unterricht. Der Prozess der Erlernung von Handlungskompetenz wird erläutert, und es wird die Frage diskutiert, inwieweit sich Serious Games zur Erlangung von Handlungskompetenz eignen. Schließlich werden die zentralen Aspekte Motivation und Transfer im Kontext von Serious Games betrachtet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Serious Games und Handlungskompetenz"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Potenzial von Serious Games zur Förderung der Handlungskompetenz im schulischen Kontext. Sie analysiert, ob und wie Serious Games Lernziele unterstützen und Kompetenzen verbessern können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Motivation und dem Transfer von im Spiel erworbenen Fähigkeiten in reale Situationen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Einordnung von Serious Games; Analyse der Lernziele und Kompetenzentwicklung durch Serious Games; Bedeutung von Handlungskompetenz im Unterricht; Motivation und Transfer von Lernerfahrungen aus Serious Games; Bewertung ausgewählter Serious Games.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und Problemstellung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgen Kapitel zur Definition von "Spiel", zur Definition und zum historischen Wandel von Serious Games, zur Abgrenzung von Serious Games als eigenständiges Genre, zur Analyse von Lernzielen und Kompetenzentwicklung durch Serious Games, zur Handlungskompetenz (inkl. Motivation und Transfer), und schließlich zur Bewertung ausgewählter Serious Games. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick.
Was wird unter "Serious Games" verstanden?
Der Begriff "Serious Games" wird definiert und seine historische Entwicklung nachgezeichnet. Es wird die Abgrenzung zu anderen Softwareformen diskutiert und die Frage nach der Eigenständigkeit von Serious Games als Genre kritisch beleuchtet.
Welche Lernziele und Kompetenzen werden durch Serious Games gefördert?
Die Arbeit analysiert die Lernziele und Kompetenzentwicklungsprozesse von Serious Games in verschiedenen Bereichen (Bildung, Militär, Wirtschaft, Politik, Gesundheit). Es wird untersucht, wie Serious Games zur Erreichung spezifischer Lernziele eingesetzt werden und welche Kompetenzen sie fördern können.
Welche Rolle spielt Handlungskompetenz?
Die Arbeit befasst sich ausführlich mit dem Begriff der Handlungskompetenz, analysiert die aktuelle Situation des Unterrichts und die didaktische Diskussion um handlungsorientierten Unterricht. Es wird untersucht, inwieweit sich Serious Games zur Erlangung von Handlungskompetenz eignen.
Wie werden Motivation und Transfer im Kontext von Serious Games betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Motivation beim Spielen (z.B. "flow-Erlebnis", "Self-determination theory") und untersucht die Transfer-Effekte von im Spiel erworbenen Fähigkeiten in reale Situationen.
Welche Serious Games werden bewertet?
Die Arbeit bewertet ausgewählte Serious Games wie "Dr. Kawashimas Gehirnjogging", "America's Army", "September 12th" und "Geograficus".
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Eignen sich Serious Games zur Förderung der Handlungskompetenz im schulischen Kontext?
Gibt es einen Ausblick?
Ja, die Arbeit schließt mit einem Ausblick, der sich unter anderem mit dem Lernen durch Spieledesigning auseinandersetzt.
- Citar trabajo
- Marco Franke (Autor), 2009, Gestaltung und Einsatz von Serious Games zur Förderung der Handlungskompetenz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131005