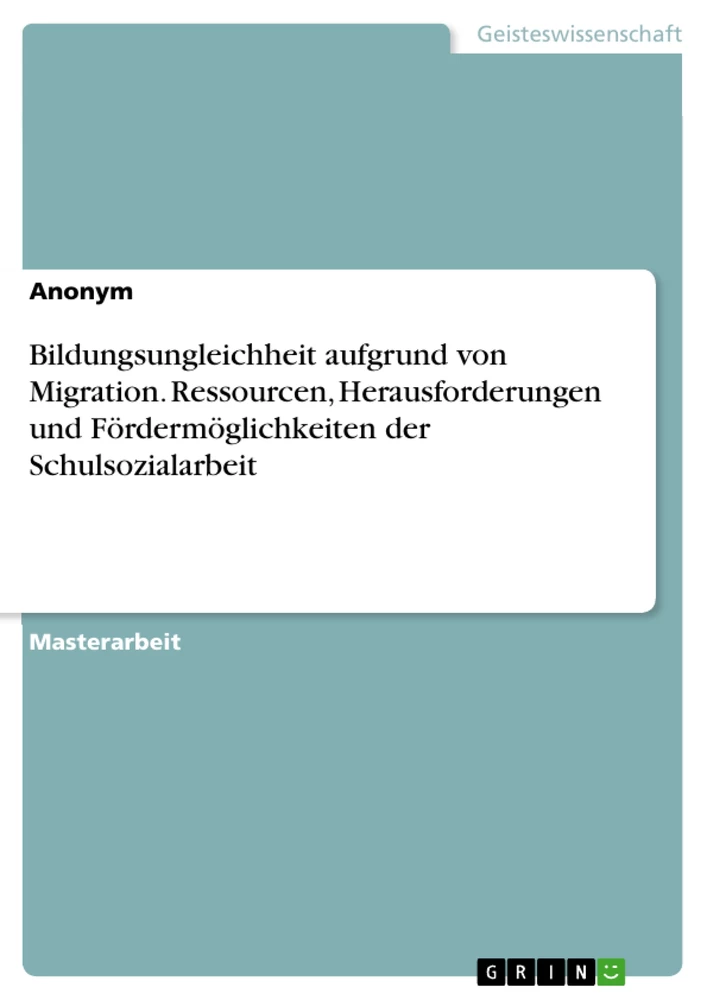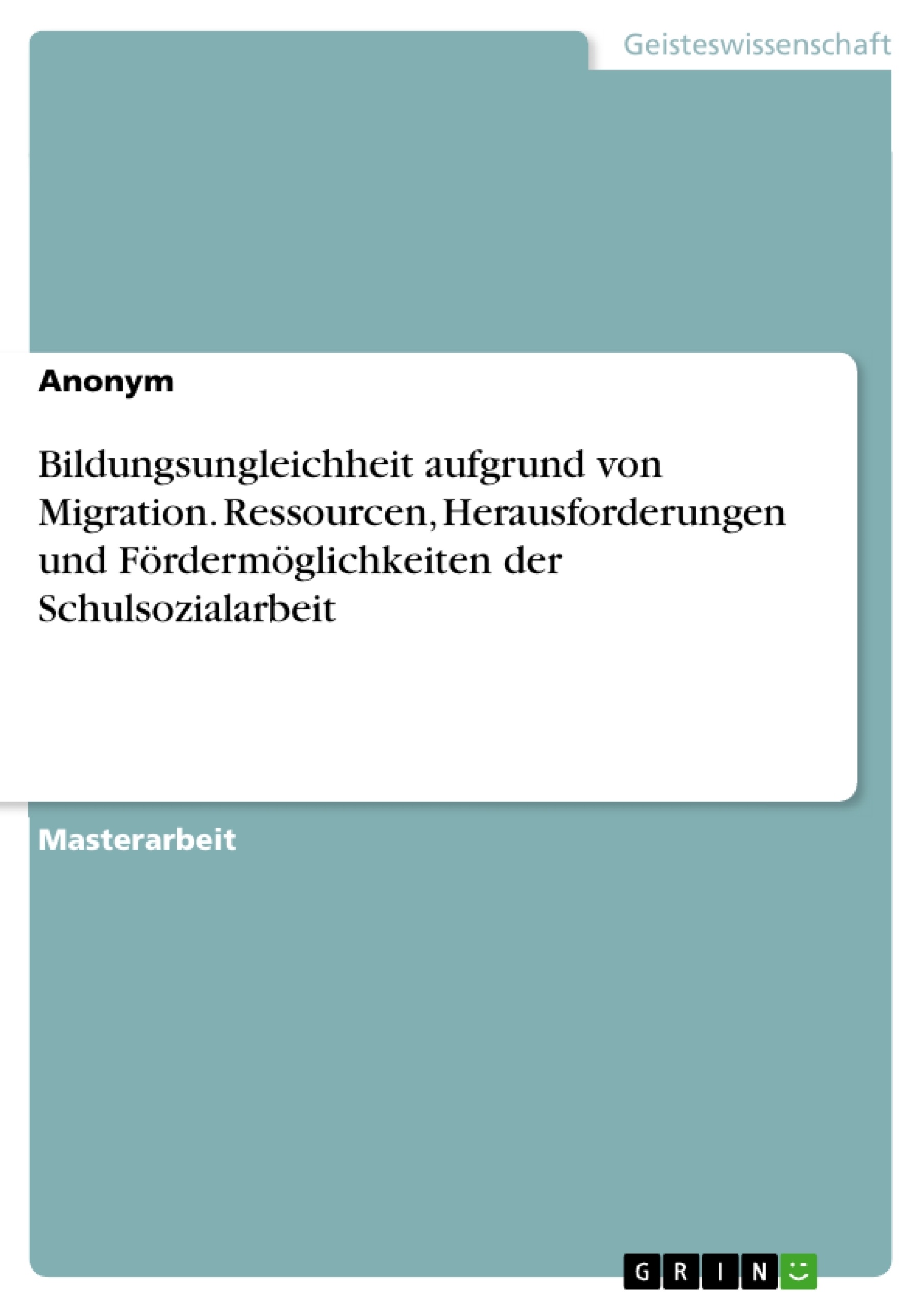Die Arbeit setzt sich mit dem Thema Bildungsungleichheit aufgrund von Migration auseinander. Das Phänomen Migration als Herausforderung für die schulische Bildung nimmt an Aktualität nicht ab und hat somit einen großen Stellenwert in der Pädagogik sowie im schulischen Alltag inne. Faktoren wie ungünstige wirtschaftliche Veränderungen, soziale Bedingungen oder Kriege bewegen Menschen dazu, aus ihren Heimatländern zu fliehen, um ein besseres Leben führen zu können. Diese Menschen müssen durch das Aufnahmeland integriert werden, was durch Einbürgerung, soziale Sicherung oder auch mit dem Zugang zum Bildungs- und Arbeitsmarkt geschehen kann.
Wichtig für die jungen Menschen, Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter ist, dass sie Zugang zum Bildungssystem erhalten, um die nötigen Kompetenzen zu erwerben, die sie auf ein Leben in der Gesellschaft und ein weiteres Lernen in Ausbildung bzw. Beruf vorbereiten und somit Anschluss in der Gesellschaft zu finden.
Das Interesse, sich mit der Verbindung von Migration und Bildung zu beschäftigen, ist mit meiner persönlichen Lebens- und Berufserfahrung durch die sozialpädagogische Arbeit im Kontext Schule und Beruf begründet. In der täglichen Arbeit sind wir mit vielfältigen Fragestellungen, Aufgaben und Problemlagen von Menschen unterschiedlicher Herkunft konfrontiert, die eine besondere Sensibilität im Zusammenhang mit schulischem Erfolg und Bildungschancen erfordern.
Die verlangte Integration in die bestehende Gesellschaft, Probleme bei der persönlichen Identitätsfindung oder Sozialisationsprobleme in der Schule stellen diese jungen Menschen immer wieder vor große Herausforderungen. Jeder Mensch verfügt in seiner Einzigartigkeit über individuelle Erfahrungen des Lebens und seiner Kultur, die (in einem neuen Land mit seinen spezifischen Gesellschaftsstrukturen) bereichernd wirken können und Bildungschancen bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung + Fragestellung
- 2 Migration
- 2.1 Definition Migration
- 2.2 Tendenz der demographischen Entwicklung der Migration in Deutschland
- 2.3 Rechtliche Grundlagen am Beispiel von Fluchtmigration
- 2.4 Motive und Hintergründe der Migration
- 2.5 Phasen der Migration
- 3 Theoretische Erklärungsansätze nach Hans Thiersch und Pierre Bourdieu
- 3.1 Entstehung der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch
- 3.1.2 Konzept der Lebensweltorientierung nach Thiersch
- 3.1.3 Das Selbstverständnis der Lebensweltorientierung und ihre Handlungsmaxime
- 3.1.4 Kritik in Bezug auf Lebensweltorientierung
- 3.1.5 Auswirkungen der Migration auf die Lebenswelten der Betroffenen
- 3.1.6 Theoretische Grundlage - Ein Ansatz nach
- 3.2 Der theoretische Erklärungsansatz für Bildungsdisparitäten nach Pierre Bourdieu
- 3.2.1 Der Habitus
- 3.2.2 Der Kapitalbegriff
- 3.2.2 Ökonomisches Kapital
- 3.2.3 Soziales Kapital
- 3.2.4 Kulturelles Kapital
- 3.2.5 Das symbolische Kapital
- 3.3 Milieuanalyse und Bildungsungleichheiten
- 3.4 Der Habitus zwischen sozialer Position und Bildungserfolg (Riegel)
- 4 Bildungsungleichheit
- 4.1 Bildungsungleichheiten durch mangelnde Chancengerechtigkeit?
- 4.2 Chancengleichheit & Chancengerechtigkeit
- 4.2.1 Chancengleichheit als Disziplinierung
- 4.2.2 Chancengleichheit als Illusion?
- 5 Schichtenspezifische Bildungsungleichheit im deutschen Bildungssystem
- 5.1 Bildungsungleichheiten in der Kindertagesstätte
- 5.2 Bildungsungleichheit in der Grundschule
- 5.3 Bildungsungleichheit in der Sekundarstufe
- 5.4 Soziale Auslese durch das Schulsystem
- 5.5 Bildungsungleichheit im Übergang von der Schule in Ausbildung
- 6 Die Ressource Schulsozialarbeit für die Lebensbewältigung der Schüler
- 6.1 Historische Entwicklung der Schulsozialarbeit
- 6.2 Zum Auftrag der Schulsozialarbeit
- 6.3 Der Bildungsbegriff in der Schulsozialarbeit
- 6.4 Begründung und Relevanz lebensweltorientierter Schulsozialarbeit im Lebensraum Schule
- 6.4.1 Relevante Strukturmaximen lebensweltorientierter Schulsozialarbeit
- 6.4.2 Chancen und Grenzen der Einflussnahme lebensweltorientierter Schulsozialarbeit angesichts einer lebensweltorientierte Schulentwicklung
- 6.4.3 Herausforderungen lebensweltorientierter Schulsozialarbeit
- 7 Aktuelle Herausforderungen – Schulsozialarbeit im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklungen
- 7.1 Herausforderungen für die pädagogische Praxis am Lernort Schule
- 7.2 Diversität und Heterogenität im Kontext Schule
- 7.3 Heterogenitätskategorie "Schulische Leistungen"
- 7.4 Bourdieu Magnetfeld Schule
- 7.5 Mögliche Strategien für den Abbau von Bildungsbenachteiligung
- 7.5.1 Gelingende Integration ins Schulsystem
- 7.5.2 Kooperationen innerhalb multiprofessioneller Teams
- 7.5.3 Was bedeutet multiprofessionelles Arbeiten im Magnetfeld Schulsozialarbeit?
- 7.5.4 Interkulturelle Sensibilität als Bestandteil pädagogischer Grundhaltung
- 8 Individuelle Fördermöglichkeiten zur Verminderung von Bildungsungleichheit
- 8.1 Lesekompetenzförderung
- 8.2 Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
- 8.3 Bildungsaspirationen und Erwartungen der Eltern sowie Jugendlichen
- 9 Interkulturelle Schulentwicklung in der Migrationsgesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis befasst sich mit der Thematik der Bildungsungleichheit im Bildungssystem aufgrund von Migration. Ziel ist es, die Ursachen für migrationsbezogene Bildungsbenachteiligung zu analysieren und zu verstehen, wie diese die Bildungswege von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beeinflussen. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung, den Ursachen und den Auswirkungen von Bildungsungleichheit im Kontext von Migration.
- Definition und Einfluss von Migration auf das deutsche Bildungssystem
- Theoretische Erklärungsansätze für Bildungsungleichheiten im Kontext von Migration
- Analyse von Bildungsungleichheit in verschiedenen Bildungsphasen
- Rolle der Schulsozialarbeit bei der Bewältigung von Bildungsungleichheit
- Mögliche Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Bildungsungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Bildungsungleichheit im Kontext von Migration. Sie definiert den Begriff Migration und untersucht die demographische Entwicklung sowie die rechtlichen Grundlagen der Migration in Deutschland. Das Kapitel analysiert die Motive und Hintergründe der Migration und beleuchtet die Phasen des Migrationsprozesses.
Im Anschluss werden zwei theoretische Erklärungsansätze für Bildungsungleichheiten im Kontext von Migration vorgestellt: Der Ansatz von Hans Thiersch und der von Pierre Bourdieu. Die Arbeit untersucht das Konzept der Lebensweltorientierung nach Thiersch, die Rolle des Habitus und des Kapitals nach Bourdieu sowie deren Auswirkungen auf Bildungsungleichheiten.
Die Arbeit befasst sich mit der Bildungsungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere mit den Ursachen und Auswirkungen auf unterschiedlichen Bildungsstufen.
Die Arbeit widmet ein Kapitel der Schulsozialarbeit. Sie untersucht die historische Entwicklung, den Auftrag und die Bedeutung der Schulsozialarbeit in Bezug auf die Bewältigung von Bildungsungleichheit.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Migration, Lebensweltorientierung, Habitus, Kapital, Schulsozialarbeit, Chancengleichheit, Integration, Interkulturelle Schulentwicklung, Bildungsaspirationen, Bildungs- und Teilhabepaket.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Bildungsungleichheit aufgrund von Migration. Ressourcen, Herausforderungen und Fördermöglichkeiten der Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309919