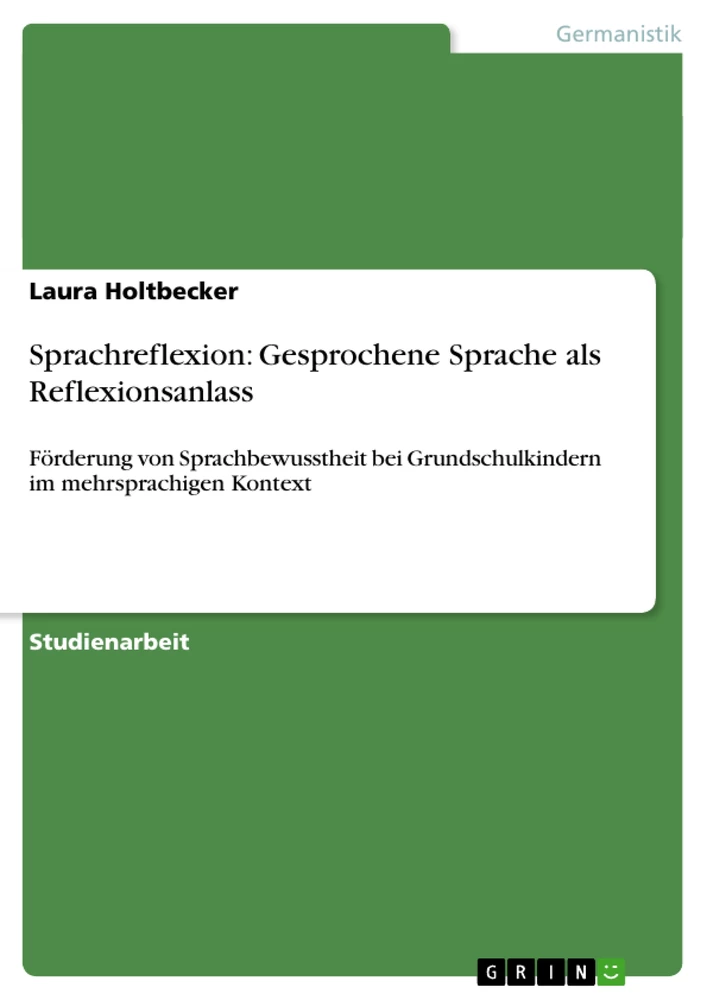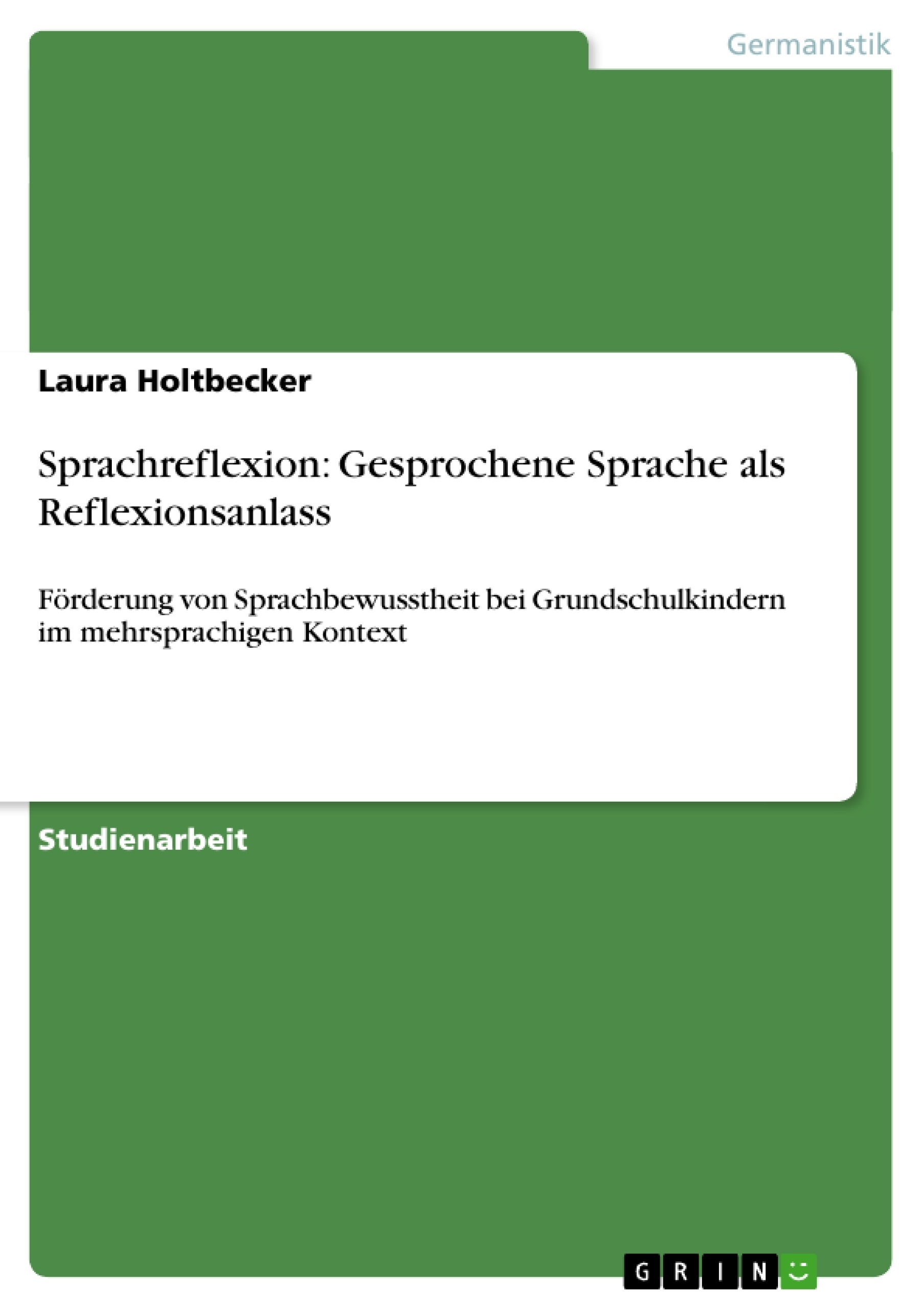Diese Arbeit soll eine Begründung dafür liefern, warum und wie Mehrsprachigkeit in den Schulklassen der Grundschule genutzt werden kann, damit sowohl monolinguale als auch bilinguale Schüler ihre Sprachbewusstheit erweitern können, indem sie sich gegenseitig unterstützen. Dabei sollen die Muttersprachen der Migrantenkinder aufgegriffen werden, um die zweisprachigen Kinder als Experten in den Unterricht einzubeziehen und damit den Einsprachigen den Horizont von Sprachgebrauch zu erweitern. Diese Erörterung äußerer Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht soll ein aktuelles Thema der heutigen oft multikulturellen Klassen aufgreifen. Da jedoch auch einsprachig aufgewachsene Kinder Vorkenntnisse zur Mehrsprachigkeit aufweisen, werde ich ebenfalls auf die Erscheinungsformen des Deutschen eingehen, da diese oft erst bewusst gemacht werden müssen, denn selbst ein deutscher monolingualer Erwachsener spricht an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Personen immer wieder eine andere Sprache – in diesem Fall Varietäten des Deutschen. Diese Flexibilität macht den Erwachsenen aus. Die Kinder müssen sich diese Fähigkeit allerdings erst aneignen.
Die Auseinandersetzung mit der äußeren Mehrsprachigkeit, also mit Sprachen anderer Nationen, und der inneren Mehrsprachigkeit, also den Varietäten des Deutschen, soll zum einen die Sprachbewusstheit hinsichtlich des Sprachgebrauchs prägen und zum andern die Ressourcen in einer Klasse ausschöpfen und nutzen. So merken bilinguale bzw. dialektal geprägte Kinder, dass man Interesse an ihrer Sprechweise zeigt und entwickeln so (möglicherweise) einen höheren Motivationsgrad, die deutsche Standardsprache zu perfektionieren. Dazu bietet sich das Konzept der Sprachreflexion an, welches zu allererst dem traditionellen Grammatikunterricht gegenübergestellt werden soll, um zu begründen, wie wichtig es ist, den Schülern nicht nur strukturiertes Wissen zu liefern, sondern auch ein gewisses Sprachgefühl zu erlangen. Oft ist es nämlich so, dass die Kinder über eine sehr ausgiebige Sprachbewusstheit verfügen, die ihnen aber erst bewusst gemacht werden muss. Warum aber die Sprachreflexion bzw. die Reflexion über Sprache und nicht der traditionelle Grammatikunterricht diese so genannte Sprachbewusstheit herstellen kann, soll im Folgenden erläutern werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gegenwärtige Situation von Sprachreflexion in der Grundschule
- Probleme des traditionellen Grammatikunterrichts
- Kontrafaktisches Grundschulwissen
- Der Reformansatz „Reflexion über Sprache"
- Probleme des traditionellen Grammatikunterrichts
- Sprachunterricht im mehrsprachigen Kontext
- Förderung von Sprachbewusstheit bei Grundschulkindern im mehrsprachigen Kontext
- Formen der Mehrsprachigkeit
- Äußere Mehrsprachigkeit
- Innere Mehrsprachigkeit
- Sprachen sichtbar machen und besser wahrnehmen
- Sprachen nutzen und reflektieren
- Formen der Mehrsprachigkeit
- Mehrsprachigkeit als Chance für den Deutschunterricht der Grundschule?
- Förderung von Sprachbewusstheit bei Grundschulkindern im mehrsprachigen Kontext
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten, Mehrsprachigkeit im Grundschulunterricht zu nutzen, um sowohl monolinguale als auch bilinguale Schüler in ihrer Sprachbewusstheit zu fördern. Dabei soll die Muttersprache von Migrantenkindern als Ressource genutzt werden, um zweisprachige Kinder als Experten einzubeziehen und den einsprachigen Schülern den Horizont des Sprachgebrauchs zu erweitern. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Sprachreflexion im Vergleich zum traditionellen Grammatikunterricht und argumentiert, dass die Reflexion über Sprache ein tieferes Sprachverständnis und Sprachgefühl bei Schülern fördert.
- Förderung der Sprachbewusstheit bei Grundschulkindern im mehrsprachigen Kontext
- Die Rolle der Muttersprache im Deutschunterricht
- Der Vergleich zwischen traditionellem Grammatikunterricht und Sprachreflexion
- Die Bedeutung von Sprachgefühl und Sprachbewusstsein
- Die Nutzung von Mehrsprachigkeit als Chance für den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung, Mehrsprachigkeit im Grundschulunterricht zu nutzen, um die Sprachbewusstheit aller Schüler zu fördern. Dabei wird die Bedeutung der Muttersprache von Migrantenkindern und die Notwendigkeit, diese als Ressource zu nutzen, hervorgehoben. Die Arbeit argumentiert, dass die Sprachreflexion im Vergleich zum traditionellen Grammatikunterricht ein tieferes Sprachverständnis und Sprachgefühl bei Schülern fördert.
Das zweite Kapitel analysiert die aktuelle Situation des Sprachreflexions- und Grammatikunterrichts in der Grundschule. Es werden die Probleme des traditionellen Grammatikunterrichts aufgezeigt, wie z.B. die Abstraktheit der Regeln und die fehlende Verbindung zum alltäglichen Sprachgebrauch. Die Arbeit argumentiert, dass der traditionelle Grammatikunterricht oft zu einem entfremdeten Verhältnis zur Sprache führt und das Sprachwissen der Schüler nicht nachhaltig festigt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Sprachunterricht im mehrsprachigen Kontext. Es werden verschiedene Formen der Mehrsprachigkeit, wie z.B. äußere und innere Mehrsprachigkeit, erläutert. Die Arbeit betont die Bedeutung, die Sprachen der Schüler sichtbar zu machen und sie im Unterricht zu nutzen, um die Sprachbewusstheit aller Schüler zu fördern.
Das vierte Kapitel diskutiert die Chancen, die Mehrsprachigkeit für den Deutschunterricht der Grundschule bietet. Es wird argumentiert, dass die Nutzung der Muttersprache von Migrantenkindern und die Einbeziehung von zweisprachigen Kindern als Experten den Deutschunterricht bereichern und die Sprachbewusstheit aller Schüler fördern kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Sprachreflexion, Sprachbewusstheit, Mehrsprachigkeit, Grammatikunterricht, Deutschunterricht, Grundschule, Muttersprache, Migrantenkinder, Sprachgefühl, Sprachgebrauch, Varietäten des Deutschen.
- Quote paper
- Laura Holtbecker (Author), 2009, Sprachreflexion: Gesprochene Sprache als Reflexionsanlass, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130912