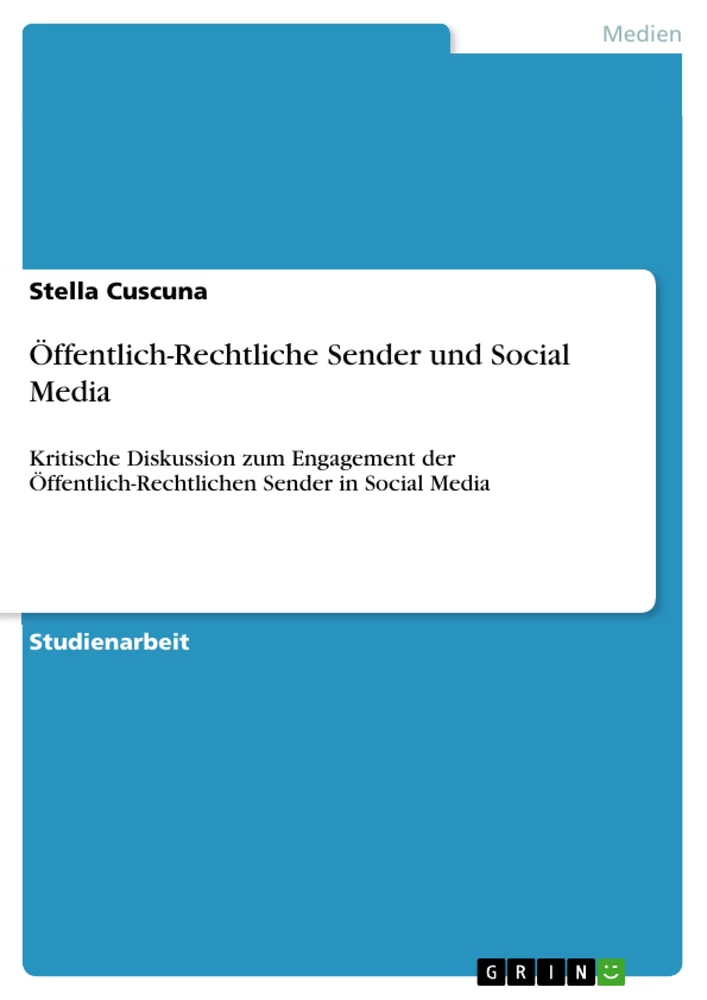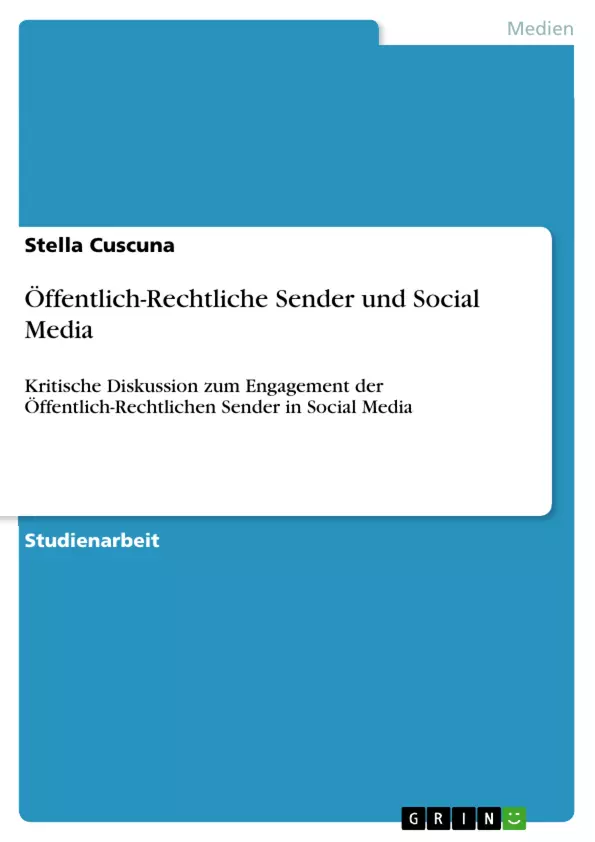Seit einigen Jahren sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht nur in vielen verschiedenen Lebenssituationen vertreten, wie beim morgendlichen Zeitungslesen oder den abendlichen Fernseh-Nachrichten schauen, sondern auch im digitalen Leben. Durch das Internet haben sich die Medien stark verändert: Statt morgens die Zeitung zu lesen, um informiert zu sein, greifen immer mehr Menschen zum Smartphone oder Laptop. Auch die abendlichen Nachrichten kann man sich mittlerweile sparen, wenn man Nachrichtenportale im Internet verfolgt. Auch die Öffentlich-Rechtlichen reagieren auf diese Umlagerung mit Online-Mediatheken, digitalen Nachrichtenportalen und so weiter.
Mit der Entwicklung von sozialen Medien verändert sich die Medienwelt erneut. Auf diesen Kanälen, bei denen jeder User Content erstellen und veröffentlichen kann, entwickeln sich mit der Zeit ebenfalls negative Effekte wie Fake-News, Hass-Posts und Propaganda. Auch hier stellt sich die ARD die Frage, ob die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt auf Social Media vertreten sein sollten, ob ein Engagement überhaupt zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gehöre und wie sie sich zwischen den ganzen Fake-News behaupten können. Ziel dieser Arbeit ist es, diese und weitere Fragen zu erörtern und ein Engagement der Öffentlich-Rechtlichen in den sozialen Medien abzuwägen. Es wird außerdem geklärt, ob diese crossmediale Verbindung Vorteile für User bringt und ob die Öffentlich-Rechtlichen dadurch nicht zu viel Macht erlangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit und Schwerpunktsetzung
- Anwendungsteil
- Kann die crossmediale Verbindung von Nutzen für die User der sozialen Netzwerke sein?
- Deckt der gesetzliche Rundfunkauftrag ein Engagement der Öffentlich-Rechtlichen bei den sozialen Netzwerken ab?
- Entsprechen die sogenannten Qualitätsstandards der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dem Bedürfnis der sozialen Medien?
- Können die Öffentlich-Rechtlichen einen Beitrag gegen Fake News, Hass-Posts, undurchsichtige Quellenlagen und Propaganda leisten?
- Erhalten die Öffentlich-Rechtlichen zu viel Macht, wenn sie sich auch noch innerhalb der sozialen Netzwerke engagieren?
- Fazit
- Wurde die Zielsetzung erreicht und kurze Betrachtung der Vorgehensweise
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Präsenz öffentlich-rechtlicher Sender in sozialen Medien. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile eines solchen Engagements abzuwägen und die Relevanz für den Rundfunkauftrag zu prüfen. Es wird analysiert, ob die crossmediale Strategie Nutzern Vorteile bietet und ob sie zu einer Machtverschiebung führen könnte.
- Nutzen der crossmedialen Verbindung für Social-Media-Nutzer
- Kompatibilität des Engagements in sozialen Medien mit dem Rundfunkauftrag
- Qualitätsstandards öffentlich-rechtlicher Sender im Kontext sozialer Medien
- Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen zur Bekämpfung von Desinformation und Hassrede
- Potenzielle Machtverschiebung durch Social-Media-Engagement
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Präsenz öffentlich-rechtlicher Sender in sozialen Medien ein. Sie beschreibt die Problemstellung, die sich aus dem Wandel der Medienlandschaft und dem Aufkommen von Desinformation in sozialen Netzwerken ergibt. Die Arbeit untersucht die Frage, ob und wie öffentlich-rechtliche Sender in diesem Kontext agieren sollten, wobei die potenziellen Vorteile und Nachteile einer crossmedialen Strategie im Fokus stehen. Die Zielsetzung ist klar definiert: Abwägung des Engagements in sozialen Medien und Analyse möglicher Auswirkungen auf Nutzer und den Rundfunkauftrag.
Anwendungsteil: Dieses Kapitel bildet den Schwerpunkt der Arbeit und befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Themas. Es werden Fragestellungen diskutiert, die den Nutzen der crossmedialen Verbindung für die Nutzer, die Vereinbarkeit mit dem Rundfunkauftrag, die Einhaltung von Qualitätsstandards in den sozialen Medien, den Beitrag zur Bekämpfung von Desinformation und die potenzielle Machtverschiebung durch das Engagement der Öffentlich-Rechtlichen in sozialen Medien betreffen. Die Kapitel analysieren kritisch die Herausforderungen und Chancen einer solchen Strategie.
Schlüsselwörter
Öffentlich-rechtliche Sender, Soziale Medien, Crossmediale Strategien, Rundfunkauftrag, Qualitätsstandards, Fake News, Hassrede, Macht, Nutzer, Digitalisierung, Algorithmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Öffentlich-rechtliche Sender in sozialen Medien
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Präsenz öffentlich-rechtlicher Sender in sozialen Medien. Sie analysiert die Vor- und Nachteile dieses Engagements und dessen Relevanz für den Rundfunkauftrag.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die Vor- und Nachteile eines Engagements öffentlich-rechtlicher Sender in sozialen Medien abwägen und die Relevanz für den Rundfunkauftrag prüfen. Es soll analysiert werden, ob die crossmediale Strategie Nutzern Vorteile bietet und ob sie zu einer Machtverschiebung führen könnte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Nutzen der crossmedialen Verbindung für Social-Media-Nutzer, der Kompatibilität des Engagements mit dem Rundfunkauftrag, den Qualitätsstandards öffentlich-rechtlicher Sender in sozialen Medien, dem Beitrag zur Bekämpfung von Desinformation und Hassrede, und der potenziellen Machtverschiebung durch Social-Media-Engagement.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Anwendungsteil und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung. Der Anwendungsteil analysiert verschiedene Aspekte des Themas, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche konkreten Fragen werden im Anwendungsteil untersucht?
Der Anwendungsteil untersucht folgende Fragen: Kann die crossmediale Verbindung von Nutzen für die User der sozialen Netzwerke sein? Deckt der gesetzliche Rundfunkauftrag ein Engagement der Öffentlich-Rechtlichen bei den sozialen Netzwerken ab? Entsprechen die Qualitätsstandards der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dem Bedürfnis der sozialen Medien? Können die Öffentlich-Rechtlichen einen Beitrag gegen Fake News, Hass-Posts, undurchsichtige Quellenlagen und Propaganda leisten? Erhalten die Öffentlich-Rechtlichen zu viel Macht, wenn sie sich auch noch innerhalb der sozialen Netzwerke engagieren?
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Öffentlich-rechtliche Sender, Soziale Medien, Crossmediale Strategien, Rundfunkauftrag, Qualitätsstandards, Fake News, Hassrede, Macht, Nutzer, Digitalisierung, Algorithmen.
Was ist das Fazit der Arbeit? (Kurzfassung)
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen, bewertet, ob die Zielsetzung erreicht wurde und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Kontext von öffentlich-rechtlichen Sendern und sozialen Medien. (Die detaillierte Ausarbeitung des Fazits findet sich im vollständigen Text).
- Citar trabajo
- Stella Cuscuna (Autor), 2022, Öffentlich-Rechtliche Sender und Social Media, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306543