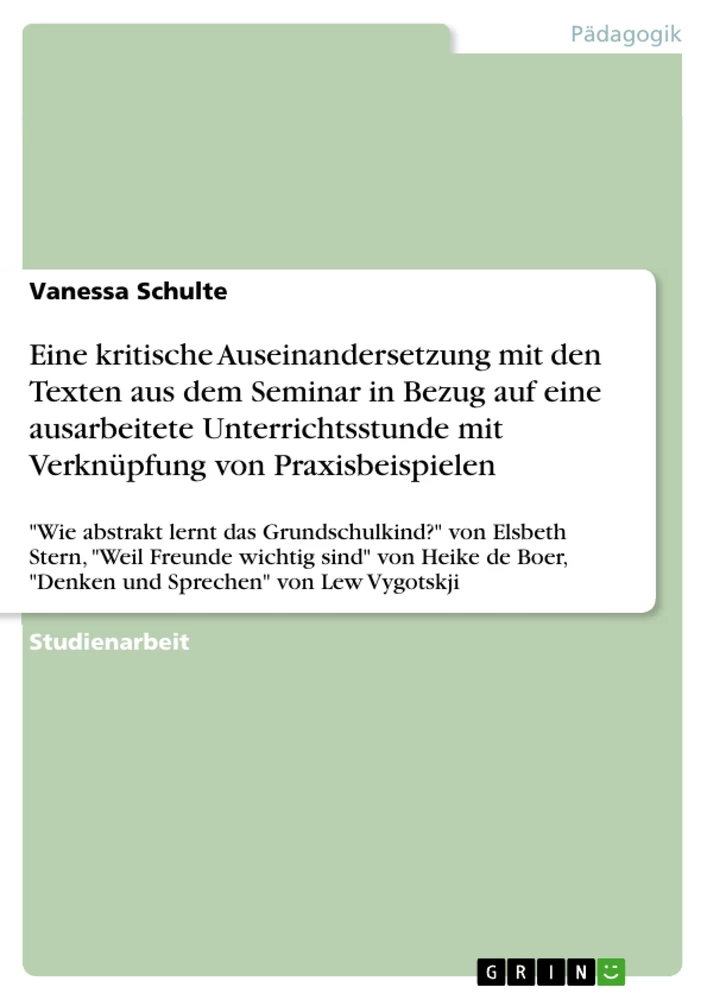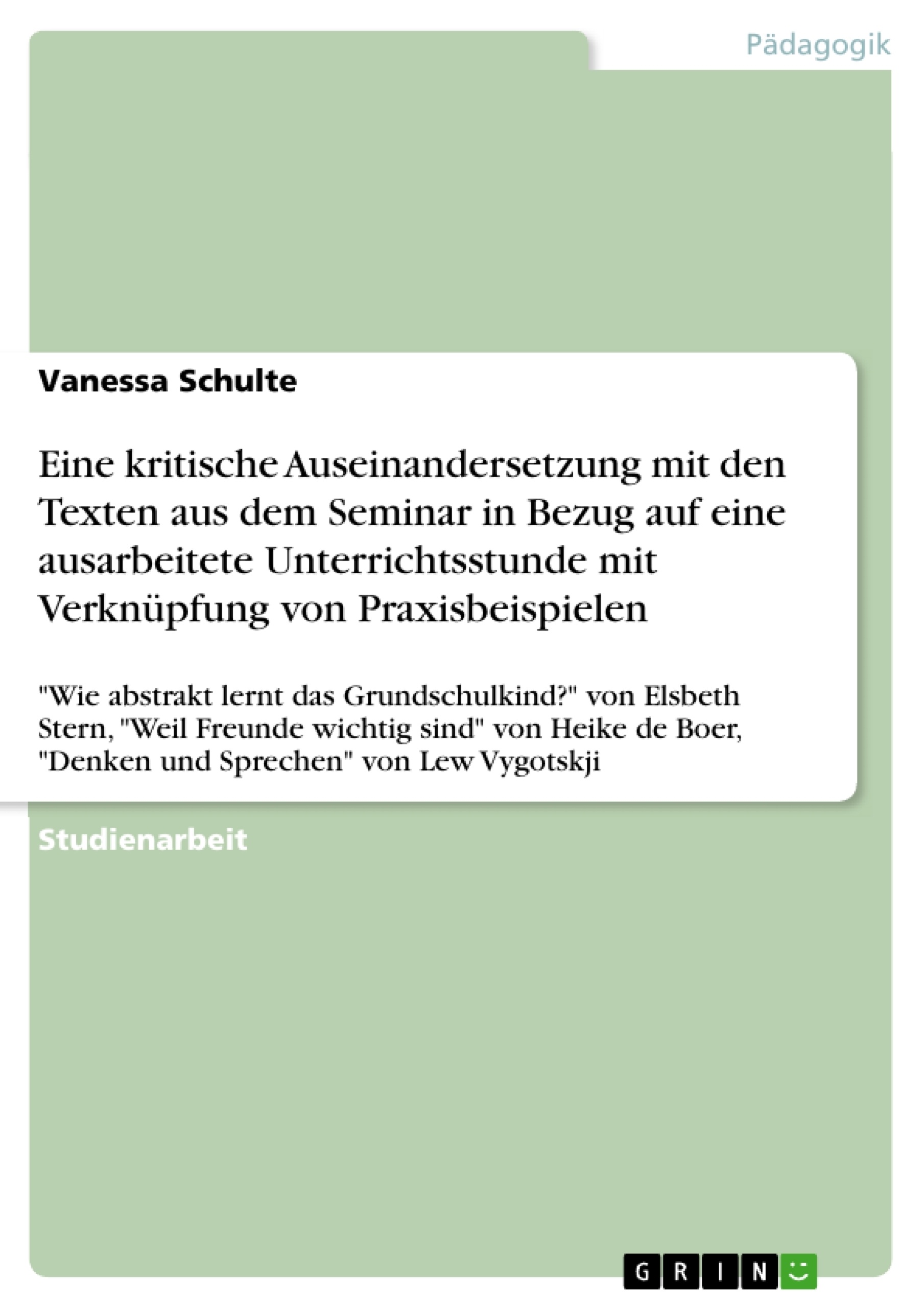Zu Beginn stechen vor allem folgende Ausgangsthesen aus Sterns Text heraus. Sie stellt klar, dass Piagets Entwicklungstheorie die Unterschiede im Denken und Lernen von Schulanfängern und älteren Schülern nicht zufriedenstellend erklären kann. Außerdem führt die kognitive Festschreibung von GrundschülerInnen1 auf der Stufe der konkret-operativen Ebene die ich noch im Folgenden erläutern werde, zu einer Unterforderung von Grundschulkindern. Dies bedeutet dann gleichzeitig für die Unterrichtsgestaltung in der Grundschule, dass wir weg von der von Piaget vorgegebenen und empfohlenen Gestaltung der Lernumgebung und hin zu Zeichensysteme als Mittel bestimmter Bedeutungen jenseits der Wahrnehmung sollten. Zeichensysteme können folgendes sein: Lehrkräfte sollten einen Unterricht erschaffen, der vielfältige Angebote in Bezug auf Darstellung und Kommunikation bereitstellen kann. Dabei sollte die Lernaktivität auf Freiwilligkeit und Selbstständigkeit basieren. Die entstehenden kognitive Kompetenzen resultieren aus den konstruktiven Leistungen der SchülerInnen. Aus Sterns Text lässt sich außerdem herauslesen, dass sich das Denken und Lernen von Grundschulkindern zu dem von Erwachsenen deutlich unterscheidet. Stern greift die Aussage Piagets heraus, der der Meinung ist, dass Kinder im Grundschulalter die vorletzte sogenannte konkret-operatorische Stufe der Denkentwicklung erreichen. Hierbei sind die SchülerInnen noch nicht in der Lage explizit vorgegebene Testbedingungen aktiv herzustellen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten bei den Aussagen, die sprachlogisch abgeleitet werden sollen. Elsbeth Stern greift die Annahme vom Konkreten zum Abstrakten zu gehen auf, in dem sie vor allem auf den Unterscheid zwischen Expertise und Novizen eingeht. Der Unterschied derer liegt hierbei nicht im Abstraktionsgrund, sondern in dessen Vernetzung und Strukturierung. Die Voraussetzungen für Höchstleistungen ist eine breite und flexible Basis an konkretem situationsbedingtem Wissen. Stern nennt hier als Beispiel Kinder, die bereits derartige Wissenbereiche beim Thema Schachspielen aufbauen können. Die Aussage von Piaget vom Konkreten zum Abstrakten zu gehen, sieht Stern als nicht stimmig an. Ebenso greift sie die These auf, dass jüngere Kinder deutlich schlechter dabei abschneiden als ältere Kinder. Dies ist auf die weniger häufigen Gelegenheiten zum Wissenserwerb zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassende Thesen und kritische Auseinandersetzungen der folgenden Texte.
- ,,Wie abstrakt lernt das Grundschulkind?\" von Elsbeth Stern
- ,,Weil Freunde wichtig sind“ von Heike de Boer.
- ,,Denken und Sprechen“ von Lew Vygotskji
- Ausarbeitung einer Unterrichtsstunde auf Basis der zugrundeliegenden Theorien
- Verknüpfungen von Praxisbeispielen
- Reflexion
- Literaturquellen
- Anhang: Tabellarischer Verlaufsplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit einer kritischen Auseinandersetzung mit ausgewählten Texten aus dem Seminar „Lehren und Lernen im Anfangsunterricht“ und deren Anwendung in einer konkreten Unterrichtsstunde. Ziel ist es, die in den Texten dargestellten Theorien zu verstehen und in die Praxis zu übertragen. Dabei werden die Herausforderungen und Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung in der Grundschule im Hinblick auf die kognitive Entwicklung von Kindern und die Bedeutung von Freundschaften betrachtet.
- Kognitive Entwicklung von Grundschulkindern
- Kritik an Piagets Entwicklungstheorie
- Relevanz von Zeichensystemen und Selbstständigkeit im Unterricht
- Bedeutung von Freundschaften und Peer-Beziehungen für die Entwicklung von Kindern
- Das fünfstufige Modell von Selman zur Entwicklung von Freundschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassende Thesen und kritische Auseinandersetzungen der folgenden Texte
,,Wie abstrakt lernt das Grundschulkind?\" von Elsbeth Stern
Der Text von Elsbeth Stern hinterfragt die Gültigkeit von Piagets Entwicklungstheorie im Hinblick auf das Lernen von Grundschulkindern. Stern argumentiert, dass Piagets Modell die Unterschiede im Denken und Lernen von Schulanfängern und älteren Schülern nicht ausreichend erklärt. Sie betont die Bedeutung von Zeichensystemen und der Gestaltung einer Lernumgebung, die vielfältige Angebote in Bezug auf Darstellung und Kommunikation bietet. Der Text analysiert auch die Herausforderungen bei der Förderung von Abstraktionsfähigkeit bei Grundschulkindern und zeigt, dass bereits Säuglinge Abstraktionsprozesse nutzen können.
,,Weil Freunde wichtig sind“ von Heike de Boer
Heike de Boer betont in ihrem Text die wichtige Rolle von Freundschaften in der Entwicklung von Kindern. Sie argumentiert, dass Freundschaften unter Kindern wichtige Bewältigungsressourcen darstellen und die kindliche Identität in Aushandlungsprozessen mit Gleichaltrigen entsteht. De Boer stellt das fünfstufige Modell von Selman zur Entwicklung von Freundschaften vor und diskutiert die Bedeutung von familiären Einflüssen, sozialer Integration und einer positiven Peerkultur für die Freundschaftsentwicklung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der kognitiven Entwicklung von Grundschulkindern, der Kritik an Piagets Entwicklungstheorie, der Relevanz von Zeichensystemen und Selbstständigkeit im Unterricht, der Bedeutung von Freundschaften und Peer-Beziehungen für die Entwicklung von Kindern sowie dem fünfstufigen Modell von Selman zur Entwicklung von Freundschaften.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Piagets Entwicklungstheorie in der Arbeit kritisiert?
Elsbeth Stern argumentiert, dass Piagets Modell die kognitiven Fähigkeiten von Grundschulkindern unterschätzt. Die starre Festschreibung auf die „konkret-operative Ebene“ könne zu einer Unterforderung im Unterricht führen.
Können Grundschulkinder bereits abstrakt lernen?
Ja, laut Stern nutzen bereits Säuglinge Abstraktionsprozesse. Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen liegt oft nicht im Abstraktionsvermögen selbst, sondern in der Vernetzung und Strukturierung des Wissens (Expertise).
Welche Bedeutung haben Zeichensysteme für den Unterricht?
Lehrkräfte sollten Zeichensysteme nutzen, um Bedeutungen jenseits der reinen Wahrnehmung zu vermitteln. Dies fördert die kognitive Kompetenz durch konstruktive Leistungen der Schüler.
Warum sind Freundschaften für Schulkinder so wichtig?
Heike de Boer zeigt auf, dass Freundschaften wichtige Bewältigungsressourcen sind. Die kindliche Identität entwickelt sich maßgeblich in Aushandlungsprozessen mit Gleichaltrigen (Peers).
Was ist das fünfstufige Modell von Selman?
Selmans Modell beschreibt die Entwicklung des Freundschaftskonzepts bei Kindern, von der rein physischen Nähe bis hin zu tiefer emotionaler Unterstützung und gegenseitigem Vertrauen.
Wie sollte eine Lernumgebung laut dem Text gestaltet sein?
Die Lernumgebung sollte vielfältige Angebote zur Darstellung und Kommunikation bieten, wobei die Lernaktivität idealerweise auf Freiwilligkeit und Selbstständigkeit basiert.
- Citation du texte
- Vanessa Schulte (Auteur), 2020, Eine kritische Auseinandersetzung mit den Texten aus dem Seminar in Bezug auf eine ausarbeitete Unterrichtsstunde mit Verknüpfung von Praxisbeispielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305573