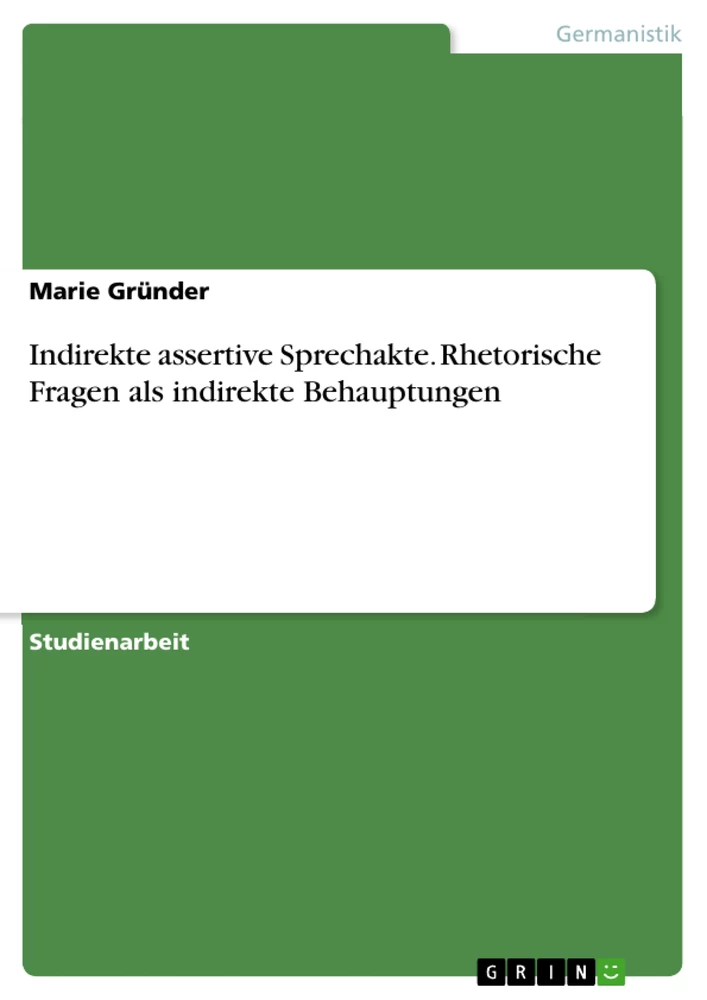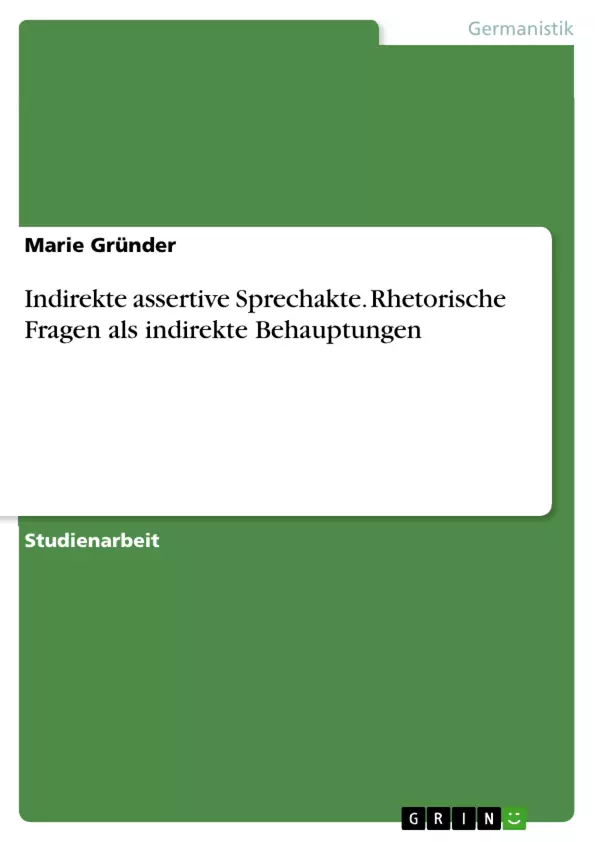Die Arbeit beschäftigt sich mit der Klassifizierung rhetorischer Fragen als indirekte Behauptungen sowie assertive Sprechakte. Dazu werden anfangs Sprechakte definiert und die Sprechakttheorie Searles erläutert, wobei die Sprechaktregeln und ihre Klassifikationen einen wichtigen Teil der Arbeit einnehmen.
Es folgt ein Kapitel über indirekte Sprechakte, wobei Illokution, Illokutionspotential und indirekte illokutionäre Indikatoren wichtige Termini darstellen. Zu den indirekten Sprechakten werden in dieser Untersuchung alle Äußerungen gezählt, bei denen die tatsächliche Illokution von der durch die Basisindikatoren angezeigten Illokution abweicht, egal ob sie von ihr verschieden, mit ihr inkompatibel oder unabhängig von potentiellen Mehrdeutigkeiten ist.
Im fünften Kapitel wird dann der Bogen zu rhetorischen Fragen gespannt, angefangen bei Rhetorizität hin zu ihren sprachlichen Kennzeichen. Es folgt eine Kritik an Searles Sprechakttheorie anhand der Ausweitung auf rhetorischen Fragen.
Die These, welcher diese Arbeit nachgeht, klassifiziert rhetorische Fragen als besonders gebräuchlichen Spezialfall des rhetorischen Sprechhandelns. Sie stellen keinen eigenen Sprechakttypen dar. Durch den Aspekt der Gelingensbedingungen wird dargelegt, dass rhetorische Fragen indirekte Behauptungen darstellen und zu Recht zu den Assertionen zu rechnen sind. Diese These soll anhand einiger Beispiele und wissenschaftlicher Aufsätze untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Sprechakt
- 3. Die Sprechakttheorie Searles
- 3.1 Die Sprechaktregeln
- 3.2 Die Sprechaktklassifikationen
- 4. Indirekte Sprechakte
- 5. Rhetorische Fragen
- 5.1 Rhetorizität
- 5.2 Indirekte illokutionäre Indikatoren
- 5.3 Kritik an Searles Klassifikation durch die Ausweitung auf rhetorische Fragen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Klassifizierung rhetorischer Fragen als indirekte Behauptungen und assertive Sprechakte. Sie analysiert die Sprechakttheorie Searles, insbesondere die Sprechaktregeln und -klassifikationen, und beleuchtet den Zusammenhang zwischen indirekten Sprechakten und rhetorischen Fragen. Die Arbeit überprüft, ob und wie Searles Theorie auf rhetorische Fragen angewendet werden kann.
- Klassifizierung rhetorischer Fragen als Sprechakte
- Analyse der Sprechakttheorie Searles
- Untersuchung indirekter Sprechakte
- Beziehung zwischen Illokution und Illokutionspotential
- Anwendung der Sprechakttheorie auf rhetorische Fragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Forschungsgegenstand: die Klassifizierung rhetorischer Fragen als indirekte Behauptungen und assertive Sprechakte. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die Methodik, einschließlich der Verwendung von Beispielen aus der Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD-ids-Mannheim). Die zentrale These der Arbeit wird vorgestellt: Rhetorische Fragen stellen keinen eigenen Sprechakttyp dar, sondern einen Spezialfall des indirekten Sprechhandelns, der als indirekte Behauptung klassifiziert werden kann.
2. Der Sprechakt: Dieses Kapitel definiert den Sprechaktbegriff und erläutert die Grundlagen der Sprechakttheorie. Es wird auf die Bedeutung des Sprechakts als Handlung und auf die verschiedenen Teilakte (lokutionär, illokutionär, perlokutionär) eingegangen. Die Arbeit betont die Relevanz der Sprechakttheorie als grundlegendes pragmatisches Modell zur Systematisierung sprachlichen Handelns und erwähnt die Beiträge von Austin und Searle zur Entwicklung dieser Theorie.
3. Die Sprechakttheorie Searles: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Searles Weiterentwicklung der Sprechakttheorie Austins. Es werden Searles konstitutive und regulative Regeln für Sprechakte vorgestellt, sowie die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen. Die Definition der Illokution als Teilakt des Sprechaktes und die Bedeutung der illokutionären Kraft werden erläutert. Die Modifikationen, die Searle an Austins Modell vorgenommen hat, insbesondere die Umgestaltung des rhetischen in den propositionalen Akt, werden detailliert dargestellt.
4. Indirekte Sprechakte: Dieses Kapitel behandelt das Konzept der indirekten Sprechakte, wobei der Fokus auf die Diskrepanz zwischen der angezeigten und der tatsächlich vollzogenen Illokution liegt. Es werden wichtige Termini wie Illokution, Illokutionspotential und indirekte illokutionäre Indikatoren erklärt. Die Definition von indirekten Sprechakten in dieser Arbeit wird präzisiert: alle Äußerungen, bei denen die tatsächliche Illokution von der durch die Basisindikatoren angezeigten Illokution abweicht, zählen als indirekte Sprechakte.
5. Rhetorische Fragen: In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen indirekten Sprechakten und rhetorischen Fragen hergestellt. Die Arbeit beleuchtet den Begriff der Rhetorizität und die sprachlichen Merkmale rhetorischer Fragen. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit Searles Sprechakttheorie im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit auf rhetorische Fragen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Übertragbarkeit der Sprechaktregeln für Informationsfragen auf rhetorische Fragen.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, Searle, rhetorische Fragen, indirekte Sprechakte, Illokution, Illokutionspotential, Assertionen, Behauptungen, Gelingensbedingungen, Rhetorizität, DGD-Mannheim.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Klassifizierung rhetorischer Fragen als indirekte Behauptungen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Klassifizierung rhetorischer Fragen als indirekte Behauptungen und assertive Sprechakte. Sie analysiert, ob und wie Searles Sprechakttheorie auf rhetorische Fragen angewendet werden kann.
Welche Theorie steht im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentrale Theorie ist Searles Sprechakttheorie, insbesondere seine Sprechaktregeln und -klassifikationen. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen indirekten Sprechakten und rhetorischen Fragen.
Welche Aspekte von Searles Theorie werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Searles konstitutive und regulative Regeln für Sprechakte, die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Äußerungen, die Definition der Illokution und die Bedeutung der illokutionären Kraft. Besondere Aufmerksamkeit wird der Modifikation des rhetischen in den propositionalen Akt gewidmet.
Was sind indirekte Sprechakte im Kontext dieser Arbeit?
Indirekte Sprechakte sind in dieser Arbeit definiert als alle Äußerungen, bei denen die tatsächliche Illokution von der durch die Basisindikatoren angezeigten Illokution abweicht. Es wird auf die Diskrepanz zwischen angezeigter und tatsächlich vollzogener Illokution eingegangen.
Wie werden rhetorische Fragen in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen indirekten Sprechakten und rhetorischen Fragen. Sie beleuchtet den Begriff der Rhetorizität und die sprachlichen Merkmale rhetorischer Fragen. Es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit von Searles Theorie auf rhetorische Fragen, insbesondere die Übertragbarkeit der Sprechaktregeln für Informationsfragen auf rhetorische Fragen.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet Beispiele aus der Datenbank für gesprochenes Deutsch (DGD-ids-Mannheim) zur Illustration und Analyse. Die zentrale These lautet: Rhetorische Fragen stellen keinen eigenen Sprechakttyp dar, sondern einen Spezialfall des indirekten Sprechhandelns, der als indirekte Behauptung klassifiziert werden kann.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Sprechaktbegriff, ein Kapitel zu Searles Sprechakttheorie, ein Kapitel zu indirekten Sprechakten, ein Kapitel zu rhetorischen Fragen und eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprechakttheorie, Searle, rhetorische Fragen, indirekte Sprechakte, Illokution, Illokutionspotential, Assertionen, Behauptungen, Gelingensbedingungen, Rhetorizität, DGD-Mannheim.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Zentrale Fragen sind: Wie lassen sich rhetorische Fragen als Sprechakte klassifizieren? Wie funktioniert Searles Sprechakttheorie? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen indirekten Sprechakten und rhetorischen Fragen? Wie lässt sich die Sprechakttheorie auf rhetorische Fragen anwenden? Welche Beziehung besteht zwischen Illokution und Illokutionspotential?
- Citation du texte
- Marie Gründer (Auteur), 2022, Indirekte assertive Sprechakte. Rhetorische Fragen als indirekte Behauptungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1304866