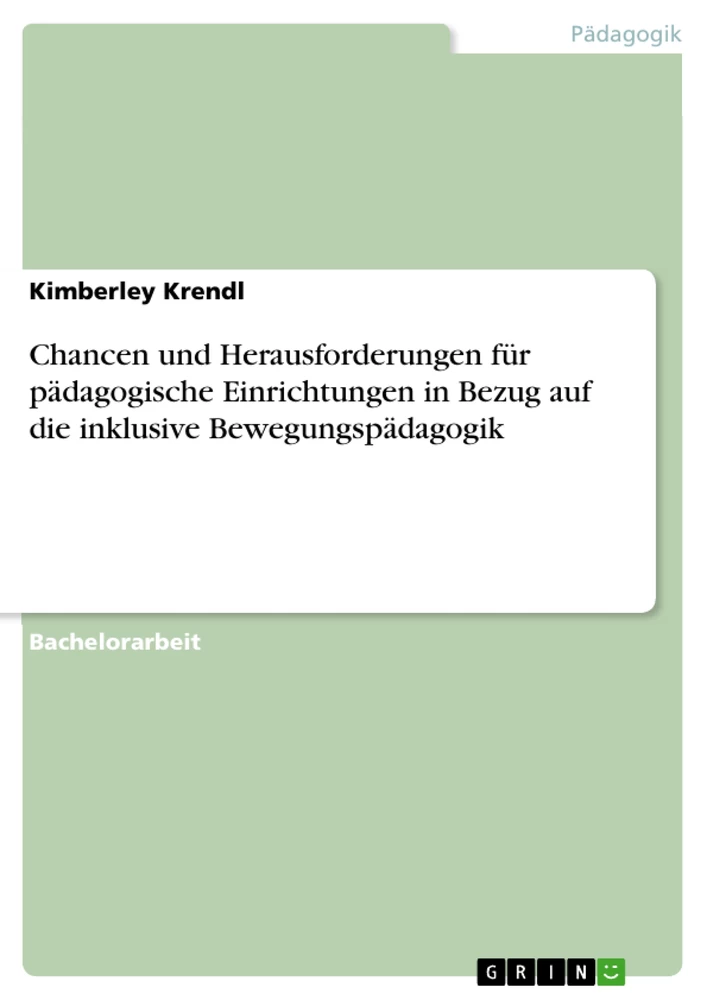Diese Arbeit setzt sich mit den aktuellen Veränderungen bezogen auf historische Ereignisse und unter selbstgewählten Schwerpunkten mit der Frage: Inwiefern fördern Sport und Bewegung die Partizipation und Diversität?
Sport und Bewegung können Menschen zusammenbringen. Doch zu Inklusion gehört mehr, als nur ein Partnerkind an die Hand zu bekommen. Mitmachen trotz Beeinträchtigung in Kindertagesstätten, Schulen und Verein ist möglich und wie das funktionieren kann, wird in der vorliegenden Arbeit näher beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Inklusion
- 2.2 Barrieren
- 2.3 Diversität
- 2.4 Heterogenität
- 2.5 Chancengleichheit
- 2.6 Partizipation
- 2.7 Inklusion in der Sport- und Bewegungspädagogik
- 3. Historische Einordnung
- 3.1 Von der Exklusion zur Inklusion
- 3.2 Modelle von Behinderung
- 3.2.1 Das medizinische oder individuelle Modell
- 3.2.2 Das relationale Modell
- 3.2.3 Das soziale Modell
- 3.2.4 Das Randgruppenmodell
- 3.2.5 Das menschenrechtliche Modell
- 3.2.6 Das kulturelle Modell
- 3.3 Meilensteine der Teilhabegesetzgebung
- 3.4 Die Entwicklung vom „Versehrtensport“ bis hin zu den Paralympics
- 4. Bewegung
- 4.1 Bewegung und Bildung
- 4.2 Die Bedeutung von Bewegung für die Kindheit – Der Einfluss von Bewegung für den Aufbau des kindlichen Selbstwertgefühls
- 4.2.1 Selbstwirksamkeit und der Einfluss von Selbstwirksamkeit auf das Selbstwertgefühl
- 4.2.2 Kindliches Selbstwertgefühl/Körper und Bewegung
- 4.3 Psychomotorisch orientierte Bewegungserziehung
- 4.4 Die psychomotorische Haltung
- 4.5 Bewegungserziehung und inklusive Bildung
- 4.6 Inklusive Bewegungsförderung und Leistung
- 5. Die Umsetzung von inklusiver Bewegungspädagogik in Kita, Schule und Verein
- 5.1 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
- 5.1.1 Der Einfluss von Kitas auf die inklusive Bildung
- 5.1.2 Professionalisierung und die inklusive Haltung der pädagogischen Fachkraft
- 5.1.3 Inklusive Bewegungspädagogik in der Kita
- 5.1.4 Die Gestaltung inklusiver Bildungs- und Bewegungsräume
- 5.2 Inklusion im Sportunterricht
- 5.2.1 Der Umgang mit Heterogenität
- 5.2.2 Inklusiver Sportunterricht
- 5.2.3 Brennball aus einer neuen Perspektive – ein Spiel für alle
- 5.3 Inklusion in Sportvereinen
- 5.1 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
- 6. Chancen und Herausforderungen für pädagogische Einrichtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen für pädagogische Einrichtungen im Kontext inklusiver Bewegungspädagogik. Die Arbeit untersucht, inwiefern Sport und Bewegung die Partizipation und Diversität fördern können.
- Definition und Bedeutung des Begriffs "Inklusion" im Kontext der Bewegungspädagogik
- Historische Entwicklung der Inklusion und deren Auswirkungen auf den Sportbereich
- Der Einfluss von Bewegung auf die kindliche Entwicklung und Bildung, insbesondere im Hinblick auf Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit
- Konkrete Beispiele und Praxisansätze für inklusive Bewegungspädagogik in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportvereinen
- Herausforderungen und Chancen, die sich für pädagogische Einrichtungen in Bezug auf die Implementierung inklusiver Bewegungspädagogik ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition wichtiger Begriffe wie Inklusion, Diversität, Heterogenität und Partizipation. Im Anschluss wird ein historischer Abriss der Entwicklung von Exklusion zu Inklusion in der Sport- und Bewegungspädagogik gegeben. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Modelle von Behinderung und betrachtet die Meilensteine der Teilhabegesetzgebung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung von Bewegung für die kindliche Entwicklung und Bildung, wobei die Rolle der psychomotorischen Bewegungserziehung hervorgehoben wird. Die Umsetzung von inklusiver Bewegungspädagogik in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportvereinen wird in detaillierten Kapiteln behandelt. Dabei werden die jeweiligen spezifischen Herausforderungen und Chancen dieser Einrichtungen im Hinblick auf die Implementierung inklusiver Bewegungspädagogik beleuchtet.
Schlüsselwörter
Inklusion, Bewegungspädagogik, Diversität, Heterogenität, Chancengleichheit, Partizipation, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, Kindertageseinrichtung, Schule, Sportverein, Barrierefreiheit, Teilhabegesetzgebung, Paralympics.
Häufig gestellte Fragen
Was ist inklusive Bewegungspädagogik?
Ein Ansatz, der allen Menschen – unabhängig von körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen – die Teilhabe an Sport und Bewegung ermöglicht.
Wie fördert Bewegung das kindliche Selbstwertgefühl?
Durch körperliche Aktivität erleben Kinder Selbstwirksamkeit, was die Überzeugung stärkt, Herausforderungen aus eigener Kraft meistern zu können.
Welche Modelle von Behinderung gibt es?
Die Arbeit nennt unter anderem das medizinische, das soziale, das menschenrechtliche und das kulturelle Modell.
Wie kann Inklusion im Sportverein gelingen?
Durch den Abbau von Barrieren, die Schulung von Trainern und die Anpassung von Spielregeln, um gemeinsames Sporttreiben zu ermöglichen.
Was ist die UN-Behindertenrechtskonvention?
Ein völkerrechtlicher Vertrag, der die volle Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen, auch im Sport, vorschreibt.
- Quote paper
- Kimberley Krendl (Author), 2022, Chancen und Herausforderungen für pädagogische Einrichtungen in Bezug auf die inklusive Bewegungspädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1302870