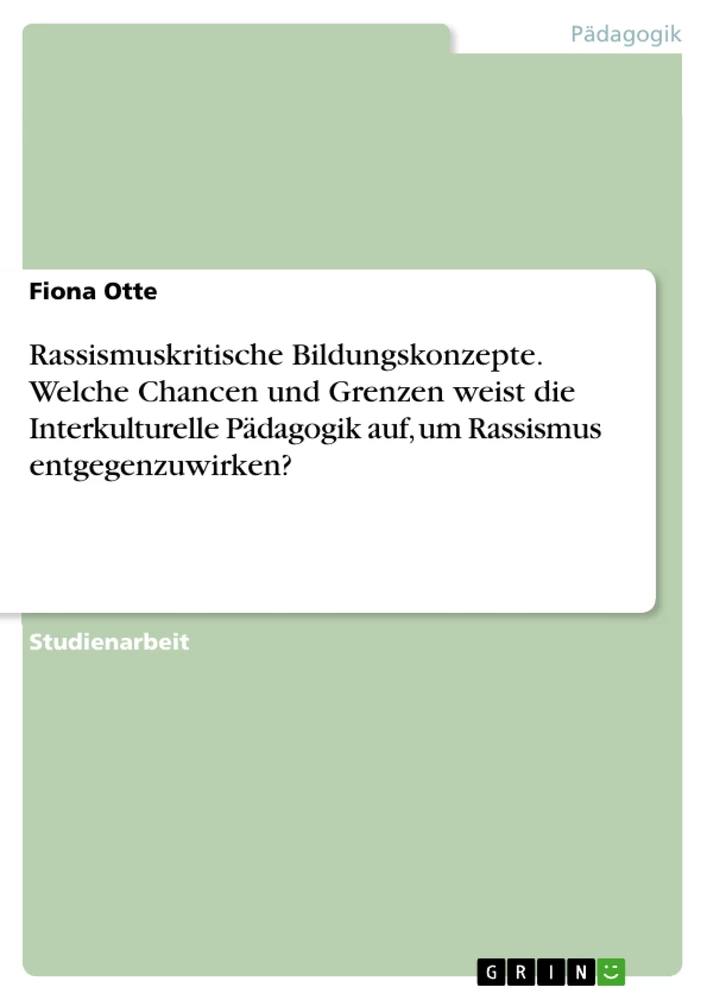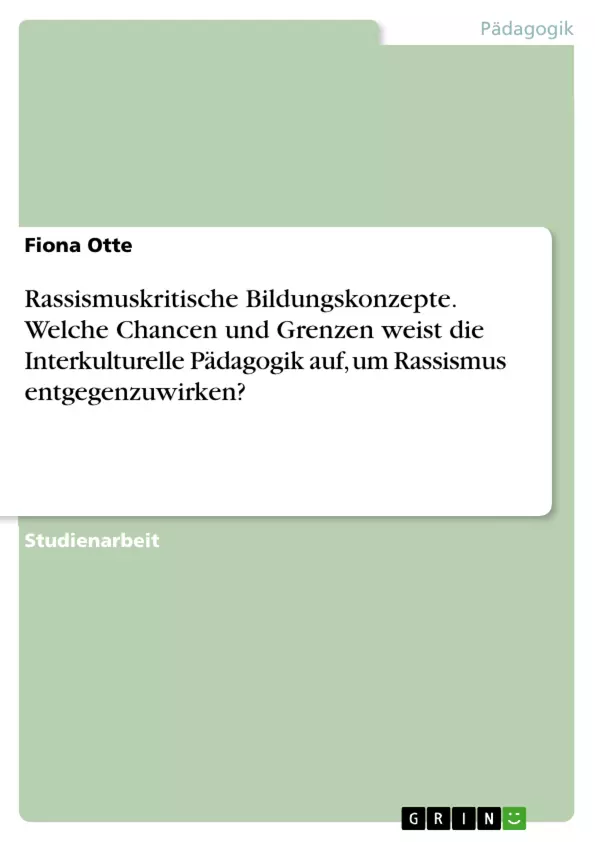Die Arbeit geht auf Formen der strukturellen und institutionellen Diskriminierung ein und beleuchtet besonders gruppenbezogene Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund. Diskriminierung struktureller und institutioneller Art ist schwieriger zu erkennen und zu bekämpfen als persönliche rassistische Beleidigungen oder Übergriffe. In den Organisationsstrukturen der Gesellschaft verankert, findet diese Form der Benachteiligung regelmäßig -bewusst und unbewusst- statt, indem auf Gleichberechtigung ausgelegte Handlungsabläufe in den Behörden, Institutionen und Bildungseinrichtungen Benachteiligungen für Migrant_innen produzieren.
Schwerpunkt dieser Hausarbeit sind jedoch pädagogische Konzepte, die als Antwort auf die Einwanderungsgesellschaft initialisiert wurden, mit dem Ziel der Integration der Zugewanderten. Eingegangen wird dabei auf die Ausländerpädagogik und die Interkulturelle Pädagogik, welche anschließend auf ihre Strategien untersucht und rassismuskritisch hinterfragt werden, denn auch ihnen liegen Unterscheidungspraxen zugrunde. So wird die Frage beantwortet, ob eine Interkulturelle Pädagogik mehr soziale Gerechtigkeit herstellen kann oder ob das Konzept sogar weitere Diskriminierung verursacht.
Obwohl Rassismus laut unseres Grundgesetzes verboten ist, werden Menschen in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens immer noch benachteiligt. Besonders Alltagsrassismus führt zu Diskriminierung, denn er wird oft subtil vorgebracht und ist schwer verfolgbar. Rassismus ist aufgrund seiner Komplexität schwer greifbar und definierbar, doch ordnet er unser Denken und Handeln und hat einen direkten Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben.
Die dem Rassismus zugrunde liegenden Unterscheidungspraxen sind dabei menschengemachte Konstruktionen von Differenzen, die in der Gesellschaft weitervererbt werden. Legitimieren diese Unterscheidungspraxen Privilegien der Mehrheitsgesellschaft, so bedeutet dies zwangsläufig eine Benachteiligung der Minderheitsgesellschaft, die sich in unterschiedlichster Form (u.A. Bildungserfolg, Armut, Jobwahl, Wohnungssuche) zeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Begriffsbestimmung von Rassismus
- Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis
- Rassismustheorie und Rassismuskritik
- Zur Konzeptualisierung ausländerpädagogischer Ansätze
- Kompetenz, Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz
- Das Konzept der Interkulturellen Pädagogik
- Interkulturelle Soziale Arbeit als Querschnittsaufgabe
- Grenzen Interkultureller Pädagogik
- Rassismuskritische Ansätze
- Paradoxien und Dilemmata der rassismuskritischen Arbeit
- Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert rassismuskritische Bildungskonzepte und untersucht die Chancen und Grenzen der Interkulturellen Pädagogik im Kampf gegen Rassismus. Der Fokus liegt auf struktureller und institutioneller Diskriminierung, insbesondere der gruppenbezogenen Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Arbeit befasst sich mit den Begriffen Rassismus, Kultur und Interkulturalität und hinterfragt kritisch die Strategien der Ausländerpädagogik und der Interkulturellen Pädagogik. Ziel ist es, zu klären, ob eine Interkulturelle Pädagogik soziale Gerechtigkeit fördern kann oder ob sie sogar zu weiterer Diskriminierung führt.
- Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis und seine Auswirkungen
- Strukturelle und institutionelle Diskriminierung von Migrant_innen
- Konzepte der Ausländerpädagogik und der Interkulturellen Pädagogik
- Rassismuskritische Ansätze und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Die Rolle von Interkultureller Pädagogik in der Förderung sozialer Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Problematik von Rassismus in Deutschland und beleuchtet die Bedeutung von struktureller und institutioneller Diskriminierung. Sie führt in die Fragestellung der Arbeit ein, die sich mit der Wirksamkeit von Interkultureller Pädagogik im Kampf gegen Rassismus auseinandersetzt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition von Rassismus, wobei die Komplexität des Begriffs und seine Ausprägungen als gesellschaftliches Verhältnis beleuchtet werden. Es werden verschiedene Theorien und Perspektiven auf Rassismus vorgestellt und die Bedeutung von Macht- und Dominanzverhältnissen im Kontext von Rassenkonstruktionen aufgezeigt.
Im dritten Kapitel werden ausländerpädagogische Ansätze und deren Konzeptualisierung diskutiert. Dabei stehen die Begriffe Kompetenz, Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz im Fokus. Das Konzept der Interkulturellen Pädagogik wird vorgestellt und die Rolle der interkulturellen Sozialen Arbeit als Querschnittsaufgabe erläutert.
Das vierte Kapitel analysiert kritisch die Grenzen der Interkulturellen Pädagogik. Es beleuchtet, inwieweit das Konzept trotz guter Absichten möglicherweise zu weiteren Diskriminierungsprozessen beitragen kann.
Das fünfte Kapitel widmet sich rassismuskritischen Ansätzen und ihren spezifischen Charakteristika. Es wird diskutiert, wie diese Ansätze dem Kampf gegen Rassismus effektiver dienen können als die Interkulturelle Pädagogik.
Das sechste Kapitel beleuchtet Paradoxien und Dilemmata in der rassismuskritischen Arbeit. Es geht auf die Herausforderungen ein, die sich im Kontext der Bekämpfung von Rassismus ergeben.
Das siebte Kapitel behandelt die Bedeutung von rassismuskritischen Konzepten für die Soziale Arbeit. Es verdeutlicht, wie diese Konzepte in der Praxis der Sozialen Arbeit angewendet und weiterentwickelt werden können.
Schlüsselwörter
Rassismus, Interkulturelle Pädagogik, Ausländerpädagogik, Diskriminierung, Migrant_innen, soziale Gerechtigkeit, struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus, Rassismuskritik, Bildungskonzepte, Machtverhältnisse, Dominanzverhältnisse, Kultur, Interkulturalität, Kompetenz, Integration, Soziale Arbeit
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen individueller und institutioneller Diskriminierung?
Individuelle Diskriminierung sind persönliche Beleidigungen. Institutionelle Diskriminierung ist in Organisationsstrukturen (Behörden, Schulen) verankert und benachteiligt Migranten oft unbewusst durch festgefahrene Abläufe.
Kann Interkulturelle Pädagogik Rassismus verhindern?
Die Arbeit hinterfragt dies kritisch. Während sie Integration fördern will, basieren viele Konzepte auf Unterscheidungspraxen, die ungewollt weitere Diskriminierung verursachen können.
Was bedeutet "Rassismuskritik" in der Sozialen Arbeit?
Rassismuskritik geht über bloße Toleranz hinaus. Sie analysiert Macht- und Dominanzverhältnisse und versucht, die menschengemachten Konstruktionen von Differenzen aktiv abzubauen.
Warum ist Alltagsrassismus so schwer zu bekämpfen?
Alltagsrassismus ist oft subtil und wird als "normal" wahrgenommen. Er ist schwer verfolgbar, prägt aber massiv das Denken und Handeln in der Gesellschaft.
Welche Rolle spielt "Kultur" in der pädagogischen Debatte?
Häufig wird der Begriff "Kultur" als Ersatz für "Rasse" verwendet (Kulturalisierung), was dazu führen kann, dass Menschen auf vermeintliche kulturelle Merkmale reduziert und damit erneut ausgegrenzt werden.
- Citar trabajo
- Fiona Otte (Autor), 2019, Rassismuskritische Bildungskonzepte. Welche Chancen und Grenzen weist die Interkulturelle Pädagogik auf, um Rassismus entgegenzuwirken?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1302158