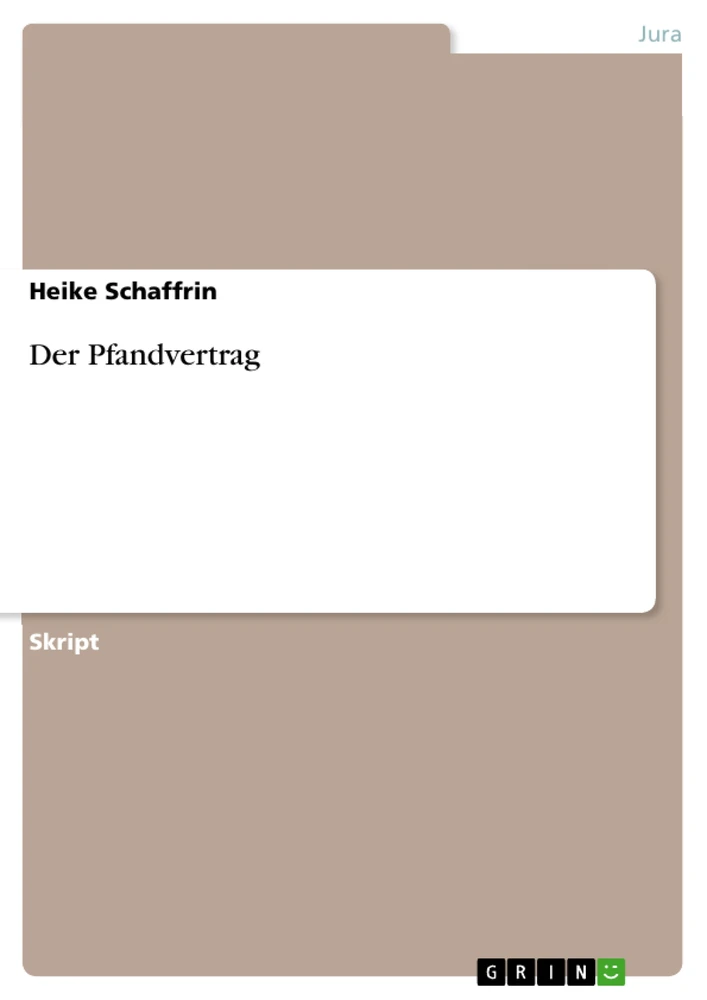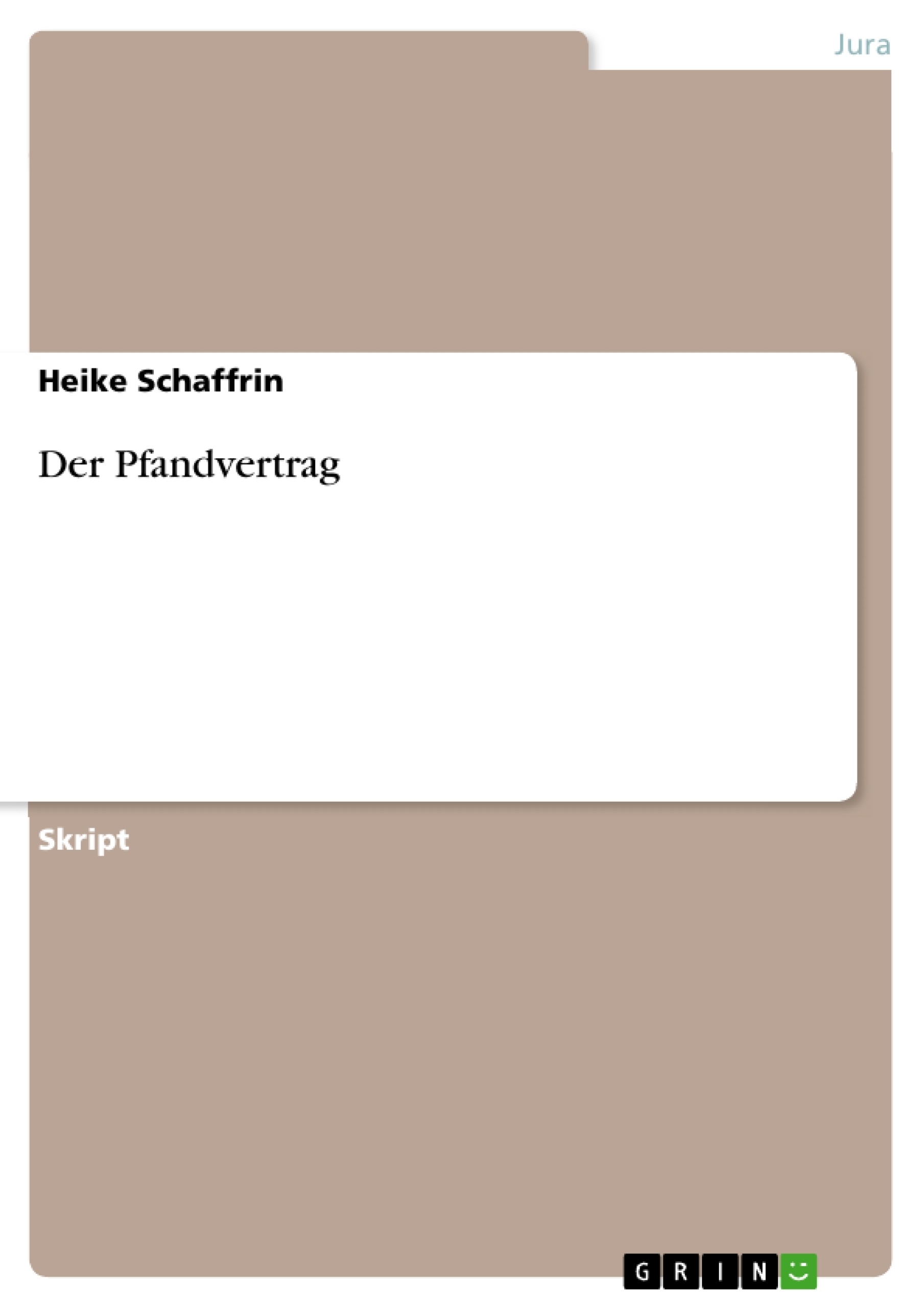In kurzer und übersichtlicher Weise werden die wesentlichen Grundzüge des privatrechtlichen Pfandrechts dargestellt. Das Skript dient dem Anfängerstudium ebenso wie als Einstieg für eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema. Das privatrechtliche Pfandrecht ist ein beschränkt dingliches absolutes Recht. Es dient der
Sicherung einer Forderung an fremden beweglichen Sachen oder Rechten. Gemäß § 1204 Abs. 1
BGB kann eine bewegliche Sache zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden,
dass der Gläubiger im Fall der Nichtzahlung berechtigt ist, durch Verwertung des Pfandes
Befriedigung aus der Sache zu suchen, indem er den Erlös aus der Verwertung zur Tilgung der
Forderung verwendet. Das Ziel des Pfandrechts an einer beweglichen Sache liegt also in dem
Recht des Gläubigers, sich aus der Sache zu befriedigen und dadurch den Gegenwert für den
Anspruch aus der gesicherten Forderung zu erhalten.
Das Pfandrecht an beweglichen Sachen ist ein sog. Faustpfandrecht. Es dadurch ist
gekennzeichnet, dass zur Begründung des Pfandrechts der Verpfänder dem Gläubiger die Sache
übergeben muss (vgl. § 1205 BGB). Das Pfandrecht ist also an den Besitz gebunden.
Wegen der Notwendigkeit der Besitzübergabe ist das vertragliche Pfandrecht weitestgehend
durch die Kreditsicherungsmittel Sicherungseigentum und Sicherungsabtretung verdrängt
worden. Es hat nur noch eine äußerst geringe wirtschaftliche und praktische Bedeutung.
Lediglich bei den sog. Lombardgeschäften von Banken wird ein Pfandrecht an den Wertpapieren
bestellt, an denen die Bank im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch
erlangen wird (Nr. 14 Abs. 1 S. 1 AGB-Banken). Dies betrifft die Verpfändungen von
Wertpapieren, die nach dem DepotG durch eine Bank verwahrt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Pfandrecht
- Begriff und Bedeutung des Pfandrechts
- Die Arten des Pfandrechts
- Vertragliches Pfandrecht
- Gesetzliches Pfandrecht
- Pfändungspfandrecht
- Allgemeine Grundsätze des Pfandrechts
- Pfandrecht als dingliches Verwertungsrecht
- Pfandgegenstand
- Spezialitätsgrundsatz
- Prioritätsgrundsatz
- Pfandrecht und gesicherte Forderung
- Das Pfandrecht an beweglichen Sachen
- Bestellung des Pfandrechts
- Schutz des Pfandrechts
- Die Verwertung des Pfandrechts
- Allgemeines über die Verwertung
- Die Durchführung des Pfandverkaufs
- Die Wirkungen des Pfandverkaufs
- Die Rechte am Versteigerungserlös
- Das Erlöschen des Pfandrechts an beweglichen Sachen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Pfandrecht im deutschen Recht. Er analysiert den Begriff und die Bedeutung des Pfandrechts, untersucht die verschiedenen Arten des Pfandrechts und stellt die allgemeinen Grundsätze dar, die für das Pfandrecht gelten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Pfandrecht an beweglichen Sachen, wobei die Bestellung, der Schutz, die Verwertung und das Erlöschen des Pfandrechts im Detail betrachtet werden.
- Definition und Bedeutung des Pfandrechts
- Unterscheidung der Arten des Pfandrechts (vertraglich, gesetzlich, Pfändungspfandrecht)
- Grundsätze des Pfandrechts (Spezialitätsgrundsatz, Prioritätsgrundsatz, Akzessorietät)
- Das Pfandrecht an beweglichen Sachen: Bestellung, Schutz, Verwertung, Erlöschen
- Rechte am Versteigerungserlös
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Pfandrecht
Das Kapitel beleuchtet den Begriff und die Bedeutung des Pfandrechts. Es wird erläutert, dass es sich um ein dingliches Recht handelt, das der Sicherung einer Forderung an fremden beweglichen Sachen oder Rechten dient. Der Gläubiger hat im Falle der Nichtzahlung das Recht, sich durch Verwertung des Pfandes zu befriedigen. Das Pfandrecht an beweglichen Sachen ist ein Faustpfandrecht, welches durch Besitzübergabe begründet wird. Das vertragliche Pfandrecht ist jedoch durch die Kreditsicherungsmittel Sicherungseigentum und Sicherungsabtretung weitgehend verdrängt worden. Lediglich bei Lombardgeschäften von Banken wird ein Pfandrecht bestellt.
Die Arten des Pfandrechts
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den drei Arten des Pfandrechts an beweglichen Sachen: dem vertraglichen Pfandrecht, dem gesetzlichen Pfandrecht und dem Pfändungspfandrecht. Das vertragliche Pfandrecht entsteht durch ein Verfügungsgeschäft, während das gesetzliche Pfandrecht kraft Gesetzes entsteht, ohne dass es einer dinglichen Einigung bedarf. Das Pfändungspfandrecht entsteht durch Pfändung im Wege der Zwangsvollstreckung.
Allgemeine Grundsätze des Pfandrechts
Dieser Abschnitt behandelt die allgemeinen Grundsätze des Pfandrechts, darunter die Tatsache, dass es ein dingliches Recht ist, das gegenüber jedermann wirksam ist. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Verwertungsrecht, welches auf die Verwertung des Pfandgegenstandes bei Nichtzahlung der gesicherten Forderung beschränkt ist. Der Spezialitätsgrundsatz besagt, dass die Verpfändung einer Sachgesamtheit als solche nicht möglich ist, sondern nur einzelne Sachen für eine Forderung verpfändet werden können. Außerdem wird der Prioritätsgrundsatz erläutert, der besagt, dass das früher entstandene Pfandrecht Vorrang hat. Das Pfandrecht ist von der gesicherten Forderung abhängig und erlischt mit deren Erlöschen.
Das Pfandrecht an beweglichen Sachen
Dieses Kapitel behandelt die Bestellung des Pfandrechts an beweglichen Sachen, die Einigung und Übergabe sowie den gutgläubigen Erwerb. Es werden die gesetzlichen Pfandrechte, wie das Pfandrecht des Pächters, des Unternehmers beim Werkvertrag, des Kommissionärs, des Spediteurs, des Lagerhalters und des Frachtführers, sowie das Pfandrecht des Vermieters, des Verpächters und des Gastwirts erläutert. Außerdem wird der Schutz des Pfandrechts und die Verwertung des Pfandrechts im Detail behandelt, einschließlich der Durchführung des Pfandverkaufs und der Rechte am Versteigerungserlös.
Schlüsselwörter
Pfandrecht, dingliches Recht, Sicherung einer Forderung, bewegliche Sache, Rechte, vertragliches Pfandrecht, gesetzliches Pfandrecht, Pfändungspfandrecht, Spezialitätsgrundsatz, Prioritätsgrundsatz, Akzessorietät, Besitzübergabe, Verwertung des Pfandes, Versteigerung, Erlöschen des Pfandrechts
- Quote paper
- Heike Schaffrin (Author), 2008, Der Pfandvertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129725