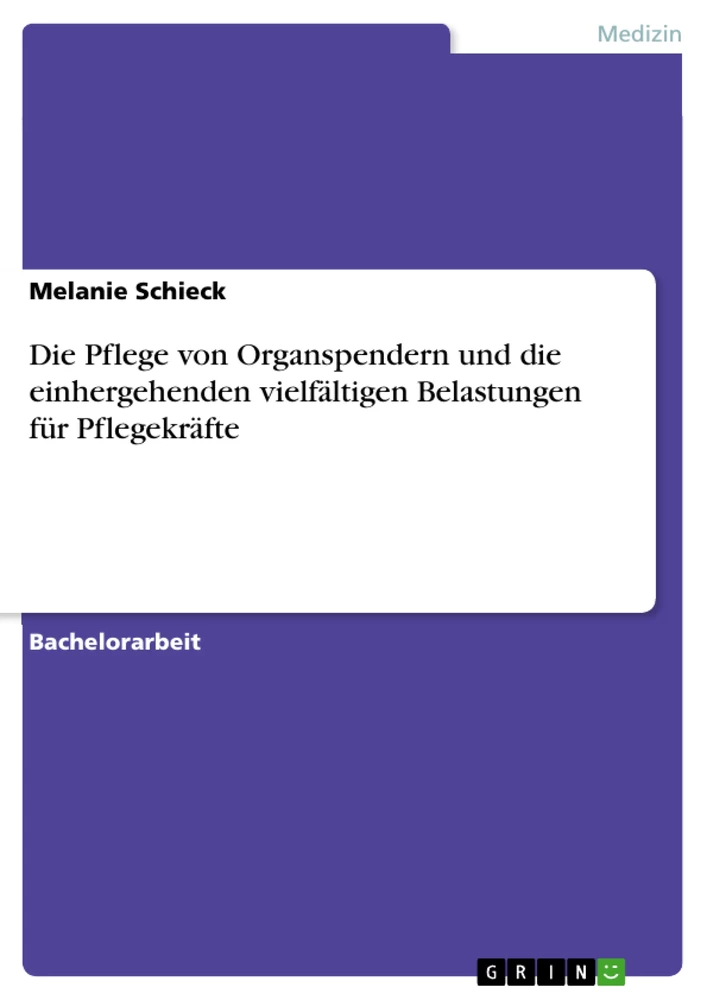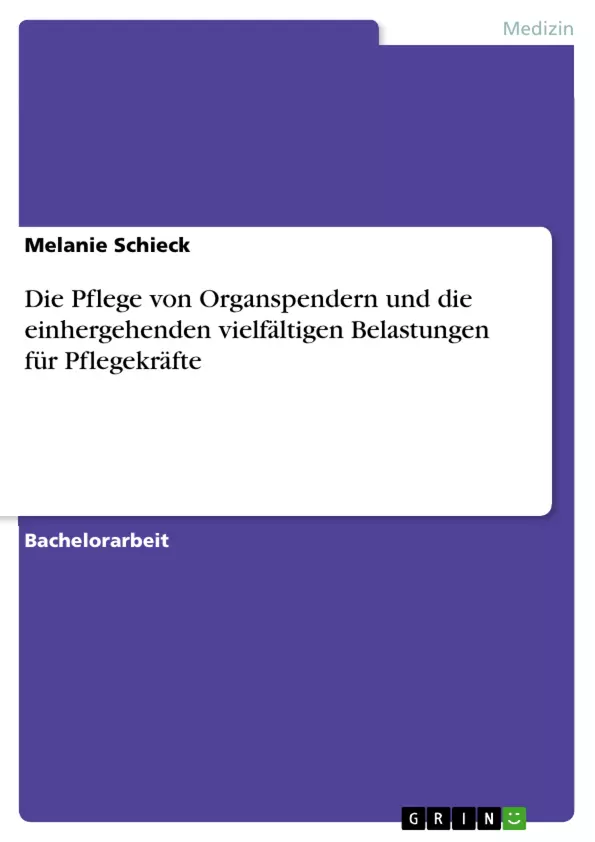Die Transplantationsmedizin rettet Leben - jedoch steht auf der anderen Seite der Spender. Das Krankenpflegepersonal arbeitet nahe an diesen Spendern und begleiten ihn von der Diagnosestellung bis hin zur Organtransplantation. Sie pflegen einen toten Menschen, sorgen sich um eine würdevolle Behandlung und erleben sein physisches Sterben durch die Organexplantation. Dies kann zu massiven Belastungen führen, welche die vorliegende Literaturarbeit anhand einer ausführlichen Literaturrecherche vorstellt.
Im ersten Teil geht es um die Transplantationsmedizin. Es wird der Frage auf den Grund gegangen, was die Organspende bedeutet und ab wann ein Mensch als tot gilt. Im zweiten Teil geht die Autorin auf Belastungen und ethischen Dilemmata ein, denen die Pflegenden bei der Betreuung von hirntoten Menschen ausgesetzt sind. Hier werden aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt und die Bedeutung der Thematik verdeutlicht. Im nächsten Teil werden mögliche Hilfsangebote für Pflegekräfte vorgestellt. Der letzte Teil beinhaltet eine Diskussion der Aktualität der Thematik, sowie ein Ausblick für die Zukunft, in dem deutlich wird, dass pflegewissenschaftlich noch viel getan werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Bachelorarbeit
- 1.3 Begrifflichkeit
- 2. Methodik
- 2.1 Bücher
- 2.2 Wissenschaftliche Datenbanken
- 3. Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Die Organtransplantation
- 3.1.1 Die geschichtliche Entwicklung der Organtransplantation
- 3.1.2 Die Bedeutung der Organspende
- 3.1.3 Das Transplantationsgesetz in Deutschland
- 3.1.4 Die Spendertauglichkeit
- 3.1.5 Die Akteure und die Wahl des Organempfängers
- 3.1.6 Der Ablauf der Organtransplantation
- 3.2 Das Konzept des totalen Hirnfunktionsausfalls
- 3.2.1 Definition
- 3.2.2 Die Diagnostik
- 3.1 Die Organtransplantation
- 4. Die Aufgaben der Transplantationspflege
- 5. Belastungen durch die Pflege von Organspendern
- 5.1 Psychische und emotionale Belastungen
- 5.1.1 Bedeutung des Hirntodkonzepts als sicheres Todeszeichen
- 5.1.2 Die Bedeutung der Freiwilligkeit
- 5.1.3 Das Modell der Ganzheitlichkeit im Kontext der Transplantationspflege
- 5.1.4 Die Würde des Organspenders
- 5.1.5 Gewissenskonflikte
- 5.1.6 Die Identifikation mit den hirntoten Patienten und Patientinnen
- 5.1.7 Die Betreuung der Angehörigen
- 5.1.8 Versagensgefühle
- 5.1.9 Die pflegerische Beziehung
- 5.1.10 Die Angst vor einer fehlerhaften Hirntoddiagnostik
- 5.1.11 Mangelhafte interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation
- 5.1.12 Die operative Organentnahme
- 5.1 Psychische und emotionale Belastungen
- 6. Hilfeangebote für Pflegende
- 6.1 Multidimensionale Gesprächsmöglichkeiten
- 6.2 Aus- und Weiterbildung
- 6.3 Seminare zur Angehörigenbetreuung
- 7. Aktualität der Thematik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die vielfältigen Belastungen von Pflegekräften, die Organspender betreuen. Ziel ist es, diese Belastungen zu identifizieren und zu beschreiben, um mögliche Hilfsangebote und Verbesserungsansätze aufzuzeigen.
- Psychische und emotionale Belastungen der Pflegekräfte
- Ethische Dilemmata im Kontext der Organspende
- Das Konzept des Hirntodes und seine Bedeutung für die Pflege
- Möglichkeiten der Unterstützung und Prävention von Belastungen
- Aktuelle Herausforderungen und zukünftige Perspektiven in der Transplantationspflege
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Belastungen von Pflegekräften bei der Betreuung von Organspendern ein. Es definiert die Zielsetzung der Arbeit und beschreibt den Aufbau. Die Begrifflichkeiten werden geklärt, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und den Rahmen der Untersuchung abzustecken.
2. Methodik: Dieses Kapitel erläutert die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit, insbesondere die verwendeten Quellen wie Bücher und wissenschaftliche Datenbanken. Es legt die Grundlage für die wissenschaftliche Fundiertheit der Untersuchung dar und beschreibt die Kriterien der Literaturauswahl.
3. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den notwendigen theoretischen Hintergrund über die Organtransplantation und das Konzept des Hirntodes. Es beschreibt die geschichtliche Entwicklung, das Transplantationsgesetz, die Spendertauglichkeit, den Ablauf der Organtransplantation sowie die Definition und Diagnostik des Hirntodes. Dieses Kapitel dient als Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel.
4. Die Aufgaben der Transplantationspflege: Dieses Kapitel beschreibt die spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Pflegekräfte in der Transplantationspflege. Es beleuchtet die Besonderheiten der Pflege von Organspendern und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Aufgaben werden im Kontext der gesamten Prozesskette beschrieben, von der Diagnose bis zur Organentnahme.
5. Belastungen durch die Pflege von Organspendern: Dieser zentrale Abschnitt der Arbeit analysiert ausführlich die vielfältigen psychischen und emotionalen Belastungen, denen Pflegekräfte bei der Betreuung von Organspendern ausgesetzt sind. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie die Auseinandersetzung mit dem Hirntodkonzept, ethische Konflikte, die Würde des Spenders, die Betreuung der Angehörigen und die Herausforderungen der interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Kapitelteile gehen detailliert auf einzelne Belastungsfaktoren ein und untermauern dies mit aktuellen Forschungsergebnissen.
6. Hilfeangebote für Pflegende: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten für Pflegekräfte, die mit den beschriebenen Belastungen konfrontiert sind. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, wie multidimensionale Gesprächsmöglichkeiten, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Seminare zur Angehörigenbetreuung. Die Kapitelteile beleuchten die Bedeutung und den Stellenwert dieser Hilfsangebote für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die psychische Gesundheit der Pflegekräfte.
7. Aktualität der Thematik: Dieses Kapitel diskutiert die aktuelle Relevanz der Thematik und deren Bedeutung für die Praxis der Transplantationspflege. Es beleuchtet die aktuellen Herausforderungen und den Bedarf an weiteren Forschungsaktivitäten.
Schlüsselwörter
Organtransplantation, Organspende, Hirntod, Transplantationspflege, psychische Belastung, emotionale Belastung, ethische Dilemmata, Pflegekräfte, Hilfsangebote, Aus- und Weiterbildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Würde des Menschen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Belastungen in der Transplantationspflege
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die vielfältigen Belastungen von Pflegekräften, die Organspender betreuen. Im Fokus stehen die Identifizierung und Beschreibung dieser Belastungen, um daraus mögliche Hilfsangebote und Verbesserungsansätze abzuleiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die psychischen und emotionalen Belastungen der Pflegekräfte, ethische Dilemmata im Kontext der Organspende, das Hirntodkonzept und seine Bedeutung für die Pflege, Möglichkeiten der Unterstützung und Prävention von Belastungen sowie aktuelle Herausforderungen und zukünftige Perspektiven in der Transplantationspflege.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturrecherche, die Bücher und wissenschaftliche Datenbanken umfasst. Die Auswahlkriterien für die Literatur werden im Kapitel Methodik detailliert beschrieben.
Welche theoretischen Grundlagen werden gelegt?
Der theoretische Teil beleuchtet die Organtransplantation (geschichtliche Entwicklung, Transplantationsgesetz, Spendertauglichkeit, Ablauf), das Konzept des totalen Hirnfunktionsausfalls (Definition, Diagnostik) und die Bedeutung dieser Konzepte für die Pflege von Organspendern.
Welche Aufgaben der Transplantationspflege werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die spezifischen Aufgaben und Herausforderungen der Pflege von Organspendern, von der Diagnose bis zur Organentnahme, und setzt diese in den Kontext der gesamten Prozesskette.
Welche Belastungen für Pflegekräfte werden identifiziert?
Kapitel 5 analysiert detailliert die psychischen und emotionalen Belastungen. Hierzu gehören die Auseinandersetzung mit dem Hirntodkonzept, ethische Konflikte, die Würde des Spenders, die Betreuung der Angehörigen und Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Einzelne Belastungsfaktoren werden mit aktuellen Forschungsergebnissen untermauert.
Welche Hilfsangebote für Pflegende werden vorgestellt?
Kapitel 6 präsentiert verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, wie multidimensionale Gesprächsangebote, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und Seminare zur Angehörigenbetreuung, um die Arbeitsbedingungen und die psychische Gesundheit der Pflegekräfte zu verbessern.
Welche Aktualität hat die Thematik?
Das letzte Kapitel diskutiert die aktuelle Relevanz der Thematik und den Bedarf an weiterer Forschung in der Transplantationspflege, unter Berücksichtigung aktueller Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Organtransplantation, Organspende, Hirntod, Transplantationspflege, psychische Belastung, emotionale Belastung, ethische Dilemmata, Pflegekräfte, Hilfsangebote, Aus- und Weiterbildung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Würde des Menschen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Methodik, Theoretischer Hintergrund, Aufgaben der Transplantationspflege, Belastungen durch die Pflege von Organspendern, Hilfeangebote für Pflegende und Aktualität der Thematik. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel genauer beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Melanie Schieck (Autor:in), 2016, Die Pflege von Organspendern und die einhergehenden vielfältigen Belastungen für Pflegekräfte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1292468