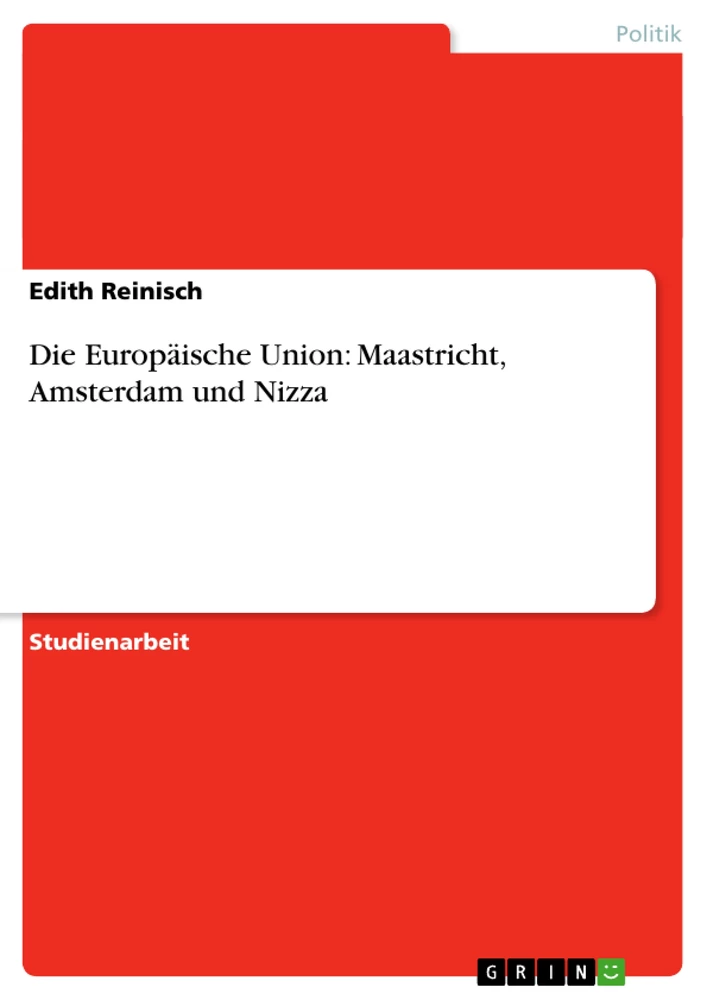Zwischen 1973 und 1984 gibt es eine besondere Krisenphase in der europäischen Integration. Die Staaten der 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) fallen teilweise in eine nationale Wirtschaftspolitik zurück. Der deutsche Nationalökonom Herbert Giersch prägt in diesem Zusammenhang den Begriff der „Eurosklerose“.
Intensiviert wird die Konjunkturverschlechterung durch die Ölkrisen in Folge des Jom-Kippur-Kriegs 1973 und der iranischen Revolution 1979. Hinzu tritt die internationale Währungskrise, die 1973 durch den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems ausgelöst wird und zu großen Wechselkursschwankungen zwischen den europäischen Ländern führt.
Ende 1985 einigen sich die Mitgliedsstaaten auf ein umfangreiches Reformpaket, um die europäische Integration wiederzubeleben. Diese Einheitliche Europäische Akte (EEA) wird 1986 verabschiedet und tritt im folgenden Jahr in Kraft. Sie enthält unter anderem das Projekt eines gemeinsamen europäischen Binnenmarkts mit weitgehend einheitlichen Regeln und Wettbewerbsbedingungen und zieht damit die politischen Konsequenzen aus den Erfahrungen während der Krise. Vor allem aber enthält die EEA eine erste Erweiterung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments und die Wiederaufnahme des 1969 in Den Haag beschlossenen Plans einer Europäischen Politischen Zusammenarbeit zur außenpolitischen Koordinierung der EWG-Staaten.
Seit 1970 besteht eine informelle Zusammenarbeit im außenpolitischen Bereich, die im sog. „Davignon-Bericht“ gründet. Sie hat eine Abstimmung der Außenpolitik durch ständige Treffen der Außenminister zum Gegenstand, die durch regelmäßige Konsultationen und ständige Kontakte der zuständigen Behörden ergänzt wurden. Das System der EPZ war von Anfang an auf eine Weiterentwicklung ausgerichtet. Dadurch wird der nächste Schritt ausgelöst, der durch den Vertrag von Maastricht erfolgt, durch den es zu mehr Gemeinsamkeit unter Einbeziehung der Fragen der Sicherheitspolitik kommt. Die EPZ wird zur zweiten Säule der Europäischen Union, nämlich zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Vertrag von Maastricht
- 3. Die weitere Entwicklung im Vertrag von Amsterdam
- 4. Die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) bis zum Vertrag von Nizza
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik von den Anfängen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bis zum Vertrag von Nizza. Sie beleuchtet die Herausforderungen der europäischen Integration im Kontext von Wirtschaftskrisen und der Notwendigkeit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Der Fokus liegt auf den Verträgen von Maastricht, Amsterdam und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur.
- Die Eurosklerose und die Wiederbelebung der europäischen Integration
- Die Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
- Die Rolle der Verträge von Maastricht und Amsterdam
- Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)
- Die Herausforderungen der zwischenstaatlichen Organisation der Außen- und Sicherheitspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Krise der europäischen Integration zwischen 1973 und 1984, die als „Eurosklerose“ bezeichnet wurde. Die Ölkrisen, die internationale Währungskrise und eine Rückbesinnung auf nationale Wirtschaftspolitik verschärften die Situation. Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986, die einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt zum Ziel hatte, markierte einen Wendepunkt und leitete die Wiederbelebung der europäischen Integration ein. Die EEA erweiterte die Kompetenzen des Europäischen Parlaments und reaktivierte die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) zur außenpolitischen Koordinierung. Die informelle Zusammenarbeit im außenpolitischen Bereich, basierend auf dem „Davignon-Bericht“, bildete die Grundlage für die spätere GASP.
2. Die GASP im Vertrag von Maastricht (Der EU-Vertrag): Das Kapitel behandelt den Vertrag von Maastricht (1992), der die Europäische Union (EU) gründete und die GASP als zweite Säule einführte. Obwohl die außenpolitischen Kompetenzen bei den Mitgliedsstaaten blieben, verpflichteten sie sich zu aktiver und vorbehaltloser Unterstützung der GASP im Geiste der Loyalität und gegenseitigen Solidarität. Die Verteidigungspolitik wurde erstmals in die GASP miteinbezogen. Die Rolle der Kommission und des Europäischen Parlaments wurde geregelt. Das Kapitel beschreibt außerdem die Instrumente der GASP (gemeinsame Standpunkte und gemeinsame Aktionen) und die pragmatische Vorgehensweise beim Ausbau der GASP, wie beim Europäischen Rat in Brüssel 1993 beschlossen.
3. Die weitere Entwicklung im Vertrag von Amsterdam: Dieses Kapitel analysiert den Vertrag von Amsterdam (1997), der den Vertrag von Maastricht ergänzte. Die Außen- und Sicherheitspolitik blieb zwischenstaatlich organisiert, aber der Vertrag enthielt wichtige Neuerungen: das Kohärenzgebot, die Schaffung des Hohen Vertreters für die GASP, eine Strategieplanungs- und Frühwarneinheit, die Erweiterung des Handlungsinstrumentariums und die Finanzierung der GASP-Ausgaben. Das Kapitel betont auch die Beziehung zwischen der ESVP und der NATO sowie die Rolle der Westeuropäischen Union (WEU) bei der Umsetzung von Entscheidungen mit verteidigungspolitischen Bezügen, inklusive der Petersberg-Aufgaben (humanitäre Aufgaben, Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben und Kampfeinsätze).
Schlüsselwörter
Europäische Union, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Vertrag von Maastricht, Vertrag von Amsterdam, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Eurosklerose, Europäische Integration, zwischenstaatliche Zusammenarbeit, Petersberg-Aufgaben, Westeuropäische Union (WEU), Kohärenzgebot.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Außenpolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik von den Anfängen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bis zum Vertrag von Nizza. Der Fokus liegt dabei auf den Verträgen von Maastricht und Amsterdam und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der europäischen Integration im Kontext von Wirtschaftskrisen und der Notwendigkeit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.
Welche Phasen der Entwicklung werden behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Phasen: Die „Eurosklerose“ der 1970er und 80er Jahre, die mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) überwunden wurde; die Einführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Vertrag von Maastricht; die Weiterentwicklung der GASP im Vertrag von Amsterdam; und schließlich die Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) bis zum Vertrag von Nizza. Dabei wird auch die Rolle der Westeuropäischen Union (WEU) und die Beziehung zur NATO beleuchtet.
Welche Rolle spielt der Vertrag von Maastricht?
Der Vertrag von Maastricht (1992) begründete die Europäische Union (EU) und führte die GASP als zweite Säule ein. Obwohl die außenpolitischen Kompetenzen bei den Mitgliedsstaaten blieben, verpflichteten sie sich zu aktiver Unterstützung der GASP. Der Vertrag regelte die Rolle der Kommission und des Europäischen Parlaments und definierte Instrumente wie gemeinsame Standpunkte und gemeinsame Aktionen. Die Verteidigungspolitik wurde erstmals in die GASP miteinbezogen.
Was sind die wichtigsten Neuerungen des Vertrags von Amsterdam?
Der Vertrag von Amsterdam (1997) ergänzte den Vertrag von Maastricht. Die Außen- und Sicherheitspolitik blieb zwar zwischenstaatlich organisiert, enthielt aber wichtige Neuerungen: das Kohärenzgebot, den Hohen Vertreter für die GASP, eine Strategieplanungs- und Frühwarneinheit, ein erweitertes Handlungsinstrumentarium und die Finanzierung der GASP-Ausgaben. Der Vertrag betonte auch die Beziehung zwischen ESVP und NATO sowie die Rolle der WEU bei der Umsetzung verteidigungspolitischer Entscheidungen, inklusive der Petersberg-Aufgaben.
Was sind die Petersberg-Aufgaben?
Die Petersberg-Aufgaben umfassen humanitäre und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Maßnahmen und Kampfeinsätze. Sie spielen eine wichtige Rolle im Kontext der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) und wurden im Vertrag von Amsterdam im Zusammenhang mit der Rolle der Westeuropäischen Union (WEU) hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Union, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Vertrag von Maastricht, Vertrag von Amsterdam, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Eurosklerose, Europäische Integration, zwischenstaatliche Zusammenarbeit, Petersberg-Aufgaben, Westeuropäische Union (WEU), Kohärenzgebot.
Wie wird die "Eurosklerose" beschrieben?
Die „Eurosklerose“ beschreibt eine Krise der europäischen Integration zwischen 1973 und 1984, gekennzeichnet durch Ölkrisen, internationale Währungskrisen und eine Rückbesinnung auf nationale Wirtschaftspolitik. Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986 markierte einen Wendepunkt und leitete die Wiederbelebung der europäischen Integration ein.
- Citar trabajo
- Edith Reinisch (Autor), 2009, Die Europäische Union: Maastricht, Amsterdam und Nizza, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129195