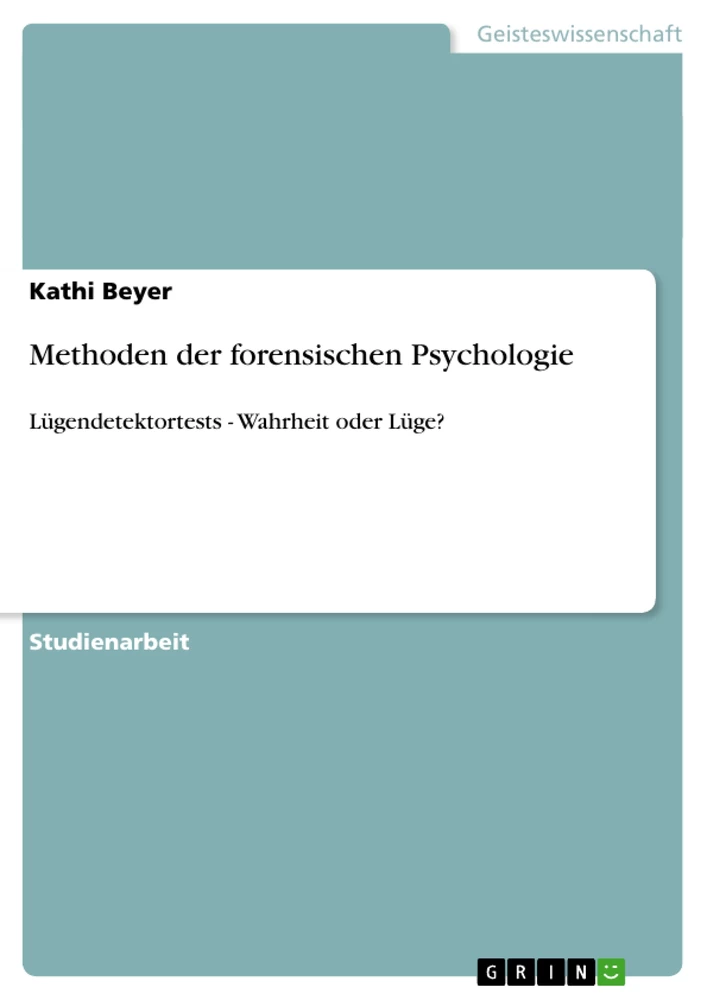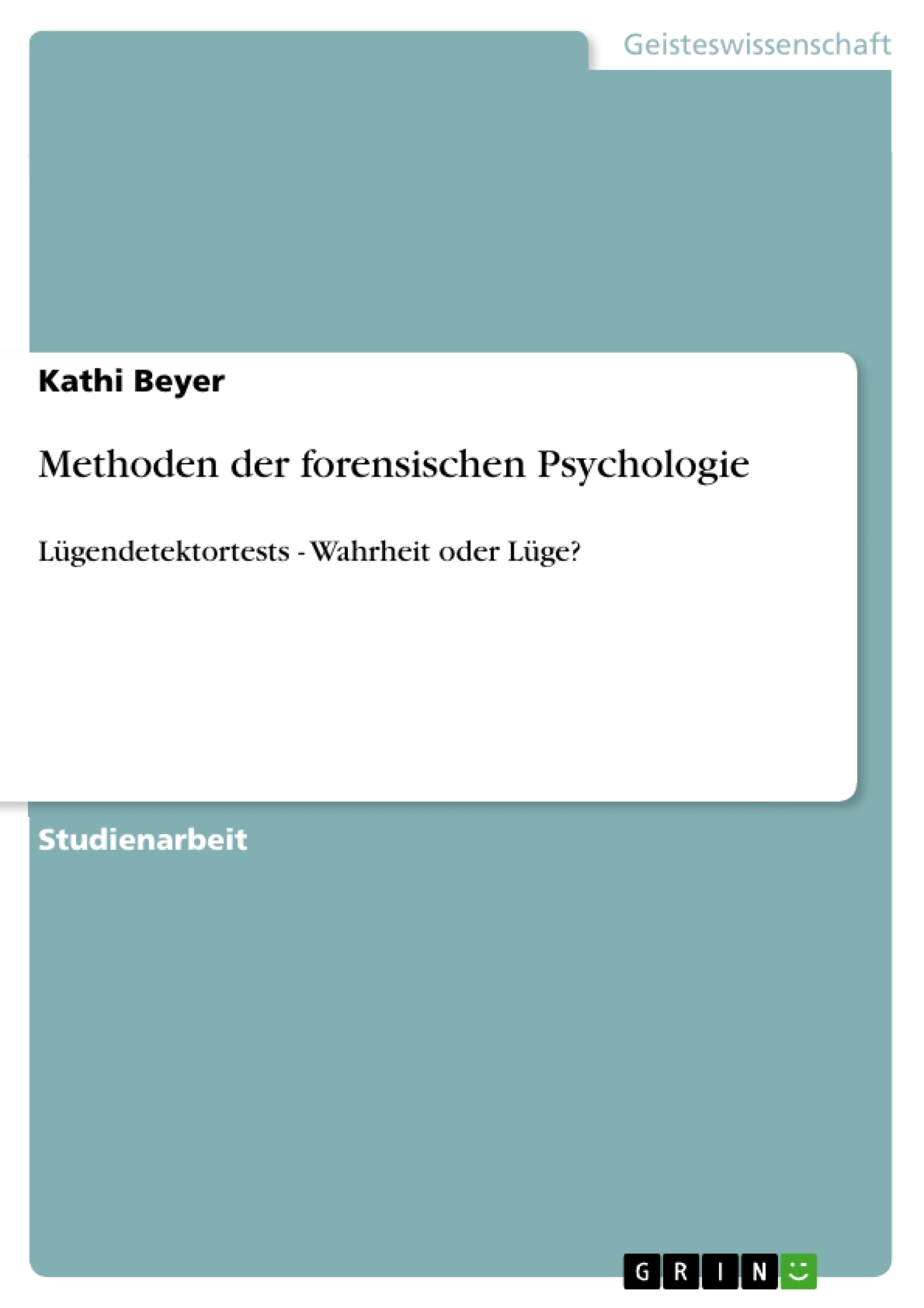Die forensische Psychologie ist ein Teilbereich der Angewandten Psychologie und
beschäftigt sich mit Aufgaben innerhalb der Gerichtspraxis (auch:
Gerichtspsychologie). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit den
Methoden der Forensischen Psychophysiologie und der Diskussion über deren
Verwertbarkeit in der deutschen Gerichtspraxis.
Unter dem Begriff „Forensische Psychophysiologie“, vermag sich ein Laie wenig
vorzustellen, obwohl es sich dabei um ein Teilgebiet der Empirischen Psychologie
handelt, das seinen Weg bereits in die amerikanische Justiz, die japanischen
polizeilichen Ermittlungsarbeiten und in die deutsche Zivilgerichtsbarkeit gefunden
hat.
Selbst in Unterhaltungssendungen („Talkshows“) deutscher und ausländischer
Fernsehsender haben Methoden der Forensischen Psychophysiologie inzwischen
Einzug gehalten. Umgangsprachlich verbirgt sich hinter dem Begriff der
Forensischen Psychophysiologie der Begriff der „Lügendetektion“, der
„Lügendetektortests“ oder der „Polygraphentest“.
Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die Methoden der Forensischen
Psychophysiologie und deren Anwendbarkeit geben. In diesem Rahmen beschäftigt
sie sich insbesondere mit der Methode des Kontrollfragentests.
Obwohl sich diese Arbeit mit Kritikern und Befürwortern der Methode
auseinandersetzt, verfolgt sie ausdrücklich nicht das Ziel eines Plädoyers für oder
gegen die Anwendbarkeit des Polygraphentests in der deutschen Gerichtsbarkeit, sie
soll lediglich einen Überblick über wesentliche Problemstellungen und Chancen der
Methode geben.
Um das zu leisten ist es vonnöten, mit den Grundzügen der Forensischen
Psychophysiologie vertraut zu sein (Kap. 2), mögliche Anwendungsfelder zu
berücksichtigen (Kap. 3) und die Rechtslage in Deutschland zu kennen (Kap. 4).
Ferner ist es für das Verständnis wesentlicher Problemstellungen und Chancen (Kap.
1.2.7 und Kap. 1.2.8) unabdingbar, über Kenntnisse der Grundzüge der Methode zu
verfügen (Kap. 5).
Inhaltsverzeichnis
- Forensische Psychologie
- Eine Definition
- Mögliche Anwendungsbereiche
- Die Rechtslage in Deutschland
- Methoden der Forensischen Psychophysiologie
- Der Tatwissentest
- Der Kontrollfragentest
- Die Logik
- Die Struktur
- Die Messung
- Die Beurteilung der Messergebnisse
- Die Auswertung
- Das Nachtestinterview
- Kritiker
- Befürworter
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Methoden der forensischen Psychophysiologie, insbesondere den Kontrollfragentest, und deren Anwendbarkeit in der deutschen Gerichtspraxis. Sie analysiert die Methode, berücksichtigt Kritik und Befürwortung, ohne ein explizites Plädoyer für oder gegen deren Verwendung abzugeben. Der Fokus liegt auf der Darstellung der wesentlichen Herausforderungen und Chancen dieser Methode.
- Definition und Grundlagen der Forensischen Psychophysiologie
- Mögliche Anwendungsbereiche des Polygraphentests
- Die Rechtslage in Deutschland bezüglich der Verwertbarkeit psychophysiologischer Ergebnisse
- Detaillierte Beschreibung des Kontrollfragentests
- Kritik und Befürwortung des Kontrollfragentests
Zusammenfassung der Kapitel
Forensische Psychologie: Dieser Abschnitt führt in das Gebiet der forensischen Psychologie ein, definiert sie als Teilbereich der angewandten Psychologie, der sich mit der Gerichtspraxis befasst. Es wird besonders auf die forensische Psychophysiologie eingegangen, deren Methoden – insbesondere der Lügendetektor – bereits in verschiedenen Ländern und auch in der deutschen Zivilgerichtsbarkeit Anwendung finden. Die Arbeit kündigt ihren Fokus auf die Methoden der forensischen Psychophysiologie und deren Anwendbarkeit an, mit besonderem Augenmerk auf den Kontrollfragentest.
Eine Definition: Dieses Kapitel definiert die forensische Psychophysiologie (auch Lügendetektion) als Methode, die anhand körperlicher Reaktionen auf Reize diagnostische Schlussfolgerungen über die Glaubhaftigkeit von Aussagen trifft. Es wird betont, dass der Polygraph lediglich körperliche Reaktionen misst, die einer wissenschaftlichen Interpretation bedürfen. Die irreführende Bezeichnung „Lügendetektion“ wird kritisiert, da kein eindeutiges physiologisches Muster für eine Lüge existiert. Stattdessen wird die Methode als Vergleich verschiedener Reize dargestellt, deren physiologische Erregungsdifferenz interpretiert werden muss.
Mögliche Anwendungsbereiche: Dieser Abschnitt nennt als Anwendungsbeispiel den Bereich des Sorgerechts und Umgangsrechts bei Scheidungen mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Hier ist es oft schwierig, Vorwürfe zu entkräften, weshalb Polygraphentests als Hilfsmittel eingesetzt werden. Die zunehmende Akzeptanz in der Zivilgerichtsbarkeit führte zu einer Stellungnahme des Bundesgerichtshofs (BGH).
Die Rechtslage in Deutschland: Dieses Kapitel behandelt das Urteil des BGH vom 17.12.1998 zur strafgerichtlichen Verwertbarkeit psychophysiologischer Methoden. Es wird festgehalten, dass die freiwillige Teilnahme an einer polygraphischen Untersuchung nicht gegen Verfassungsgrundsätze verstößt. Die Ergebnisse des Kontrollfragentests und des Tatwissentests sind jedoch im Zeitpunkt der Hauptverhandlung zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Forensische Psychophysiologie, Lügendetektion, Polygraphentest, Kontrollfragentest, Tatwissentest, Aussagebegutachtung, Glaubhaftigkeit, Rechtslage Deutschland, Bundesgerichtshof (BGH), Anwendungsbereiche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Forensische Psychophysiologie - Kontrollfragentest
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die forensische Psychophysiologie, insbesondere den Kontrollfragentest. Er beleuchtet die Definition, Anwendungsbereiche, die Rechtslage in Deutschland und die methodischen Aspekte des Kontrollfragentests, inklusive Kritik und Befürwortung. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Herausforderungen und Chancen dieser Methode.
Was ist forensische Psychophysiologie?
Forensische Psychophysiologie, oft auch als Lügendetektion bezeichnet, ist eine Methode, die anhand körperlicher Reaktionen auf Reize diagnostische Schlussfolgerungen über die Glaubhaftigkeit von Aussagen zieht. Es wird betont, dass der Polygraph nur körperliche Reaktionen misst, die einer wissenschaftlichen Interpretation bedürfen. Die Bezeichnung „Lügendetektion“ ist irreführend, da kein eindeutiges physiologisches Muster für eine Lüge existiert.
Welche Anwendungsbereiche werden genannt?
Ein genanntes Anwendungsbeispiel ist der Bereich des Sorgerechts und Umgangsrechts bei Scheidungen mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Die zunehmende Akzeptanz in der Zivilgerichtsbarkeit führte zu einer Stellungnahme des Bundesgerichtshofs (BGH).
Wie ist die Rechtslage in Deutschland bezüglich der Verwertbarkeit psychophysiologischer Ergebnisse?
Der Text bezieht sich auf das Urteil des BGH vom 17.12.1998. Demnach verstößt die freiwillige Teilnahme an einer polygraphischen Untersuchung nicht gegen Verfassungsgrundsätze. Die Ergebnisse des Kontrollfragentests und des Tatwissentests sind jedoch im Zeitpunkt der Hauptverhandlung zu berücksichtigen.
Was ist der Kontrollfragentest?
Der Text beschreibt den Kontrollfragentest detailliert, einschließlich seiner Logik, Struktur, Messung, Beurteilung der Messergebnisse, Auswertung und des Nachtestinterviews. Er berücksichtigt auch die Kritik und Befürwortung dieser Methode.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Forensische Psychophysiologie, Lügendetektion, Polygraphentest, Kontrollfragentest, Tatwissentest, Aussagebegutachtung, Glaubhaftigkeit, Rechtslage Deutschland, Bundesgerichtshof (BGH), Anwendungsbereiche.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel zu Forensischer Psychologie, einer Definition der forensischen Psychophysiologie, möglichen Anwendungsbereichen, der Rechtslage in Deutschland und detailliert den Kontrollfragentest. Ein Literaturverzeichnis wird ebenfalls erwähnt.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, einen Überblick über die Methoden der forensischen Psychophysiologie, insbesondere den Kontrollfragentest, und deren Anwendbarkeit in der deutschen Gerichtspraxis zu geben. Er analysiert die Methode, berücksichtigt Kritik und Befürwortung, ohne ein explizites Plädoyer abzugeben. Der Fokus liegt auf der Darstellung der wesentlichen Herausforderungen und Chancen dieser Methode.
- Quote paper
- Kathi Beyer (Author), 2007, Methoden der forensischen Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128683