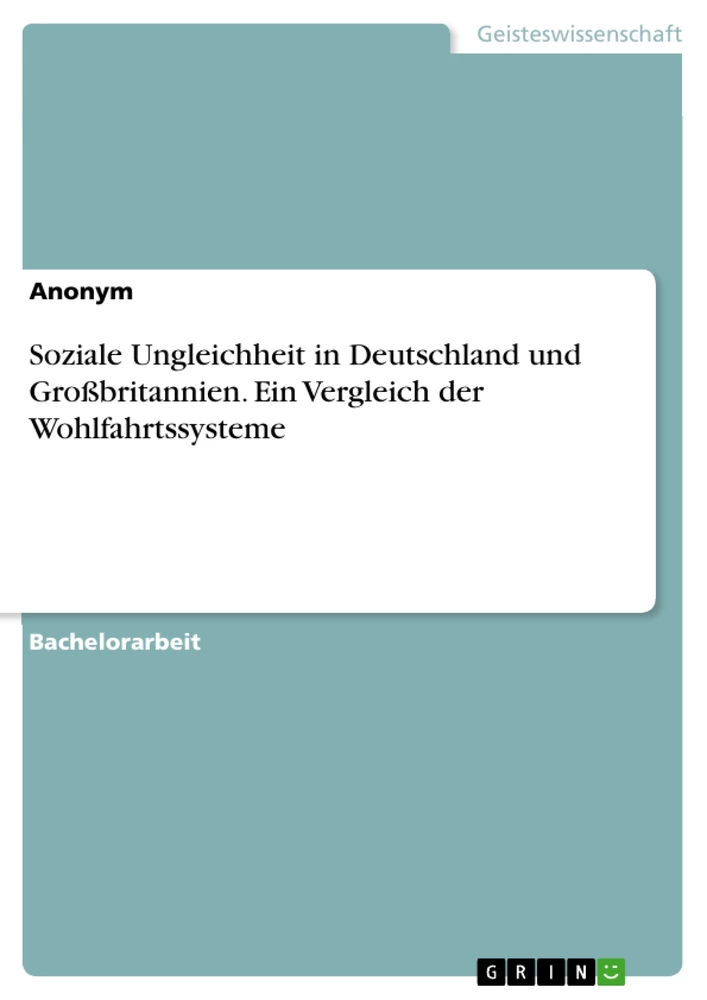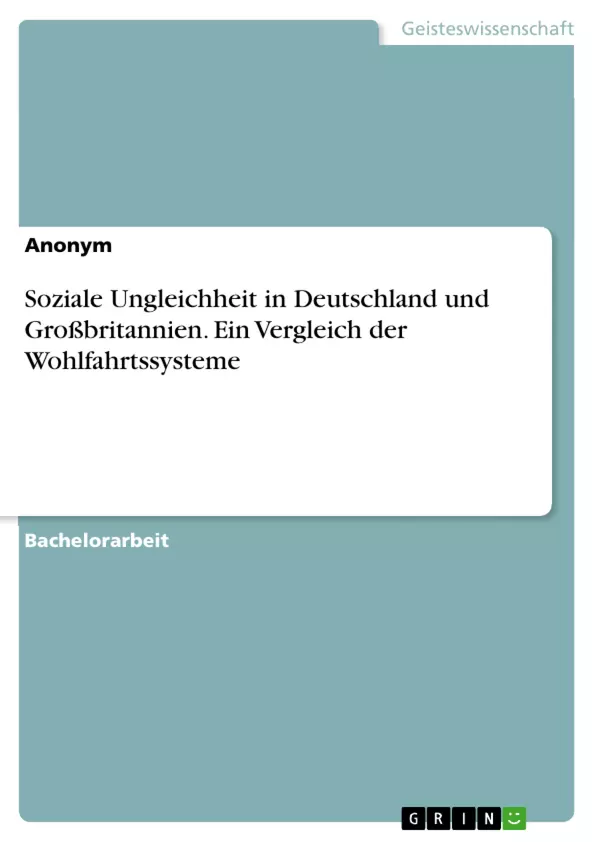Was genau ist unter sozialer Ungleichheit zu verstehen? Was sind ihre Dimensionen? Und wie zeigt sich soziale Ungleichheit konkret in unterschiedlichen sozialstaatlichen Systemen? In welchen Bereichen sind diese angesiedelt und welche Bevölkerungsgruppen sind besonders davon betroffen? Welche Erkenntnisse lassen sich daraus ziehen? Und nebenbei – was bedeutet das für die Soziale Arbeit? Das Ziel dieser Arbeit ist es, Bereiche sozialer Ungleichheit in den Wohlfahrtssystemen in Deutschland und Großbritannien herauszuarbeiten und in einem abschließenden Vergleich zu analysieren, wo sich in den beiden Sozialsystemen soziale Ungleichheiten ansiedeln.
Die Präsenz des Themas soziale Ungleichheit ist allgegenwärtig und in vielen Industrieländern von besonderer Relevanz. Es ist zu beobachten, dass auch hier soziale Ungleichheiten wachsen und zunehmend mehr Menschen als arm gelten. So ergeben sich auch in vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit Berührungspunkte mit Personen, die von sozialer Ungleichheit betroffen sind. Denn soziale Probleme entstehen oftmals infolge eines Mangels an Bildung, Armut, Erwerbs- oder Wohnungslosigkeit. Daraus ergibt sich für die Soziale Arbeit die Aufgabe, die durch soziale Ungleichheit entstehenden ungleichen Lebensbedingungen von Klienten zu lindern oder je nach Arbeitsfeld auch ungleiche gesellschaftliche Bedingungen zu ändern.
Für eine in der Sozialen Arbeit tätige Person besteht die Notwendigkeit, dieses Thema zu reflektieren, um die Lebenswelt der Betroffenen im ganzheitlichen System besser verstehen zu können. Das Problem der sozialen Ungleichheit stellt den Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Es wird anhand der Untersuchung und des Vergleichs zweier verschiedener sozialstaatlicher Systeme – das Deutschlands und das Großbritanniens – beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Definition sozialer Ungleichheit
- Klassen- und Schichttheorien
- Wohlfahrtssysteme im Vergleich
- Typologie nach Esping-Andersen
- Das Bismarck-Modell in Deutschland
- Das Beveridge-Modell in Großbritannien
- Institutionelle und politische Rahmenbedingungen
- Soziale Sicherung und Bildung in Deutschland
- Besonderheiten der deutschen Sozialpolitik
- Soziale Sicherung und Bildung in Großbritannien
- Besonderheiten der britischen Sozialpolitik
- Soziale Ungleichheit innerhalb Deutschlands
- Gesundheit
- Berufliche Integration und Erwerbsstatus
- Bildung
- Armut
- Soziale Ungleichheit innerhalb Großbritanniens
- Gesundheit
- Berufliche Integration und Erwerbsstatus
- Bildung
- Armut
- Deutsch-britischer Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Vergleich der sozialen Ungleichheit innerhalb und zwischen Deutschland und Großbritannien
- Gesundheit
- Berufliche Integration und Erwerbsstatus
- Bildung
- Armut
- Soziale Ungleichheit zwischen den beiden Vergleichsländern im Überblick bei Betrachtung von drei Ungleichheitsmaßen
- Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema soziale Ungleichheit im deutsch-britischen Vergleich. Ziel ist es, die verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheit in beiden Ländern zu analysieren und zu vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
- Typologisierung von Wohlfahrtssystemen
- Institutionelle und politische Rahmenbedingungen
- Soziale Sicherungssysteme im Vergleich
- Bildungssysteme und deren Einfluss auf soziale Ungleichheit
- Dimensionen der sozialen Ungleichheit im deutsch-britischen Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Soziale Ungleichheit ein und stellt den Rahmen für die Arbeit dar. Sie definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und erläutert die Bedeutung des deutsch-britischen Vergleichs.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit verschiedenen Klassen- und Schichttheorien, die zur Erklärung sozialer Ungleichheit beitragen. Es werden klassische und moderne Theorien vorgestellt und ihre Relevanz für die Analyse der sozialen Ungleichheit in Deutschland und Großbritannien diskutiert.
Kapitel 3 analysiert die Wohlfahrtssysteme der beiden Vergleichsländer. Es werden die Typologien nach Esping-Andersen vorgestellt und die beiden Systeme in diese Typologien eingeordnet. Die Kapitel diskutieren die spezifischen Merkmale der Bismarck- und Beveridge-Modelle sowie die Unterschiede in der Organisation und Finanzierung der Sozialsysteme.
Kapitel 4 behandelt die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen, die die soziale Ungleichheit in Deutschland und Großbritannien beeinflussen. Es werden die wichtigsten Gesetze, Richtlinien und Institutionen vorgestellt und deren Einfluss auf die soziale Ungleichheit in den beiden Ländern beleuchtet.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der sozialen Ungleichheit innerhalb Deutschlands. Es werden die Bereiche Gesundheit, berufliche Integration und Erwerbsstatus, Bildung und Armut näher betrachtet. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Ungleichheitsmuster und stellen relevante Statistiken und Studien vor.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit der sozialen Ungleichheit innerhalb Großbritanniens und beleuchtet ebenfalls die Bereiche Gesundheit, berufliche Integration und Erwerbsstatus, Bildung und Armut. Es werden die jeweiligen Ungleichheitsmuster analysiert und statistische Daten sowie Studien vorgestellt.
Kapitel 7 schließlich widmet sich dem deutsch-britischen Vergleich. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der sozialen Ungleichheit innerhalb und zwischen den beiden Ländern herausgestellt. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Ungleichheitsmuster in Bezug auf Gesundheit, berufliche Integration und Erwerbsstatus, Bildung und Armut.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der sozialen Ungleichheit im deutsch-britischen Vergleich. Die zentralen Themen sind: Wohlfahrtsstaaten, Bismarck-Modell, Beveridge-Modell, soziale Sicherung, Bildungssystem, Gesundheit, berufliche Integration, Erwerbsstatus, Armut, Ungleichheitsindikatoren, Datenanalyse, vergleichende Sozialforschung.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Wohlfahrtssysteme von Deutschland und Großbritannien?
Deutschland folgt dem Bismarck-Modell (beitragsfinanzierte Sozialversicherung), während Großbritannien das Beveridge-Modell (steuerfinanzierte Grundsicherung) nutzt.
Welche Dimensionen sozialer Ungleichheit werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die Bereiche Gesundheit, Bildung, berufliche Integration (Erwerbsstatus) und Armut.
Was ist die Typologie nach Esping-Andersen?
Es ist ein Modell zur Klassifizierung von Wohlfahrtsstaaten in liberale, konservative und sozialdemokratische Regime.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei sozialer Ungleichheit?
Soziale Arbeit hat die Aufgabe, Lebensbedingungen zu lindern, die durch Bildungsmangel, Armut oder Wohnungslosigkeit entstehen, und gesellschaftliche Bedingungen zu reflektieren.
Warum wächst die soziale Ungleichheit in Industrieländern?
Die Arbeit analysiert institutionelle und politische Rahmenbedingungen, die trotz Sozialsystemen zu wachsender Armut und ungleichen Lebenschancen führen.
Wie hängen Bildung und soziale Ungleichheit zusammen?
In beiden Ländern ist Bildung ein zentraler Faktor: Ein Mangel an Bildung korreliert stark mit Arbeitslosigkeit und einem höheren Armutsrisiko.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Soziale Ungleichheit in Deutschland und Großbritannien. Ein Vergleich der Wohlfahrtssysteme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1285452