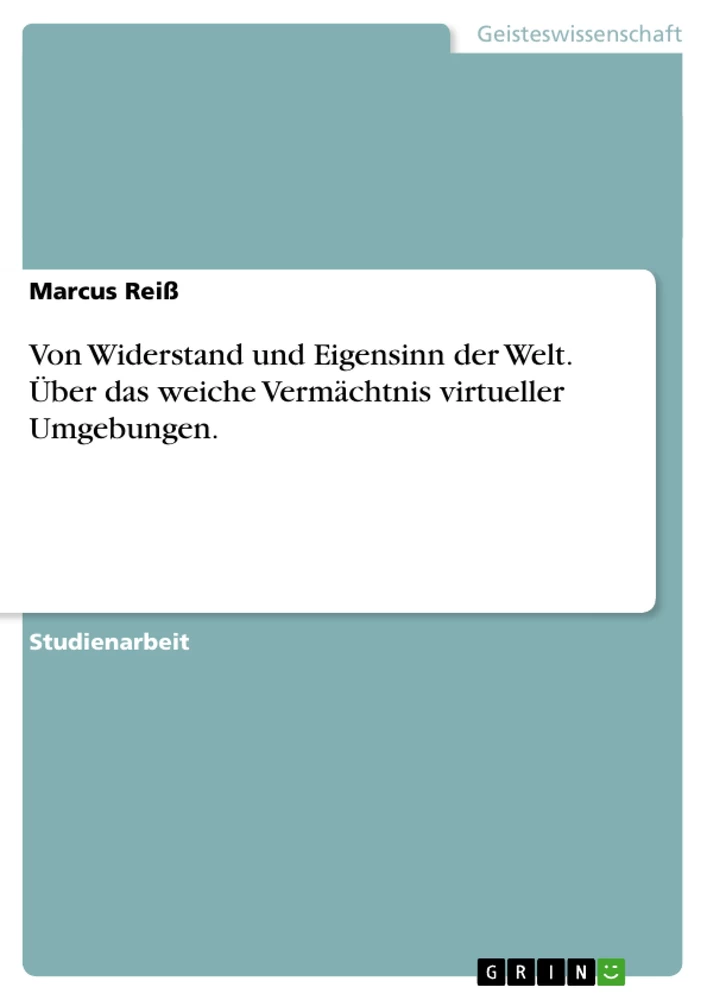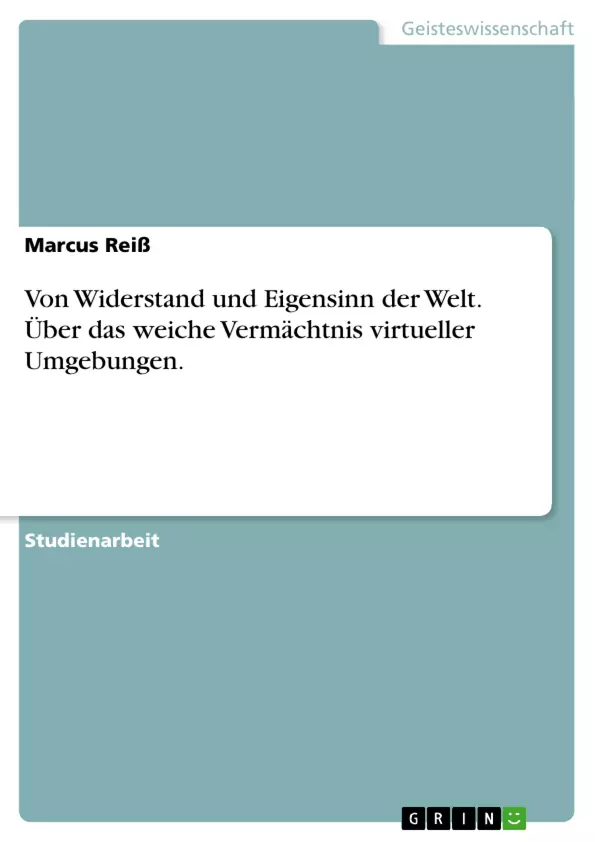Ausgangspunkt unseres Ausfluges in die Eigenheiten der Sinne wird eine Schrift sein, die in einmaliger Weise aufzeigt, wie Wahrnehmung aus einer phänomenologischen Perspektive sich zeigt, wie sie uns erscheint. Maurice Merleau-Ponty liefert mit seiner „Phänomenologie der Wahrnehmung“ ein Dokument, das sich in seiner einmaligen Vielfalt auch nahezu 60 Jahre nach der Ersterscheinung dazu eignet, Unzulänglichkeiten gängiger und populärer Meinungen bezüglich des Status und der Bedeutung unserer Wahrnehmung aufzuweisen und zu korrigieren. Wir wählen diese Schrift deshalb, weil es eine zentrale Fragestellung des französischen Autors ist, wie die Empfindungen dazu beitragen eine Welt zu erfahren, die undurchdringlich und unfertig ist und dabei jeden Bereich stellt, in dem wir leben. Die Bedeutung der Wahrnehmung ist dabei eine grundlegende, ihr Modus ist, wie noch zu zeigen sein wird, der einer „originären Erfahrungsweise“ (PdW,254)1.
Der erste Teil der Untersuchung widmet sich dem Leib als Ursprung unseres Verhältnisses zur Welt. Nach einer kurzen Überschau leiblicher Typiken werden die einzelnen Sinne isoliert dargestellt, dies unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktion für die Erfahrung von Widerstand innerhalb der Lebenswelt. Schließlich bleibt zu klären, wie sinnliche Leistungen erfahren werden und warum intellektualistische wie auch empirische Verfahren zur Bestimmung ihrer Eigenheiten die Gänze des Phänomens nicht zu umfassen vermögen.
Danach wenden wir unsere Erkenntnisse an auf Umgebungen, die in einem weiten Sinne als „virtuelle“ zu bezeichnen sind. Wir sind um die Beantwortung der Frage bemüht, inwiefern diese Medien, diese Spielarten bildlicher Darstellungen uns Widerstand bieten können. Beleuchtet wird deren Beschaffenheit immer im Kontrast zu zentralen Thesen Merleau-Pontys.2 Daran anknüpfend verlagert sich der Themenschwerpunkt auf Mikrotechnologien, die gezielt um, im oder sogar als Leib „arrangiert“ werden, um Nuancierungen oder Perfektionierungen jeglicher Wahrnehmungen vorzunehmen und dabei aber vielfach auf Grenzen stoßen, die nicht zu umgehen sind. Materialität und Widerständigkeit scheinen dort nur denkbar als gedachte Momente.
Letztlich wird zu zeigen versucht, warum virtuelle „Welten“ streng genommen keine Welten sind. Ob Mißverständnis, begriffliche Unschärfe oder gar Absicht: Jene imaginären Welten gerieren sich rücksichtslos als mögliche Verdoppelung bzw. Verbesserung der Lebenswelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wahrnehmung: Zugang zum Sein.
- Der Leib als „Mittel überhaupt, eine Welt zu haben."
- Die Tastempfindungen.
- Das Sehen.
- Das Hören.
- Zusammenspiel: Die „Gesamterfahrung“.
- Das Feld der Synästhesien.
- Der Dialog.
- Das Netz:,,Raum“ des Imaginären.
- Kalküle und das anthropomorphe Raster.
- Jenseits des Horizonts.
- Materialität im Zwielicht.
- Zur Weltgeltung virtueller Welten.
- Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich mit der Wahrnehmung und deren Erfahrung von Widerstand in einer Welt auseinander, in der imaginäre Abbilder die Realität zu verdecken drohen. Sie beleuchtet problematische Züge moderner Theorien und Technologien, die die Ansprüche der Welt an uns leugnen, indem sie diese als virtuelle Konstruktionen generieren oder sich ihrer epistemologisch bemächtigen, um letztlich die Widerständigkeit und Widersinnigkeit der Welt zu umgehen oder gar aufzuheben.
- Analyse der Wahrnehmung aus phänomenologischer Perspektive, insbesondere basierend auf Merleau-Pontys „Phänomenologie der Wahrnehmung“
- Untersuchung des Leibes als Ursprung unseres Verhältnisses zur Welt und dessen Rolle bei der Erfahrung von Widerstand
- Bewertung von „virtuellen“ Umgebungen und deren Potenzial zur Hervorrufung von Widerstand
- Kritik an Mikrotechnologien, die versuchen, Wahrnehmungen zu manipulieren oder zu „perfektionieren“
- Begründung, warum virtuelle „Welten“ streng genommen keine Welten sind
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wahrnehmung und die Herausforderungen ein, die sich durch moderne Technologien und Theorien stellen. Sie stellt Merleau-Pontys „Phänomenologie der Wahrnehmung“ als Ausgangspunkt für die Untersuchung dar und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
- Die Wahrnehmung: Zugang zum Sein: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Leib als Ursprung unseres Verhältnisses zur Welt. Es betont die Bedeutung der leiblichen Wahrnehmung innerhalb der Philosophie von Merleau-Ponty und analysiert die Funktionsweise der einzelnen Sinne im Hinblick auf die Erfahrung von Widerstand.
- Zusammenspiel: Die „Gesamterfahrung“: Dieser Abschnitt untersucht das Zusammenspiel der Sinne und die Frage, wie sinnliche Leistungen erfahren werden. Er beleuchtet die Bedeutung von Synästhesien und den Dialog zwischen den Sinnen für unsere „Gesamterfahrung“ der Welt.
- Das Netz: „Raum“ des Imaginären: Dieses Kapitel befasst sich mit dem „Raum“ des Imaginären, der durch Kalküle und das anthropomorphe Raster geprägt wird. Es erörtert die Grenzen des Imaginären und die Frage, ob und wie wir „jenseits des Horizonts“ denken können.
- Materialität im Zwielicht: Dieses Kapitel untersucht die Frage, wie die Materialität der Welt in virtuellen Umgebungen wahrgenommen wird und ob diese tatsächlich Widerstand bieten können. Es analysiert die Auswirkungen von Mikrotechnologien auf unsere Wahrnehmung und die Grenzen dieser Manipulationen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Wahrnehmung, Leib, Widerstand, virtuelle Welten, Mikrotechnologien, Phänomenologie, Merleau-Ponty, Synästhesie und die Bedeutung der Erfahrung. Sie hinterfragt die Bedeutung von Imaginärem und Virtualem in Bezug auf die menschliche Erfahrung und beleuchtet die Grenzen und Chancen dieser Konzepte.
Häufig gestellte Fragen zu Wahrnehmung und virtuellen Umgebungen
Warum sind virtuelle Welten laut der Arbeit keine „echten“ Welten?
Echte Welten zeichnen sich durch Widerständigkeit und Materialität aus. Virtuelle Welten sind oft kalkulierte Konstruktionen, die den physischen Widerstand der Lebenswelt nur simulieren oder umgehen wollen.
Welche Rolle spielt der Leib in der Phänomenologie von Merleau-Ponty?
Der Leib ist der Ursprung unseres Verhältnisses zur Welt; er ist das „Mittel überhaupt, eine Welt zu haben“ und ermöglicht uns den Zugang zum Sein durch sinnliche Erfahrung.
Wie erfahren wir Widerstand durch unsere Sinne?
Die Arbeit analysiert Tastempfindungen, Sehen und Hören als Funktionen, durch die wir die Welt als undurchdringlich und unabhängig von unserem Denken erfahren.
Was wird an Mikrotechnologien zur Wahrnehmungsoptimierung kritisiert?
Diese Technologien versuchen, Wahrnehmungen zu perfektionieren, stoßen aber an leibliche Grenzen. Sie drohen, die notwendige Widerständigkeit der Welt durch gedachte Momente zu ersetzen.
Was bedeutet der Begriff „Synästhesie“ in diesem Kontext?
Synästhesie beschreibt das Zusammenspiel der Sinne zur „Gesamterfahrung“. Dieses Zusammenspiel ist in der Lebenswelt originär, in virtuellen Räumen hingegen oft nur fragmentiert vorhanden.
Was ist das Ziel der Untersuchung?
Die Arbeit möchte Unzulänglichkeiten moderner Meinungen über Wahrnehmung korrigieren und aufzeigen, dass Virtualität die reale Lebenswelt nicht verdoppeln oder verbessern kann.
- Citar trabajo
- Marcus Reiß (Autor), 2002, Von Widerstand und Eigensinn der Welt. Über das weiche Vermächtnis virtueller Umgebungen., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12851