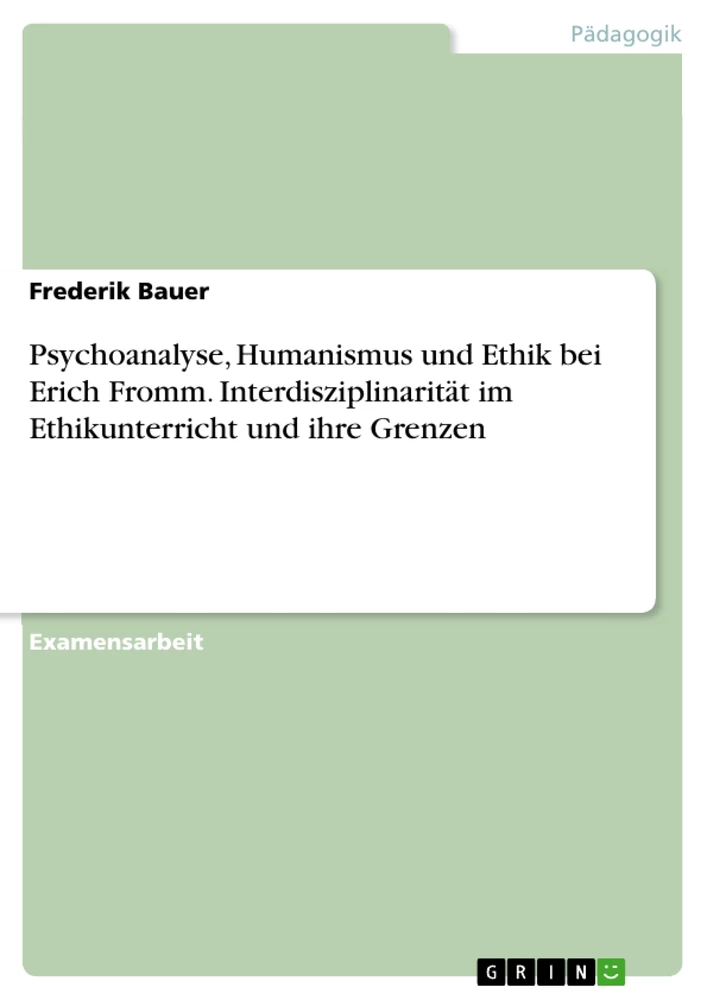Inwiefern eignet sich Erich Fromms Entwurf einer humanistischen Ethik für den Ethikunterricht der Sekundarstufe II? Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Die Untersuchung wird sich in drei Schritte unterteilen. Im ersten Teil der Arbeit wird eine Untersuchung des Gegenstands der Psychologie in der Geschichte der Philosophie durchgeführt. Hierbei soll anhand einer Auswahl von Philosophen dargestellt werden, wie sich im Laufe der Jahrhunderte die Psychologie als eigenständige Wissenschaft aus den Sphären der Philosophie emanzipierte. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf Sigmund Freuds Psychoanalyse liegen. Im zweiten Teil der Arbeit wird daraufhin untersucht, wie die Erkenntnisse der Psychologie von der Philosophie genutzt wurden, um mit Hilfe dieser Erkenntnisse eigene ethische Theorien zu entwickeln.
Hierbei soll Erich Fromms Ansatz demjenigen von John Dewey gegenübergestellt werden. Beide nutzten die Erkenntnisse der Psychoanalyse und der Psychologie aus unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Motiven. Diese Gegenüberstellung eignet sich insofern, dass sie die Individualität beider Ansätze verdeutlicht und die Vielfältigkeit der Interdisziplinarität aus Psychologie und Philosophie illustriert. Im dritten und letzten Teil der Arbeit soll anschließend untersucht werden, warum gerade Erich Fromms Ansatz als geeignetes Unterrichtsthema für den Ethikunterricht der Sekundarstufe II erscheint. Diese didaktische Untersuchung läuft in drei Schritten ab: Zunächst wird anhand Fromms eigener Aussagen zu Pädagogik und Erziehung eine psychoanalytische Perspektive eingenommen, die vor allem Fromms Untersuchungen zum (Un-)Gehorsam und zur Autorität in den Blick nimmt.
Im zweiten Schritt soll anhand Wolfgang Klafkis Theorie der kategorialen Bildung eine allgemeindidaktische Untersuchung der humanistischen Ethik Fromms stattfinden. Dies soll dazu beitragen, den Blick vom Unterrichtsgegenstand hin zu den Schüler*innen zu lenken, vor allem aber das Potential einer wechselseitigen Erschließung von Subjekt und Objekt im Sinne Klafkis zu analysieren. Im letzten Schritt wird abschließend erörtert, wie Ekkehard Martens Philosophiedidaktik mit Erich Fromms Ansatz harmoniert. Der Fokus liegt hierbei auf Martens Definition von Philosophie, die er vor allem als Tätigkeit und Kulturtechnik versteht. All dies soll schließlich dazu beitragen, die Frage nach einer Eignung von Fromms Ansatz für den Ethikunterricht zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Seele des Menschen
- Aristoteles
- René Descartes
- John Locke
- Gottfried Wilhelm Leibniz
- Immanuel Kant
- Johann Friedrich Herbart
- Philosophie und Psychologie am Scheidepunkt
- Sigmund Freud und die Psychoanalyse
- Ich/Es/Über-Ich
- Das Ich und das Es
- Das Ich und das Über-Ich
- Freuds Anthropologie und Kulturkritik
- Die Ethik des (Kultur-)Über-Ichs
- Von Freud zu Fromm
- Ich/Es/Über-Ich
- Erich Fromm – Intellektuelle Kurzbiographie
- Erich Fromm - Psychoanalyse und Ethik
- Humanistische Ethik als Kunst des Lebens
- Die Natur des Menschen
- Existenzielle und historische Dichotomien
- Humanistische Charakterologie
- Die nicht-produktiven Charakterorientierungen
- Die produktiven Charakterorientierungen
- Das Prinzip der humanistischen Ethik
- Utopischer Humanismus
- Erich Fromm - Psychoanalyse und Ethik
- John Dewey
- John Dewey und die menschliche Natur
- Impulse, Habit und Deliberation
- Menschliches Verhalten und Werturteile
- John Deweys Ethik
- Erich Fromm und John Dewey - Die menschliche Natur und Ethik
- John Dewey und die menschliche Natur
- Philosophie und Psychologie – Ein Fazit
- Erich Fromms humanistische Pädagogik
- Wolfgang Klafki
- Fachdidaktische Perspektive
- Wozu Philosophie?
- Philosophieren als Kulturtechnik
- Erich Fromm im Lichte von Martens Philosophiedidaktik
- Humanistische Ethik als Weltanschauung
- Humanistische Ethik als Lebenskunst
- Humanistische Ethik als Kulturtechnik
- Humanistische Ethik in der Schule
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Verbindung von Psychoanalyse, Humanismus und Ethik bei Erich Fromm. Sie untersucht, wie die Erkenntnisse der Psychoanalyse zur Entwicklung einer humanistischen Ethik beitragen können und welche Möglichkeiten und Grenzen diese Interdisziplinarität im Ethikunterricht aufweist.
- Entwicklung der Psychologie als eigenständige Wissenschaft aus der Philosophie
- Verbindung von Psychoanalyse und Ethik bei Erich Fromm
- Fromms Konzept einer humanistischen Ethik als Alternative zu autoritären Ethiken
- Die Rolle der Pädagogik in der Vermittlung von ethischen Werten
- Die Bedeutung von Erich Fromms Ansatz für den Ethikunterricht in der Sekundarstufe II
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und skizziert den Zusammenhang zwischen Psychologie, Ethik und der Suche nach der "Seele des Menschen" im 21. Jahrhundert. Sie führt in die Problematik ein, dass die empirische Psychologie die Rolle der Philosophie im Bereich der Ethik in Frage stellt und eine neue ethische Perspektive basierend auf den Erkenntnissen der Psychoanalyse notwendig erscheint.
- Die Seele des Menschen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs der Seele in der Geschichte der Philosophie, beginnend bei Aristoteles bis hin zu Immanuel Kant. Es zeigt auf, wie die Psychologie sich zunehmend von der Philosophie abgrenzte und als empirische Wissenschaft etablierte.
- Sigmund Freud und die Psychoanalyse: Das Kapitel widmet sich den zentralen Thesen der Psychoanalyse, insbesondere dem Modell von Ich, Es und Über-Ich sowie der Bedeutung des Unterbewusstseins. Es analysiert Freuds anthropologische und kulturkritische Ansätze und untersucht die Frage, ob die Psychoanalyse eine normative Ethik entwickeln kann.
- Erich Fromm – Intellektuelle Kurzbiographie: Dieses Kapitel stellt Erich Fromm als einen wichtigen Vertreter der Psychoanalyse vor, der die Bedeutung der Psychoanalyse für die Ethik erkannte. Es behandelt seine humanistische Ethik als Kunst des Lebens, seine Theorien zur Natur des Menschen und zur Bedeutung von existenziellen und historischen Dichotomien. Darüber hinaus werden Fromms Erkenntnisse zur Charakterologie beleuchtet.
- John Dewey: Dieses Kapitel stellt John Dewey und seine Theorien zur menschlichen Natur sowie seine ethischen Ansätze vor. Es untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Fromms und Deweys Konzepten.
- Philosophie und Psychologie – Ein Fazit: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie zusammen und reflektiert die Bedeutung der Psychoanalyse für die Entwicklung ethischer Theorien.
- Erich Fromms humanistische Pädagogik: Das Kapitel untersucht Fromms pädagogische Ideen und die Bedeutung seiner humanistischen Ethik für die Bildung.
- Wolfgang Klafki: Das Kapitel stellt Wolfgang Klafki und seine Konzeption einer kritisch-konstruktiven Didaktik vor, die die Bedeutung von humanistischen Werten in der Bildung betont.
- Fachdidaktische Perspektive: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung der Philosophie im Unterricht und diskutiert die Möglichkeit, Erich Fromms humanistische Ethik als Teil des Ethikunterrichts zu nutzen.
- Humanistische Ethik in der Schule: Dieses Kapitel beleuchtet die praktische Umsetzung von humanistischen ethischen Prinzipien in der Schule.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Psychoanalyse, Humanismus, Ethik, Erich Fromm, John Dewey, Interdisziplinarität, Ethikunterricht, Pädagogik, Bildung, Kulturtechnik und Lebenskunst.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Erich Fromms humanistische Ethik?
Fromm versteht Ethik als "Kunst des Lebens", die auf der Natur des Menschen basiert und eine Alternative zu autoritären, fremdbestimmten Moralsystemen darstellt.
Wie verbindet Fromm Psychoanalyse und Ethik?
Er nutzt die Erkenntnisse der Psychoanalyse (z. B. Charakterorientierungen), um zu erklären, wie menschliches Verhalten und ethische Werte zusammenhängen.
Eignet sich Fromms Ansatz für den Schulunterricht?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass sich Fromms Themen wie Autorität, (Un-)Gehorsam und Lebenskunst besonders gut für den Ethikunterricht der Sekundarstufe II eignen.
Was ist der Unterschied zwischen Fromm und John Dewey?
Beide nutzen die Psychologie für ethische Theorien, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten bezüglich der menschlichen Natur und gesellschaftlicher Prozesse.
Welche Rolle spielt die Pädagogik bei Erich Fromm?
Für Fromm ist Erziehung ein Mittel zur Förderung der produktiven Charakterorientierung und zur Befreiung von autoritären Strukturen.
- Citar trabajo
- Frederik Bauer (Autor), 2022, Psychoanalyse, Humanismus und Ethik bei Erich Fromm. Interdisziplinarität im Ethikunterricht und ihre Grenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282988