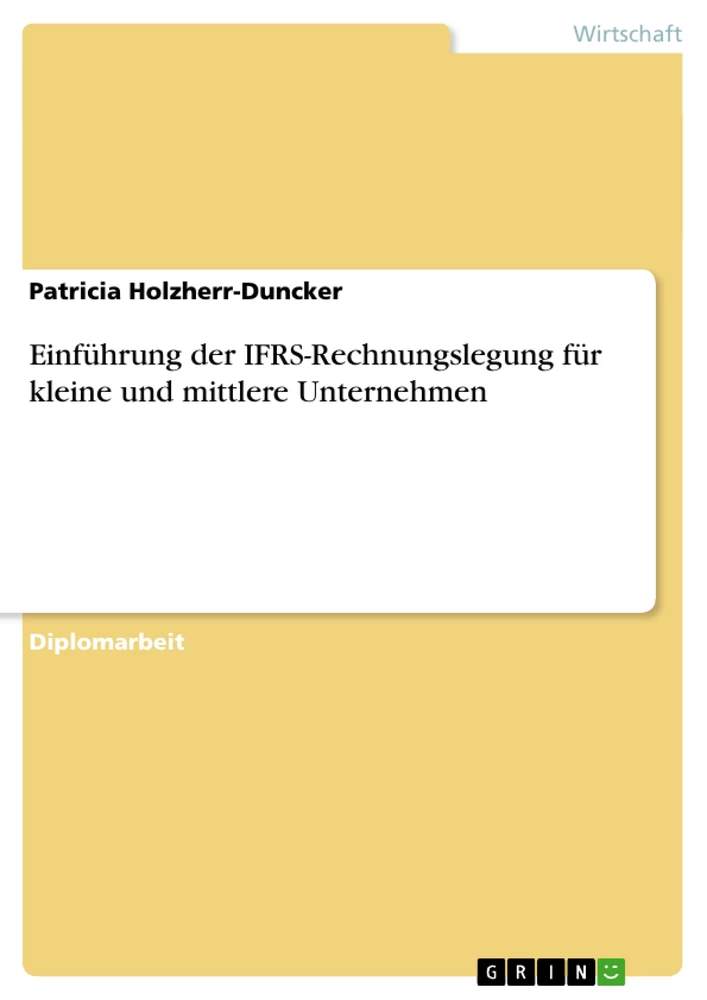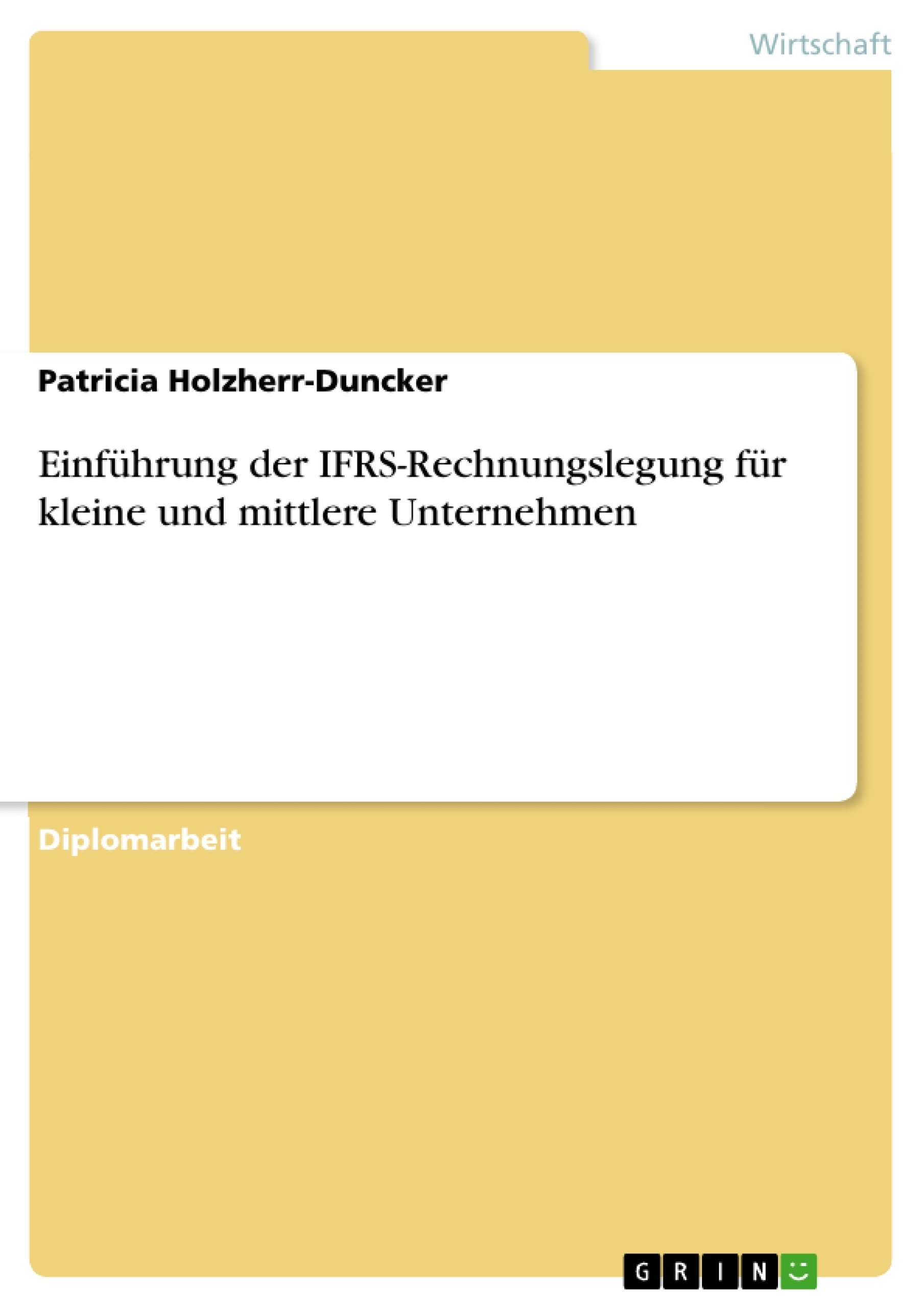Die Globalisierung der Wirtschaft zieht weite Kreise und beeinflusst immer mehr die Entscheidungen der Unternehmen in Deutschland. Die Bedeutung der International Financial Reporting Standards wächst, ebenso der Anwenderkreis. Kleine und mittlere Unternehmen, soweit sie keinen Konzernabschluss aufstellen müssen und nicht am geregelten Kapitalmarkt teilnehmen, sind noch nicht direkt davon betroffen, aber die Ausrichtung der Europäischen Union auf die IFRS wird zwangsläufig dazu führen, dass sich die KMU damit auseinandersetzen müssen.
Um die Einführung der IFRS-Rechnungslegung für die große Mehrheit der über 3.000.000 deutschen Unternehmen, die nicht kapitalmarktorientiert sind, ist bereits eine kontroverse Diskussion entstanden und aufgrund der vielen komplizierten Rechnungslegungsvorschriften der IFRS wird z. Zt. an Vereinfachungen für KMU im Rahmen des „Entwurfs eines vorgeschlagenen IFRS für kleine und mittelgroße Unternehmen“ gearbeitet. Gesetzlich ist das Wahlrecht für die Aufstellung einer IFRS-Bilanz für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in § 325 Abs. 2a HGB verankert und zusammen mit den aktuellen Entwicklungen und Diskussionen lässt es die Prognose zu, dass sich mittelfristig die IFRS-Rechnungslegung als vorherrschender Rechnungslegungsstandard durchsetzen wird. Ebenfalls wird die Einheitlichkeit der deutschen Rechnungslegung wiederhergestellt wenn alle Unternehmen nach IFRS Rechnung legen.
Innerhalb der Europäischen Union wird zunehmend auf IFRS im Einzelabschluss umgestellt, teilweise zwingend, teilweise optional, aber immer mit befreiender Wirkung, d. h. der Abschluss wird nach den IFRS erstellt statt nach nationalen Standards. In Deutschland muss neben dem freiwilligen IFRS-Abschluss immer noch ein Abschluss zur Bemessung der Besteuerungsgrundlage bzw. Ausschüttungsgrundlage erstellt werden. Diese „Doppelbelastung“ zweier Abschlüsse schreckt viele Unternehmen ab. Deshalb ist das Ergebnis einer Umfrage, wonach 79 % der befragten Unternehmen keinen konkreten Bedarf einer Umstellung bzw. zusätzlicher Bilanzierung sehen, nicht verwunderlich.
Ob ein KMU freiwillig einen Einzelabschluss nach IFRS aufstellt und diesen dann veröffentlicht, muss sehr gut analysiert werden und die Kriterien gegeneinander abgewogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Problemdarstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 2 Rechtliche Grundlagen
- 2.1 Das Wahlrecht nach § 325 Abs. 2a HGB
- 2.2 Internationale Rechnungslegungsgrundsätze
- 2.2.1 Regelwerk
- 2.2.2 Rechnungslegungsgrundsätze
- 2.3 Unterschiede zur Rechnungslegung nach HGB
- 3 Kriterien der Anwendung der IFRS-Rechnungslegung bei kleinen und mittleren Unternehmen
- 3.1 Zunahme der Transparenz und Steigerung des Informationswertes
- 3.1.1 Auswirkungen auf das Unternehmen
- 3.1.2 Auswirkungen auf das Unternehmensumfeld
- 3.1.2.1 Shareholder
- 3.1.2.2 Stakeholder
- 3.2 Notwendigkeit vergleichbarer Abschlüsse
- 3.2.1 Verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten
- 3.2.2 Der Jahresabschluss als betriebswirtschaftliche Grundlage
- 3.3 Objektivere Abbildung der Unternehmenslage
- 3.4 Auswirkungen unter dem Gesichtspunkt von Basel II
- 3.5 Angleichung des internen und externen Rechnungswesens
- 3.4.1 Divergenz im Rechnungswesen bei kleinen und mittleren Unternehmen
- 3.4.2 Eignung eines IFRS-Abschlusses für Steuerungszwecke
- 3.5 Kostenbelastung eines IFRS-Abschlusses
- 3.5.1 Einmalige Kostenbelastungen
- 3.5.1.1 Eröffnungsbilanz
- 3.5.2 Mitarbeiter und externe Berater
- 3.5.2.1 EDV
- 3.5.3 Laufende Kostenbelastungen
- 3.5.3.1 Pluralismus der Abschlüsse und Prüfungskosten
- 3.5.3.2 Einfluss der Veränderungsdynamik der IFRS
- 4 Die Bilanzierung ausgewählter Sachverhalte nach IFRS, wesentliche Unterschiede zum HGB und die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen
- 4.1 Immaterielle Vermögenswerte
- 4.2 Sachanlagevermögen
- 4.3 Pensionsrückstellungen
- 4.4 Vorräte und Fertigungsaufträge
- 4.5 Verbindlichkeiten
- 4.6 Latente Steuern
- 4.7 Eigenkapital
- 5 Zur Zukunft der Rechnungslegung in kleinen und mittelständischen Unternehmen
- 5.1 Entwicklungen im Bilanzrecht
- 5.2 Der Standardentwurf des IASB für SME
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Einführung der IFRS-Rechnungslegung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Ziel ist es, die Kriterien für die Anwendung von IFRS bei KMU zu analysieren und die Auswirkungen dieser Umstellung auf die betroffenen Unternehmen und deren Umfeld zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Vorteile wie erhöhte Transparenz und verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten, als auch die Herausforderungen, insbesondere die Kostenbelastung.
- Auswirkungen der IFRS-Einführung auf KMU
- Kosten-Nutzen-Analyse der IFRS-Rechnungslegung für KMU
- Vergleich IFRS und HGB im Kontext von KMU
- Rechtliche Grundlagen und Wahlmöglichkeiten
- Zukunftsperspektiven der Rechnungslegung für KMU
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung und stellt die Problemstellung dar, nämlich die Herausforderungen und Chancen der IFRS-Einführung für KMU. Es beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Auswirkungen dieser Umstellung umfassend zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Abwägung von Vorteilen und Nachteilen für verschiedene Stakeholder.
2 Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten rechtlichen Grundlagen, insbesondere das Wahlrecht nach § 325 Abs. 2a HGB und die internationalen Rechnungslegungsgrundsätze (IFRS). Es vergleicht die Anforderungen von IFRS mit denen des HGB und hebt die wesentlichen Unterschiede hervor, die für KMU besonders relevant sind. Der Schwerpunkt liegt auf der Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anwendung von IFRS.
3 Kriterien der Anwendung der IFRS-Rechnungslegung bei kleinen und mittleren Unternehmen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Kriterien, die die Anwendung von IFRS bei KMU beeinflussen. Es untersucht die Auswirkungen auf die Transparenz und den Informationswert für Investoren und andere Stakeholder. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbesserung der Vergleichbarkeit von Abschlüssen und die damit verbundenen Vorteile bei der Unternehmensfinanzierung. Die Kostenbelastung durch die Umstellung wird ebenfalls ausführlich diskutiert, inklusive einmaliger und laufender Kosten.
4 Die Bilanzierung ausgewählter Sachverhalte nach IFRS, wesentliche Unterschiede zum HGB und die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen: Dieses Kapitel vergleicht die Bilanzierung bestimmter Sachverhalte nach IFRS und HGB und untersucht die Auswirkungen dieser Unterschiede auf KMU. Beispiele umfassen immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagevermögen, Pensionsrückstellungen, Vorräte, Verbindlichkeiten, latente Steuern und Eigenkapital. Die Analyse fokussiert sich auf die praktischen Implikationen für die Bilanzierungspraxis in KMU.
5 Zur Zukunft der Rechnungslegung in kleinen und mittelständischen Unternehmen: Dieses Kapitel befasst sich mit zukünftigen Entwicklungen im Bilanzrecht und insbesondere mit dem Standardentwurf des IASB für KMU. Es analysiert mögliche Anpassungen und Vereinfachungen der IFRS für kleine und mittelständische Unternehmen und deren Auswirkungen auf die Rechnungslegungspraxis.
Schlüsselwörter
IFRS, HGB, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Rechnungslegung, Bilanzierung, Transparenz, Vergleichbarkeit, Finanzierung, Kosten, Basel II, IASB, Standardentwurf SME, rechtliche Grundlagen, Wahlrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: IFRS-Rechnungslegung für kleine und mittlere Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Einführung der International Financial Reporting Standards (IFRS) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Sie analysiert die Kriterien für die Anwendung von IFRS bei KMU und bewertet die Auswirkungen dieser Umstellung auf die betroffenen Unternehmen und deren Umfeld.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Vorteile (z.B. erhöhte Transparenz, verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten) und Herausforderungen (insbesondere die Kostenbelastung) der IFRS-Einführung für KMU. Sie beleuchtet die Auswirkungen auf verschiedene Stakeholder und vergleicht IFRS mit den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) Vorschriften.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Auswirkungen der IFRS-Einführung auf KMU, Kosten-Nutzen-Analyse der IFRS-Rechnungslegung für KMU, Vergleich IFRS und HGB im Kontext von KMU, rechtliche Grundlagen und Wahlmöglichkeiten, sowie Zukunftsperspektiven der Rechnungslegung für KMU.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet das Wahlrecht nach § 325 Abs. 2a HGB und die internationalen Rechnungslegungsgrundsätze (IFRS). Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Anforderungen von IFRS mit denen des HGB und die daraus resultierenden Unterschiede für KMU.
Welche Kriterien für die Anwendung von IFRS bei KMU werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Kriterien wie die Auswirkungen auf die Transparenz und den Informationswert, die Verbesserung der Vergleichbarkeit von Abschlüssen und die damit verbundenen Vorteile bei der Unternehmensfinanzierung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der ausführlichen Diskussion der Kostenbelastung durch die Umstellung (einmalige und laufende Kosten).
Wie werden IFRS und HGB verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Bilanzierung bestimmter Sachverhalte nach IFRS und HGB (z.B. immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagevermögen, Pensionsrückstellungen, Vorräte, Verbindlichkeiten, latente Steuern und Eigenkapital). Der Fokus liegt auf den praktischen Implikationen dieser Unterschiede für die Bilanzierungspraxis in KMU.
Welche Zukunftsperspektiven werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet zukünftige Entwicklungen im Bilanzrecht und den Standardentwurf des IASB für KMU. Sie analysiert mögliche Anpassungen und Vereinfachungen der IFRS für kleine und mittelständische Unternehmen und deren Auswirkungen auf die Rechnungslegungspraxis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: IFRS, HGB, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Rechnungslegung, Bilanzierung, Transparenz, Vergleichbarkeit, Finanzierung, Kosten, Basel II, IASB, Standardentwurf SME, rechtliche Grundlagen, Wahlrecht.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Rechtliche Grundlagen, Kriterien der Anwendung der IFRS-Rechnungslegung bei kleinen und mittleren Unternehmen, Die Bilanzierung ausgewählter Sachverhalte nach IFRS, wesentliche Unterschiede zum HGB und die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen, Zur Zukunft der Rechnungslegung in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Fazit.
- Citation du texte
- Patricia Holzherr-Duncker (Auteur), 2007, Einführung der IFRS-Rechnungslegung für kleine und mittlere Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127766