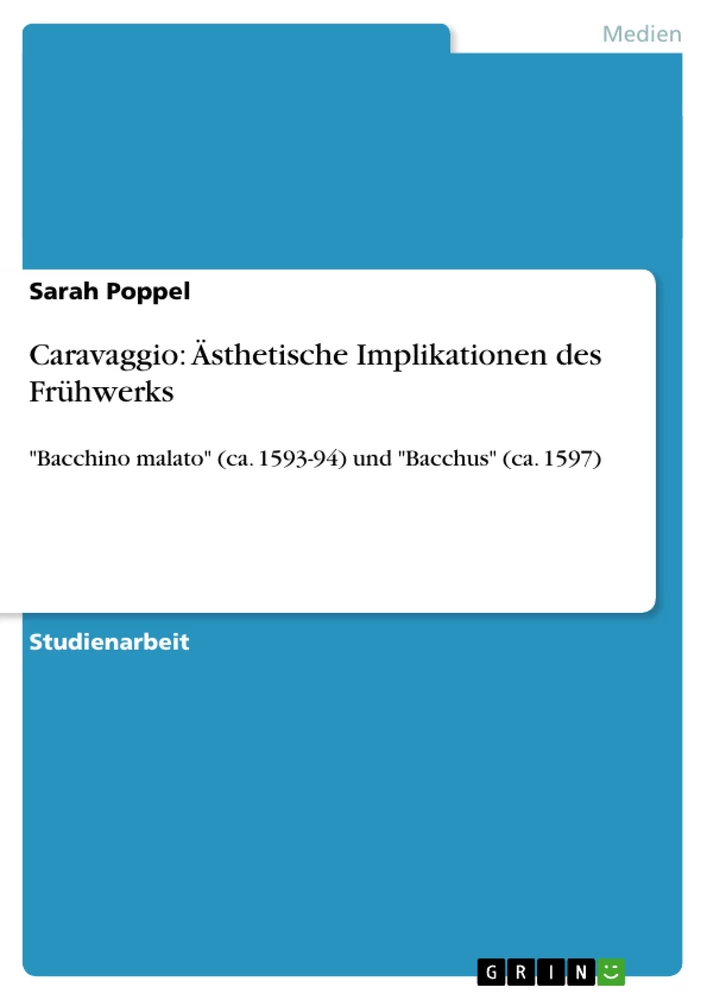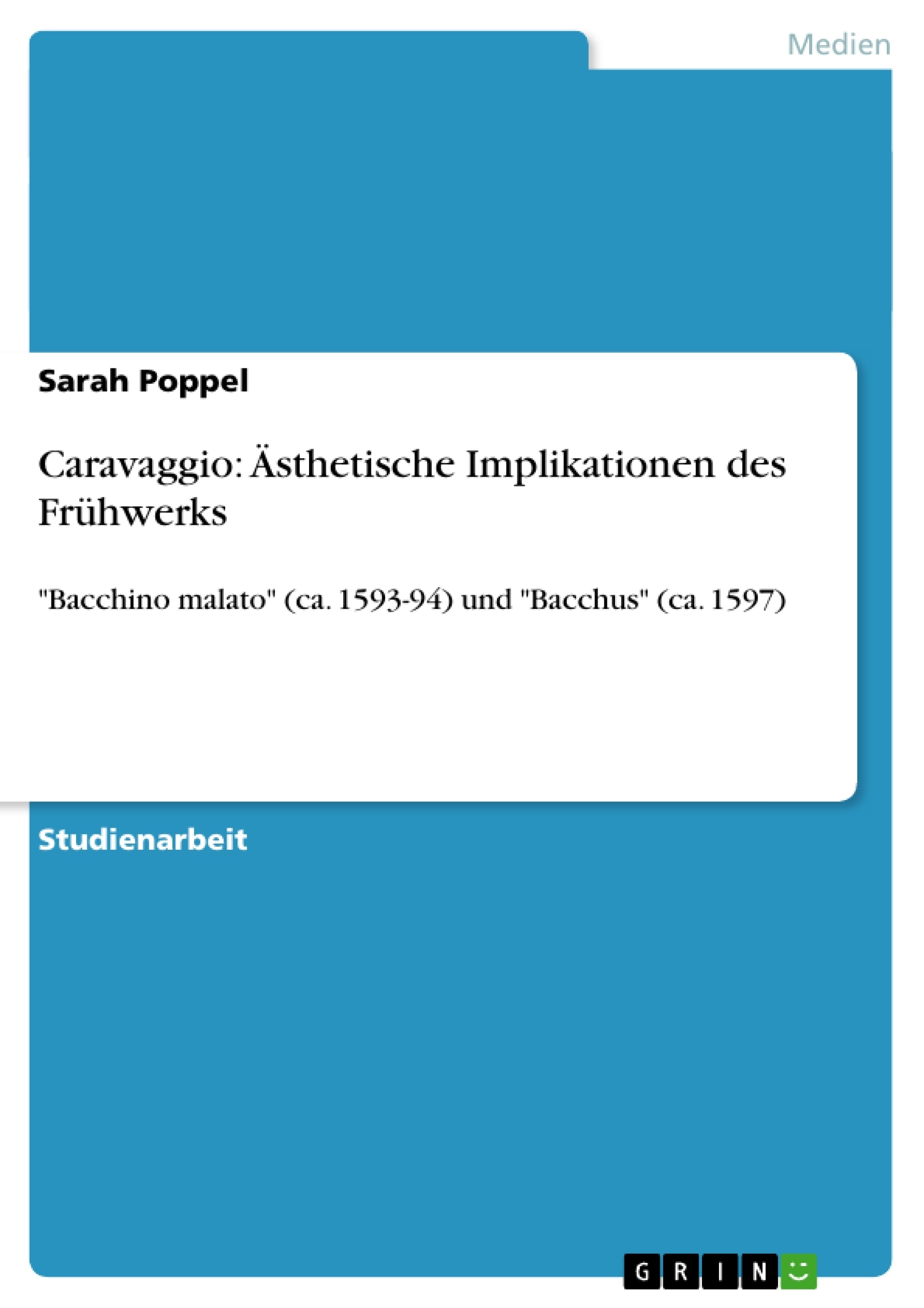Michelangelo Merisi da Caravaggio. Längst eingegangen in den Kanon alter Meister, wird dessen ebenso stürmisches wie kurzes Leben (ca. 1571-1610) von einer Vielzahl an biographischen und wissenschaftlichen Legenden umrankt: ein streitsüchtiger Egozentriker, Rebell, Erneuerer der Kunst und vehementer Verfechter des Naturalismus, der nur das malte, was er mit bloßem Auge sah. Eine herausragende Künstlerpersönlichkeit. Herausragend auch, die inzwischen außerhalb jeglicher Relation stehende Masse an Sekundärliteratur und die, seit dessen Werk von der Staubschicht eines jahrhunderdtelangen Vergessens zu Beginn des letzten Jahrhunderts befreit wurde, noch immer anhaltende Konjunktur Caravaggios; ein Langzeitprojekt, nicht nur hinsichtlich der stets neue Fragezeichen aufwerfenden Zuschreibungsproblematik.
Angesichts dieser Situation wird sich diese Arbeit, weit entfernt davon einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, bescheiden ausnehmen. Dabei konzentriert sich die Betrachtung auf zwei frühe Werke, die Bacchusdarstellungen von 1593-94 und 1597, anhand welcher, durch eingehende Beschreibung, Bildvergleiche und der Resümierung gängiger Interpretationsansätze, wie sie unter anderem von Hibbard (1988), Prater (1992) oder Held (1996) bereits ausführlich diskutiert wurden, die ästhetischen Implikationen des caravaggesken Frühwerks illustriert werden sollen. Neben dessen Besonderheit polyvalent angelegter Deutungsstrukturen, wird es daneben vor allem – hierbei Kretschmer (1991) und Krüger (2001) folgend – um die im bildkonzeptuellen Programm unmittelbar nachzuweisende Thematisierung der Ambivalenz zwischen Darstellung und Dargestelltem, dem Verhältnis zwischen Bild und Betrachter, sowie der Autoreferenzialität des Mediums gehen. Der letzte Teil widmet sich in diesem Sinne dem Ansatz von Pichler (2006).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Frühwerk (1592-1600)
- 3. Bacchus Malato, 1593-94
- 4. Bacchus, 1597
- 5. Erweiterte Analyse der Bildkonzeption
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ästhetischen Implikationen des frühen Werks Caravaggios anhand zweier Bacchus-Darstellungen. Sie analysiert die Bildkonzeptionen, vergleicht die Bilder und diskutiert gängige Interpretationsansätze. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz zwischen Darstellung und Dargestelltem, dem Verhältnis zwischen Bild und Betrachter sowie der Autoreferenzialität des Mediums.
- Ästhetische Implikationen des Frühwerks Caravaggios
- Analyse der Bacchus-Darstellungen (1593-94 und 1597)
- Ambivalenz zwischen Darstellung und Dargestelltem
- Verhältnis zwischen Bild und Betrachter
- Autoreferenzialität des Mediums
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Leben und Werk Caravaggios ein und beschreibt die immense Sekundärliteratur zu seinem Schaffen. Die Arbeit konzentriert sich auf zwei frühe Bacchus-Darstellungen, um anhand eingehender Beschreibungen, Bildvergleiche und gängiger Interpretationsansätze die ästhetischen Implikationen des Frühwerks zu illustrieren. Besonderes Augenmerk liegt auf polyvalenten Deutungsstrukturen, der Thematisierung der Ambivalenz zwischen Darstellung und Dargestelltem, dem Verhältnis zwischen Bild und Betrachter, sowie der Autoreferenzialität des Mediums.
2. Frühwerk (1592-1600): Dieses Kapitel beschreibt Caravaggios Frühwerk, das aus etwa einem Dutzend kleinformatiger Gemälde besteht, die auf seine frühen römischen Jahre bis um 1600 datiert werden. Es werden biographische Details zu dieser Zeit skizziert, darunter seine Ankunft in Rom um 1592, seine frühen Arbeiten und sein Eintritt in den Kreis um Kardinal Francesco Maria Bourbon del Monte. Das Kapitel hebt den Kontrast zwischen dem Frühwerk (kleinformatige Halbfiguren, profane Inhalte) und dem Spätwerk (monumentale Ausmaße, christlich-religiöse Themen) hervor. Die beiden Bacchus-Bilder werden als paradigmatisch für diese Schaffensperiode dargestellt.
3. Bacchus Malato, 1593-94: Die Analyse des „Bacchus Malato“ konzentriert sich auf die halbfigurige Darstellung eines Jünglings, der scheinbar krank ist. Die Beschreibung des Bildes hebt die Komposition, die Farben und die ungewöhnliche Darstellung des Bacchus hervor. Die Interpretation der „kränklichen Erscheinung“ wird diskutiert, wobei eine biographische Lesart (Caravaggios eigene Krankheit) erwähnt wird. Der Zusammenhang mit der Selbstporträtierung Caravaggios wird ebenfalls beleuchtet, sowie die vieldeutige Natur des Bacchusthemas und die Bedeutung des Gemäldes als Galeriebild.
Schlüsselwörter
Caravaggio, Frühwerk, Bacchus, Bildanalyse, Bildkonzeption, Ambivalenz, Darstellung und Dargestelltes, Bild und Betrachter, Autoreferenzialität, Selbstporträt, Ästhetik, Naturalismus.
Häufig gestellte Fragen zum Caravaggio-Frühwerk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ästhetischen Implikationen des frühen Werks Caravaggios anhand zweier Bacchus-Darstellungen (um 1593-94 und 1597). Der Fokus liegt auf der Bildkonzeption, dem Vergleich der Bilder, gängigen Interpretationsansätzen und der Ambivalenz zwischen Darstellung und Dargestelltem, dem Verhältnis zwischen Bild und Betrachter sowie der Autoreferenzialität des Mediums.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Frühwerk (1592-1600), Bacchus Malato (1593-94), Bacchus (1597), Erweiterte Analyse der Bildkonzeption und Schluss. Jedes Kapitel befasst sich mit einem Aspekt des frühen Werks Caravaggios und der Analyse der beiden Bacchus-Bilder.
Was ist das zentrale Thema der Einleitung?
Die Einleitung führt in das Leben und Werk Caravaggios ein und beschreibt die umfangreiche Sekundärliteratur. Sie fokussiert auf die beiden frühen Bacchus-Darstellungen als Fallbeispiele, um die ästhetischen Implikationen des Frühwerks anhand eingehender Beschreibungen, Bildvergleiche und gängiger Interpretationsansätze zu verdeutlichen. Besonderes Augenmerk liegt auf polyvalenten Deutungsstrukturen und der Autoreferenzialität des Mediums.
Wie wird das Frühwerk Caravaggios charakterisiert?
Das Frühwerk (ca. 1592-1600) umfasst etwa ein Dutzend kleinformatige Gemälde. Es zeichnet sich durch profane Inhalte und halbfigurige Darstellungen aus, im Gegensatz zum späteren, monumentalerem und christlich-religiösen Schaffen. Die Bacchus-Bilder werden als paradigmatisch für diese Phase dargestellt.
Wie wird der "Bacchus Malato" analysiert?
Die Analyse des "Bacchus Malato" konzentriert sich auf die halbfigurige Darstellung eines scheinbar kranken Jünglings. Die Beschreibung umfasst Komposition, Farben und die ungewöhnliche Darstellung des Bacchus. Die Interpretation der „kränklichen Erscheinung“ wird diskutiert, inklusive einer biographischen Lesart (Caravaggios eigene Krankheit) und dem Zusammenhang mit der Selbstporträtierung. Die vieldeutige Natur des Bacchusthemas und die Bedeutung des Gemäldes als Galeriebild werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Caravaggio, Frühwerk, Bacchus, Bildanalyse, Bildkonzeption, Ambivalenz, Darstellung und Dargestelltes, Bild und Betrachter, Autoreferenzialität, Selbstporträt, Ästhetik, Naturalismus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ästhetischen Implikationen des frühen Werks Caravaggios anhand zweier Bacchus-Darstellungen. Sie analysiert die Bildkonzeptionen, vergleicht die Bilder und diskutiert gängige Interpretationsansätze. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz zwischen Darstellung und Dargestelltem, dem Verhältnis zwischen Bild und Betrachter sowie der Autoreferenzialität des Mediums.
- Quote paper
- Sarah Poppel (Author), 2009, Caravaggio: Ästhetische Implikationen des Frühwerks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127637