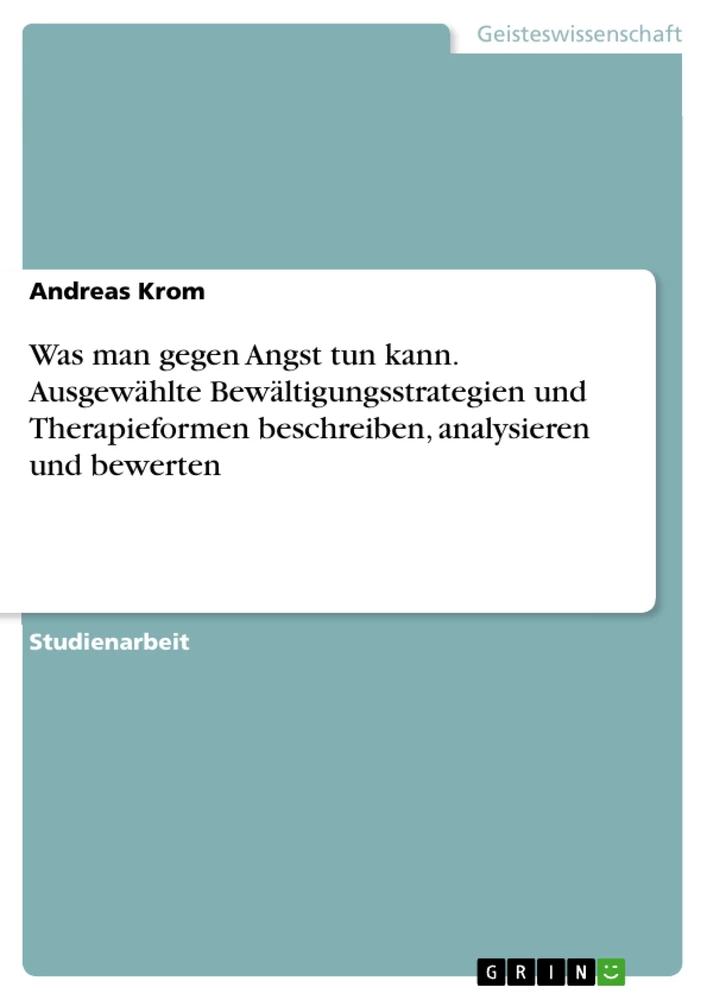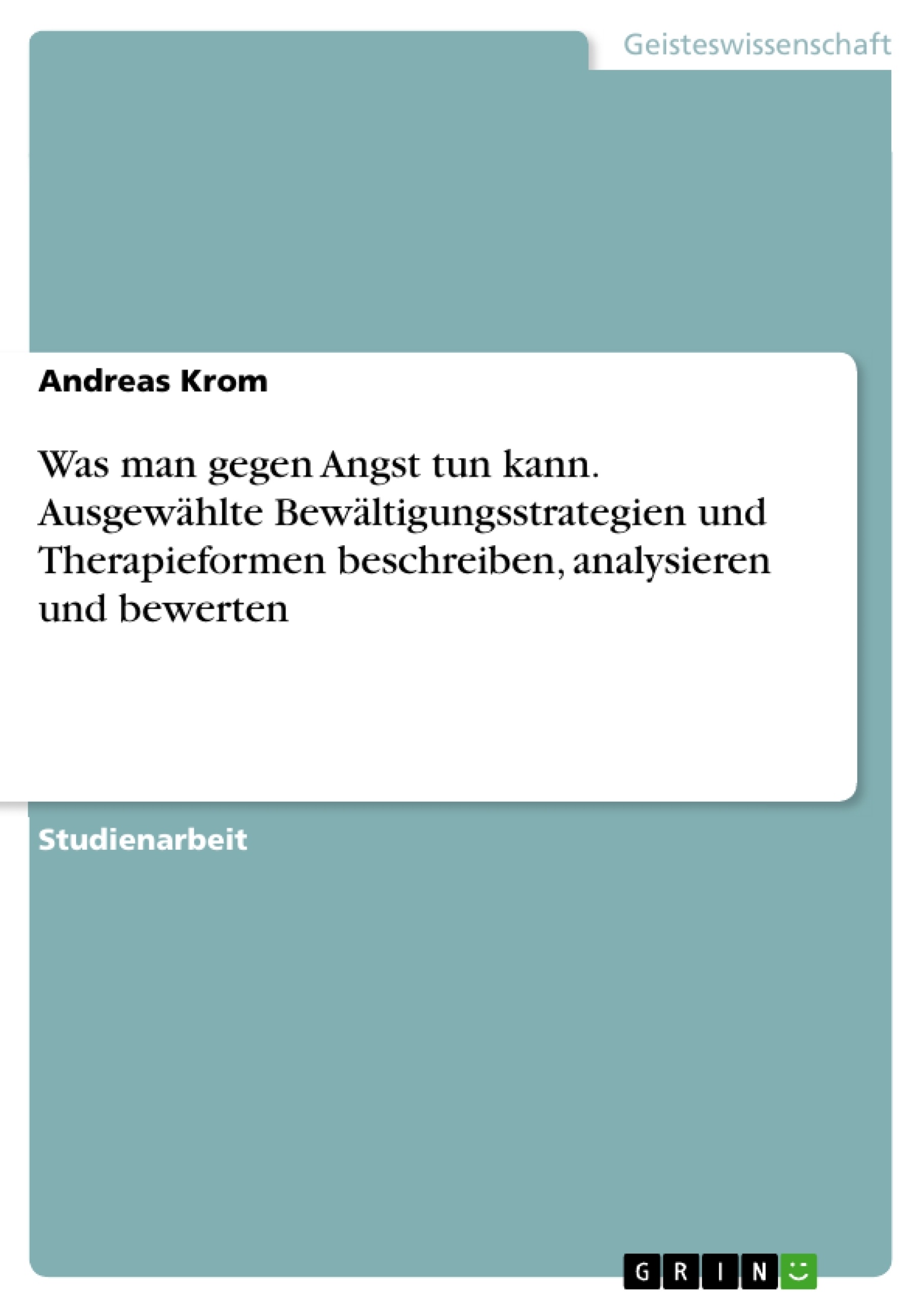Die Hausarbeit handelt von der Frage, was man gegen Angst tun kann. Es werden Bewältigungsstrategien und Therapieformen beschrieben, analysiert und bewertet.
Die wissenschaftliche Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste Teil der Arbeit erläutert Angsterkrankungen. Diese werden ausführlich betrachtet und im zweiten Teil der Arbeit mit zugehörigen Therapieformen, die in der modernen Medizin angewendet werden, inkludiert. Allgemein ist Angst als eine Reaktion auf die Wahrnehmung einer Gefahr, die als Bedrohung
beurteilt wird. Charakteristisch entsteht sie, wenn eine körperliche oder seelische Bedrohung wahrgenommen wird. Auf die Reaktion von Bedrohungen werden Bewältigungsmechanismen aktiviert, um der Gefahr entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Angst und Phobie
- Soziale Phobie
- Agoraphobie
- Traumata
- Therapie und Bewältigungsmechanismen
- Diagnostik
- Funktionale Bedingungsanalyse
- Kognitive Verhaltenstherapie
- Direkte Konfrontation
- Das arbeiten an der körperlichen Ebene der Angst
- Schulangst und -reduktion
- Fazit/ Kritik an der Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Angst und ihren verschiedenen Facetten. Ziel ist es, Angsterkrankungen zu erläutern, gängige Therapieformen und Bewältigungsstrategien zu beschreiben, zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet dabei die Rolle der Angst in verschiedenen Lebensbereichen und zeigt, wie diese behandelt und bewältigt werden kann.
- Definition und Abgrenzung von Angst und Furcht
- Darstellung verschiedener Angsterkrankungen, insbesondere soziale Phobie, Agoraphobie und Trauma
- Analyse und Bewertung von Therapieformen und Bewältigungsmechanismen, wie beispielsweise kognitive Verhaltenstherapie und direkte Konfrontation
- Die Bedeutung der körperlichen Ebene der Angst und ihre therapeutische Behandlung
- Die Auswirkungen von Schulangst auf das zukünftige Leben und die Bedeutung frühzeitiger Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Angst und seine Bedeutung in der heutigen Gesellschaft vor. Kapitel 2 fokussiert auf die Differenzierung zwischen Angst und Furcht und behandelt die verschiedenen Ausprägungen von Angsterkrankungen, wobei insbesondere soziale Phobie, Agoraphobie und Trauma näher betrachtet werden. Kapitel 3 befasst sich mit der Diagnostik von Angsterkrankungen, verschiedenen Therapieformen wie der kognitiven Verhaltenstherapie und der direkten Konfrontation, sowie der Bedeutung der körperlichen Ebene der Angst. Im Fokus von Kapitel 4 steht die Schulangst und ihre potenziellen Folgen für die Entwicklung von Kindern. Der Praxisbezug wird hier deutlich, wobei die Arbeit die Bedeutung von frühzeitigen Interventionen bei Schulangst hervorhebt.
Schlüsselwörter
Angst, Phobie, Therapie, Bewältigungsmechanismen, kognitive Verhaltenstherapie, direkte Konfrontation, Schulangst, Urmisstrauen, Trauma, soziale Phobie, Agoraphobie, psychosoziale Krisen, Angststörung, funktionale Bedingungsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Angst und Phobie?
Während Angst eine normale Reaktion auf Gefahr ist, beschreibt eine Phobie (wie die soziale Phobie oder Agoraphobie) eine übersteigerte, oft unbegründete Furcht vor spezifischen Situationen oder Objekten.
Wie hilft die kognitive Verhaltenstherapie bei Angst?
Sie setzt an den Denkmustern an, die die Angst aufrechterhalten, und kombiniert dies oft mit Konfrontationsübungen, um die Bedrohung neu zu bewerten.
Was versteht man unter direkter Konfrontation?
Es ist eine Therapiemethode, bei der sich der Patient bewusst der angstauslösenden Situation aussetzt, um zu erfahren, dass die befürchtete Katastrophe nicht eintritt.
Was ist Schulangst und wie kann man sie reduzieren?
Schulangst ist eine spezifische Form der Angst bei Kindern, die durch Leistungsdruck oder soziale Probleme entstehen kann. Frühzeitige Intervention und pädagogische Unterstützung sind hier entscheidend.
Welche Rolle spielt die körperliche Ebene bei Angst?
Angst äußert sich massiv körperlich (z.B. Herzrasen, Schwitzen). Moderne Therapien beziehen diese Ebene mit ein, um die physiologische Stressreaktion zu regulieren.
- Citar trabajo
- Andreas Krom (Autor), 2022, Was man gegen Angst tun kann. Ausgewählte Bewältigungsstrategien und Therapieformen beschreiben, analysieren und bewerten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1275497