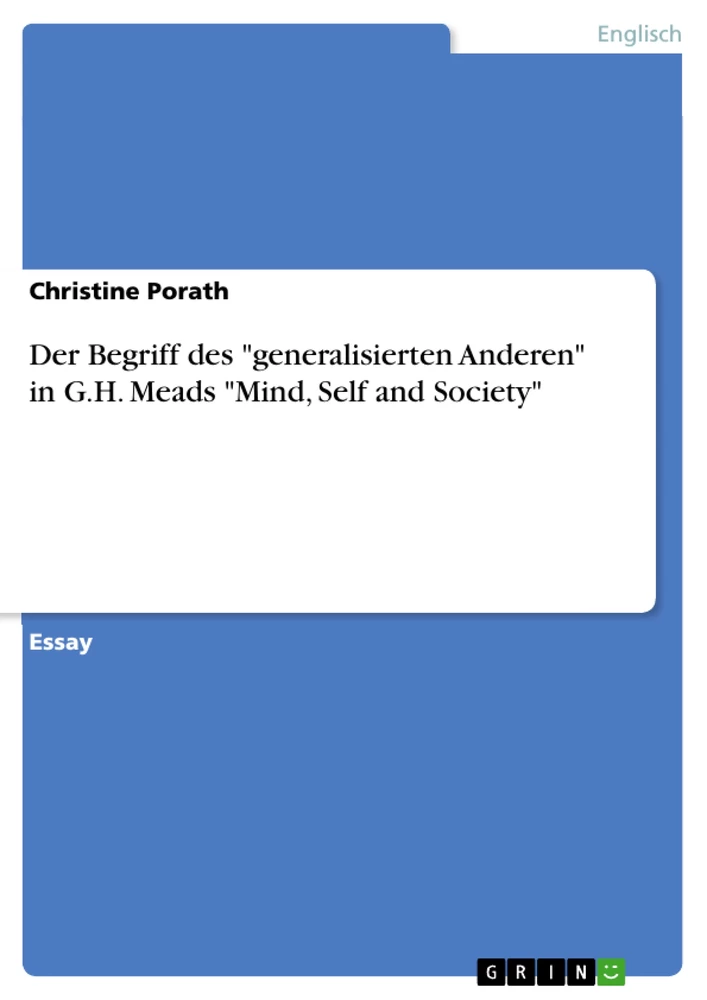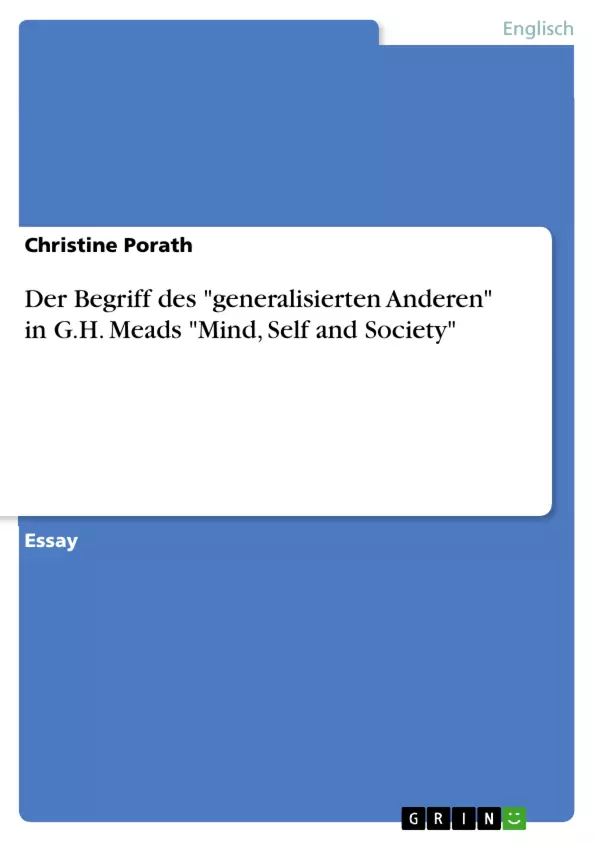In seinem Werk „Mind, Self and Society“ (welches posthum herausgebracht wurde und eigentlich eine Sammlung von Meads Studenten ist) versucht George Herbert Mead das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft näher zu bestimmen. Wichtig ist dabei unter anderem die Frage, wie genau sich die individuelle Identität sowie der Verstand des Menschen im Zusammenhang mit seinem sozialen Milieu entwickelt. Von Bedeutung ist hierbei vor allem die Frage, ob das Individuum die Voraussetzung für eine Gesellschaft ist, die sich auf seinem Verhalten gründet, oder ob umgekehrt die Gesellschaft die entscheidende Bedingung für die Entstehung von Individuen (d.h. von denkenden Wesen mit Selbstbewusstsein und Selbstidentität), die unterschiedlich sind, obwohl sie in der gleichen Gesellschaft aufwachsen. Dies bedeutet folgendes zu fragen:
„Wie können wir Universalität, die allgemeine Formulierung, die jede Interpretation der Welt begleiten muß, erreichen und doch weiterhin Nutzen ziehen aus den Unterschieden, die dem Individuum als unverwechselbarem zugehören.“ (Küsgen 2006, 194) Meads Theorie sagt im Großen und Ganzen, dass der Mensch nicht als vernünftiges Wesen (wohl als vernunftbegabt, aber nicht im Besitz der Vernunft und der Fähigkeit zur Reflexion) und mit einem „Selbst“ ausgestattet auf die Welt kommt. Mead begreift das Selbst in diesem Zusammenhang als etwas, das die Fähigkeit hat, sich selbst reflexiv zu sehen, d.h. als Objekt: „The self has the characteristic that it is an object to itself“ (Mead 1967, 136). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff des generalisierten Anderen in G.H. Meads „Mind, Self and Society“
- Einleitung
- Meads Theorie des Selbst
- Der generalisierte Andere
- Kritik an Meads Theorie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Begriff des generalisierten Anderen in George Herbert Meads Werk „Mind, Self and Society“. Sie untersucht, wie sich das Selbst im Kontext sozialer Interaktion entwickelt und wie der generalisierte Andere als ein Ausdruck der gesellschaftlichen Erwartungen und Normen fungiert.
- Die Entwicklung des Selbst durch soziale Interaktion
- Der generalisierte Andere als Repräsentation gesellschaftlicher Erwartungen
- Die Rolle von Sprache und Symbolen in der Selbstentwicklung
- Die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen
- Die Frage nach der individuellen Sichtweise und der gemeinsamen Interpretation der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des generalisierten Anderen ein und stellt die zentrale Frage nach der Entstehung des Selbst im Kontext der Gesellschaft. Meads Theorie des Selbst wird vorgestellt, die besagt, dass das Selbst sich durch soziale Interaktion und Kommunikation entwickelt. Der Mensch erfährt sich selbst durch die Reaktionen seiner Mitmenschen und internalisiert die Normen und Werte der Gesellschaft.
Der Abschnitt über den generalisierten Anderen erklärt, wie dieser Begriff die Gesamtheit der gesellschaftlichen Erwartungen und Haltungen gegenüber dem Individuum repräsentiert. Der generalisierte Andere bildet die Grundlage für das Selbstverständnis des Individuums, indem er die objektive Sichtweise der Gesellschaft auf das Individuum widerspiegelt.
Die Kritik an Meads Theorie beleuchtet die Frage, inwieweit die Internalisierung gesellschaftlicher Erwartungen die individuelle Freiheit einschränkt. Es wird diskutiert, ob die individuelle Sichtweise und die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen mit dem Konzept des generalisierten Anderen vereinbar sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den generalisierten Anderen, das Selbst, soziale Interaktion, Gesellschaft, Normen, Erwartungen, individuelle Sichtweise, kritische Auseinandersetzung, Mead, „Mind, Self and Society“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „generalisierte Andere“ nach George Herbert Mead?
Der „generalisierte Andere“ repräsentiert die Gesamtheit der gesellschaftlichen Erwartungen, Normen und Haltungen, die ein Individuum internalisiert, um ein Selbstbild zu entwickeln.
Wie entwickelt sich das „Selbst“ laut Meads Theorie?
Das Selbst entwickelt sich ausschließlich durch soziale Interaktion und Kommunikation. Der Mensch lernt, sich selbst aus der Perspektive anderer als Objekt wahrzunehmen („The self is an object to itself“).
Welche Rolle spielt die Sprache in Meads Konzept?
Sprache und Symbole sind essenziell für die Selbstentwicklung, da sie es ermöglichen, gemeinsame Bedeutungen zu teilen und die Reaktionen der Mitmenschen zu interpretieren.
Was wird an Meads Theorie des generalisierten Anderen kritisiert?
Kritiker hinterfragen, inwieweit die Internalisierung gesellschaftlicher Normen die individuelle Freiheit einschränkt und ob eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Normen innerhalb des Modells möglich ist.
Ist der Mensch laut Mead von Geburt an ein vernünftiges Wesen?
Nein, der Mensch kommt zwar vernunftbegabt auf die Welt, besitzt aber noch keine fertige Vernunft oder Reflexionsfähigkeit; diese entstehen erst im sozialen Prozess.
- Quote paper
- Christine Porath (Author), 2007, Der Begriff des "generalisierten Anderen" in G.H. Meads "Mind, Self and Society", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127485