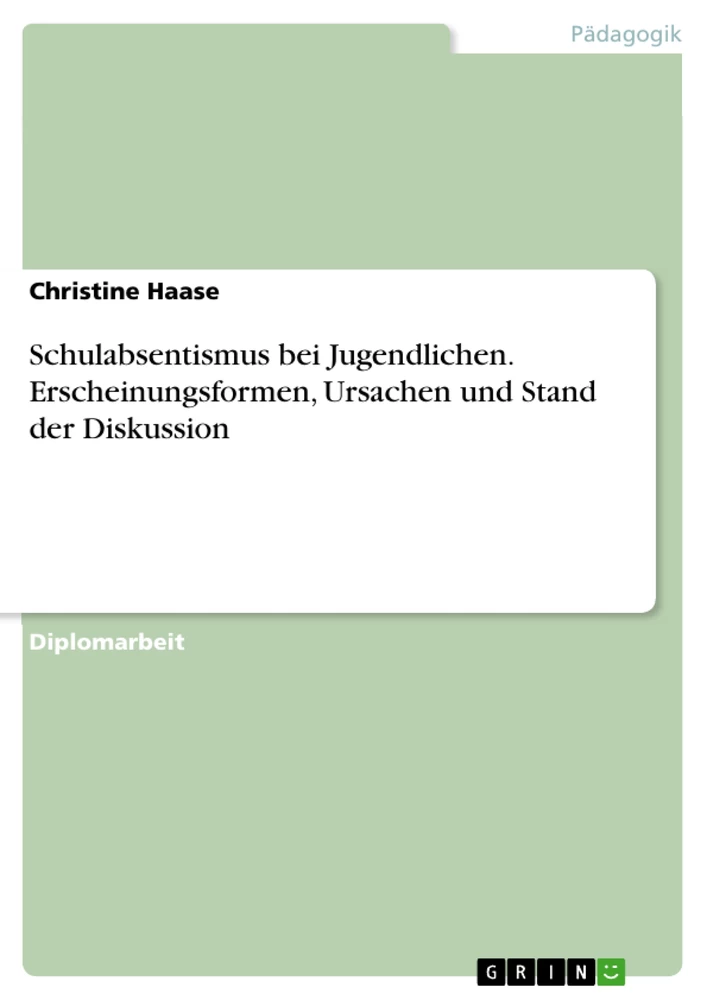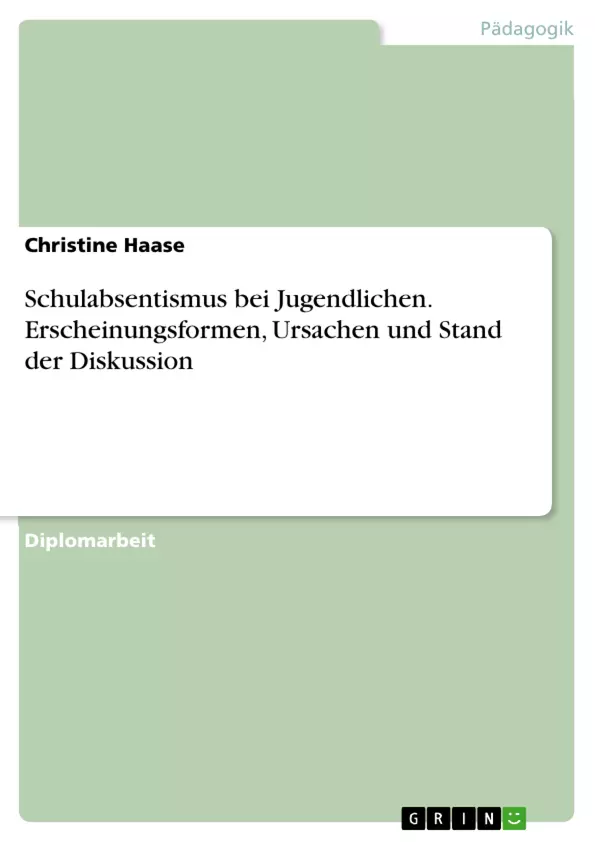Welche Weichen können und müssen gestellt werden, um die verhärtete Verweigerungshaltung von Jugendlichen gegenüber schulischen Anforderungen, aber auch ganz profanen Anforderungen der Alltagsbewältigung, vermeiden zu können und um sie stark zu machen für ein selbstbestimmtes Leben in der heutigen Gesellschaft? Um dieser Frage nachzugehen, ist es notwendig, das Problem Schulverweigerung und mögliche Ursachen für schulisches Versagen näher zu beleuchten.
Im ersten Teil der Arbeit werden die Begrifflichkeiten des Phänomens Schulverweigerung geklärt. Die unterschiedlichen Formen der Verweigerung, die unter dem Oberbegriff unterrichtsmeidende Verhaltensmuster subsummiert werden, werden erläutert. Die Jugendlichen haben äußerst heterogene Problemlagen in ihrem Gepäck, die die Arbeit mit ihnen zu einem abwechslungsreichen Unterfangen macht.
Diese beginnen verbreitet mit einem defizitärem Bindungsverhalten, mangelhaften sozialen Kompetenzen, psychischen Auffälligkeiten (ADHS, ADS, Borderline, aggressiv-dissoziale Störung, oppositionelle Verhaltensstörung etc., die recht häufig diverse Aufenthalte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nötig machen), problematischen familiären Milieus (zerrüttete Familienverhältnisse, inkonsequentes Erziehverhalten, elterliches Desinteresse, Überbehütung, Missbrauch, Misshandlungen, Vernachlässigung,…) bis hin zu gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, delinquentem Verhalten, teilweise niedrigen Intelligenzwerten, Lese-Rechtschreib-Schwächen, erheblichen Selbstwertproblemen und einigen anderen Befunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Problem Schulabsentismus und seine Erscheinungsformen
- Schulverweigerung und Schulversagen als aktuelles politisches und wirtschaftliches Problem
- Formen von Schulverweigerung und unterrichtsmeidenden Verhaltensmustern
- Schulabsentismus
- Schulschwänzen
- Schulphobie und Schulangst
- Zurückhalten
- Unterrichtsabsentismus
- Unterrichtsverweigerung
- „passive“ und „aktive“ Schulverweigerung
- Vom schulmeidenden Verhaltensmuster zum Dropout
- Individuelle, soziale und strukturelle/ schulische Bedingungsfaktoren bzw. Erklärungsansätze
- Individuelle Faktoren
- Alter/ Geschlecht
- Schul- und Leistungsangst
- Schulphobie
- Schulangst
- Soziale Faktoren
- Die Familie
- Einstellung/ Erziehungsverhalten der Eltern
- Peer-Group
- Schulverweigerung als abweichendes Verhalten
- Schulische und strukturelle Faktoren
- Schul- und Klassenklima
- Lehrer
- Die Lehrerpersönlichkeit
- Das Lehrerverhalten
- Die Erwartung des Lehrers und sein Urteil
- Vom Rausschmeißen und Ausschließen
- Individuelle Faktoren
- Interventionsmöglichkeiten zur Reduktion/Vermeidung von Schulabsentismus und Dropout bzw. zum Wiedereinstieg in systematisches Lernen
- Die Feldtheorie Kurt Lewins
- Das Netzwerk „Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ des DJI
- Angebote früher Prävention an Schulen
- Hauptschule „Heuchelhof in Würzburg
- Innerschulische Förderung abschlussgefährdeter Jugendlicher
- Das Projekt „Arbeit statt Strafe\" in Leipzig
- Außerschulische Beschulungsangebote sogenannter nicht beschulbarer „harter“ Schulverweigerer
- Das Projekt MOVE aus Berlin
- Angebote früher Prävention an Schulen
- Elternarbeit
- Kooperation von Lehrkräften und Eltern
- Empowerment-Konzepte bei Schulabsentismus
- Zusammenfassende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Schulabsentismus. Sie analysiert die verschiedenen Erscheinungsformen von Schulverweigerung und Unterrichtsmeidung, untersucht die individuellen, sozialen und schulischen Bedingungsfaktoren, die zu Schulabsentismus führen können, und beleuchtet verschiedene Interventionsmöglichkeiten zur Reduktion und Vermeidung von Schulverweigerung und Dropout.
- Definition und Erscheinungsformen von Schulabsentismus
- Individuelle, soziale und strukturelle Faktoren, die Schulabsentismus beeinflussen
- Interventionsprogramme zur Prävention und Intervention bei Schulabsentismus
- Bedeutung des schulischen und familiären Umfelds bei der Entstehung und Bewältigung von Schulabsentismus
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und anderen Institutionen zur Reduktion von Schulabsentismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Schulabsentismus ein und erläutert die Relevanz des Problems für die Gesellschaft.
- Das Problem Schulabsentismus und seine Erscheinungsformen: Dieses Kapitel definiert Schulabsentismus und beschreibt verschiedene Erscheinungsformen, wie z.B. Schulverweigerung, Schulschwänzen, Schulphobie und Unterrichtsverweigerung.
- Individuelle, soziale und strukturelle/ schulische Bedingungsfaktoren bzw. Erklärungsansätze: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Faktoren, die zu Schulabsentismus beitragen können. Es betrachtet individuelle Faktoren wie Alter, Geschlecht, Schul- und Leistungsangst, Schulphobie und Schulangst, aber auch soziale Faktoren wie die Familie, das Erziehungsverhalten der Eltern und die Peer-Group. Darüber hinaus werden schulische und strukturelle Faktoren wie das Schul- und Klassenklima, die Lehrerpersönlichkeit und das Lehrerverhalten analysiert.
- Interventionsmöglichkeiten zur Reduktion/Vermeidung von Schulabsentismus und Dropout bzw. zum Wiedereinstieg in systematisches Lernen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Interventionsmöglichkeiten vor, die helfen können, Schulabsentismus zu reduzieren oder zu vermeiden und den Wiedereinstieg in das Lernen zu ermöglichen. Es werden verschiedene Programme und Konzepte vorgestellt, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und sowohl präventiv als auch interventiv wirken können.
Schlüsselwörter
Schulabsentismus, Schulverweigerung, Schulschwänzen, Schulphobie, Schulangst, Dropout, individuelle Faktoren, soziale Faktoren, strukturelle Faktoren, Schule, Familie, Lehrer, Intervention, Prävention, Empowerment, Netzwerk, Kooperation
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Schulschwänzen und Schulphobie?
Schulschwänzen ist meist ein aktives Fernbleiben ohne Wissen der Eltern, oft aus mangelndem Interesse. Schulphobie hingegen ist angstbesetzt und oft mit Trennungsangst von den Bezugspersonen verbunden.
Welche sozialen Faktoren begünstigen Schulabsentismus?
Problematische familiäre Milieus, inkonsequentes Erziehungsverhalten, elterliches Desinteresse, aber auch der Einfluss der Peer-Group können eine Rolle spielen.
Welche schulischen Faktoren tragen zur Schulverweigerung bei?
Ein schlechtes Klassenklima, das Verhalten der Lehrkräfte oder auch institutionelle Ausschlussmechanismen können Jugendliche dazu bringen, die Schule zu meiden.
Was ist das Projekt "MOVE" aus Berlin?
MOVE ist ein außerschulisches Beschulungsangebot, das sich speziell an sogenannte "harte" Schulverweigerer richtet, die im normalen System als nicht beschulbar gelten.
Was versteht man unter "passivem" Schulabsentismus?
Passiver Absentismus bedeutet, dass der Schüler zwar körperlich anwesend ist, sich aber innerlich völlig vom Unterrichtsgeschehen distanziert und die Mitarbeit verweigert.
- Quote paper
- Christine Haase (Author), 2011, Schulabsentismus bei Jugendlichen. Erscheinungsformen, Ursachen und Stand der Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1273776