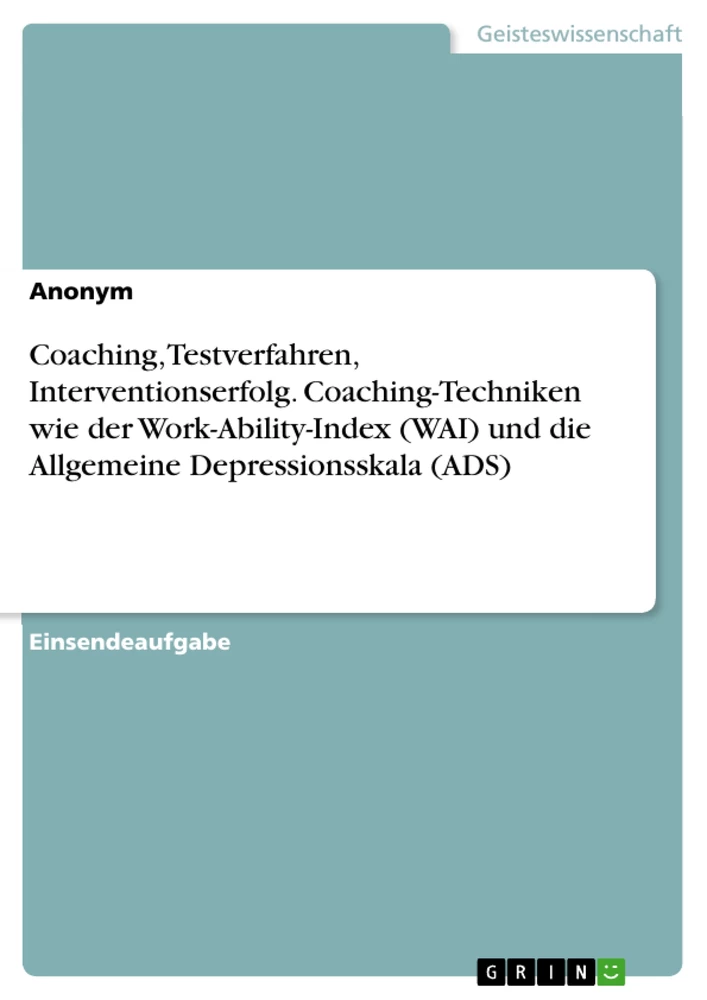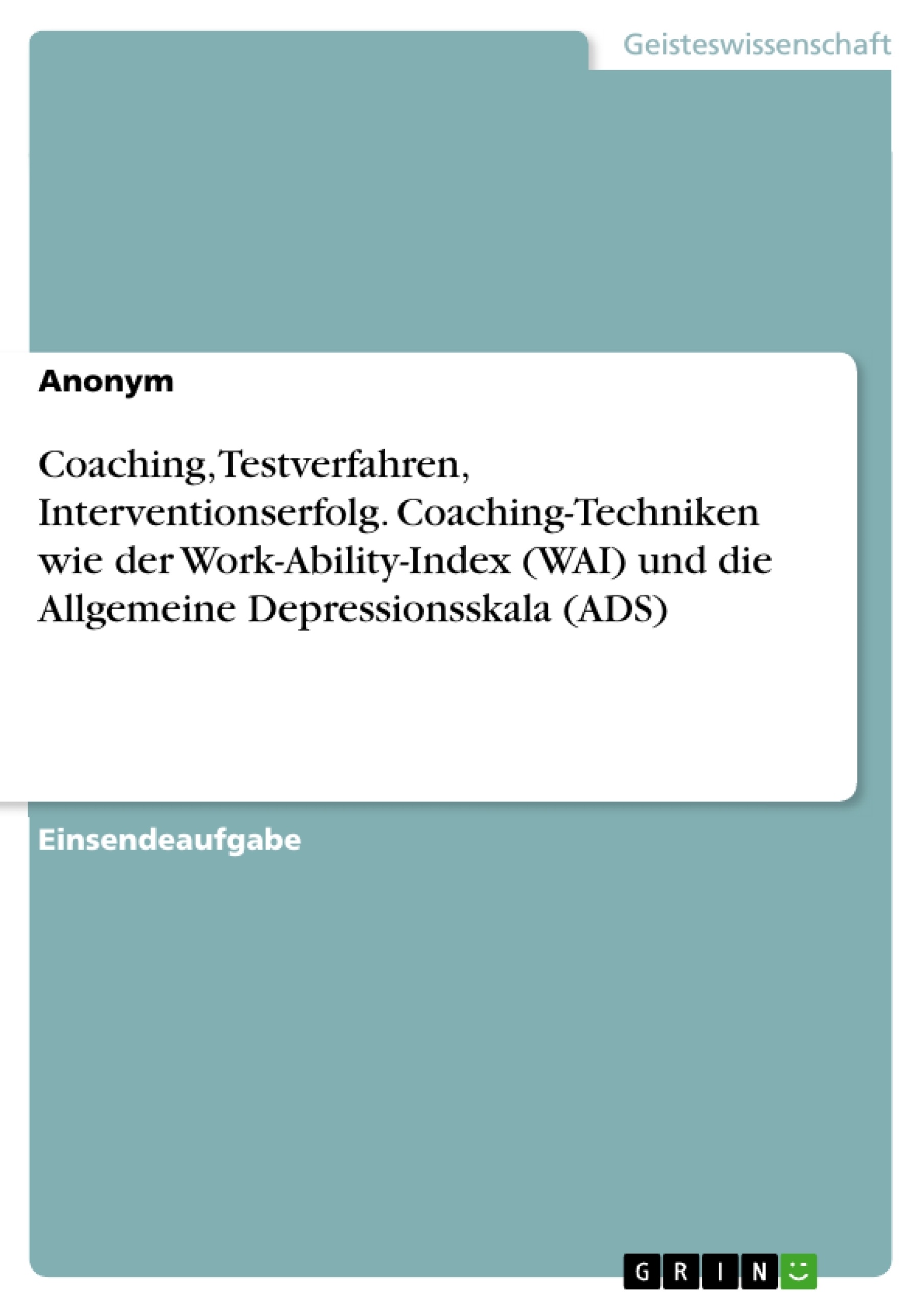Die erste Aufgabe beinhaltet die Themengebiete Coaching und Supervision. Es werden der Begriff und das Verständnis beider Themen herausgearbeitet, um dann beide Begriffe voneinander abzugrenzen, indem unter anderem ein Beispiel vorgebracht wird.
Die unterschiedlichen Techniken eines Coachings können unter anderem Fragen, Gesprächstechniken, Feedback geben und Testverfahren darstellen. Im zweiten Kapitel werden die Coaching-Techniken Testverfahren behandelt, wobei sich hier auf den Work-Ability-Index (WAI) und auf die Allgemeine Depressionsskala (ADS) konzentriert wird, was sich durch das Vorstellen der beiden Testverfahren äußert sowie je eine Beispielsituation umfasst und die Grenzen der Verfahren aufzeigt.
In der letzten Aufgabe wird das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeuten und Patient behandelt, indem die Rolle des Therapeuten in der Gesprächspsychotherapie beleuchtet wird und die Erfolgsfaktoren aus der Sicht von Carl Rogers miteinbezogen werden. Im Coaching gibt es eine Fülle an Methoden und Tools, die je nach "Methodenschule" bzw. Coaching-Ausbildung unterschiedlich ausfallen. Doch neben alldem gehört vor allem eines zum Coaching, und zwar die Kommunikation zwischen Klienten/ Patient und Coach. Ganz gleich, welche Techniken verwendet werden, die Kommunikation muss stimmig sein. Missverständnisse und Konflikte können zu Spannungen und Streit führen, welche in Coaching-Situationen keinen Platz haben, weshalb die Kommunikation bei jeder Coaching-Technik im Vordergrund stehen muss.
Inhaltsverzeichnis
- B1. Coaching und Supervision
- 1.1 Coaching
- 1.2 Supervision
- 1.3 Unterschied/Abgrenzung
- B2. Werkzeuge der Diagnostik
- 2.1 Work-Ability-Index
- 2.1.1 Beispiel
- 2.1.2 Nutzen und Grenzen
- 2.2 Allgemeine Depressionsskala
- 2.2.1 Beispiel
- 2.2.2 Nutzen und Grenzen
- B3. Die Rolle des Therapeuten
- 3.1 Rolle des Therapeuten in der Gesprächspsychotherapie
- 3.2 Erfolgsfaktoren aus der Sicht von Carl Rogers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Themen Coaching und Supervision. Sie beleuchtet die Bedeutung und Definition beider Konzepte und hebt deren Unterschiede hervor. Darüber hinaus werden wichtige Werkzeuge der Diagnostik, wie der Work-Ability-Index und die Allgemeine Depressionsskala, vorgestellt und ihre Anwendungsmöglichkeiten sowie Grenzen diskutiert. Die Arbeit beschäftigt sich auch mit der Rolle des Therapeuten in der Gesprächspsychotherapie und den Erfolgsfaktoren, die Carl Rogers herausstellte.
- Definition und Abgrenzung von Coaching und Supervision
- Anwendung und Relevanz von diagnostischen Werkzeugen
- Die Rolle des Therapeuten in der Gesprächspsychotherapie
- Erfolgsfaktoren in der Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers
- Praxisbezogene Beispiele und Fallbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
B1. Coaching und Supervision
Dieses Kapitel erläutert die Konzepte Coaching und Supervision und stellt ihre jeweiligen Definitionen und Anwendungsbereiche vor. Es wird ein Vergleich zwischen den beiden Begriffen gezogen und deren Abgrenzung anhand eines Beispiels verdeutlicht.
B2. Werkzeuge der Diagnostik
In diesem Kapitel werden zwei wichtige diagnostische Werkzeuge, der Work-Ability-Index und die Allgemeine Depressionsskala, vorgestellt. Es wird ein Beispiel für die Anwendung beider Werkzeuge gegeben und ihre Stärken und Schwächen diskutiert.
B3. Die Rolle des Therapeuten
Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Rolle des Therapeuten in der Gesprächspsychotherapie. Es werden die wichtigsten Aufgaben des Therapeuten beleuchtet und die Erfolgsfaktoren aus der Sicht von Carl Rogers erläutert.
Schlüsselwörter
Coaching, Supervision, Work-Ability-Index, Allgemeine Depressionsskala, Gesprächspsychotherapie, Therapeutenrolle, Carl Rogers, Erfolgsfaktoren, Diagnostik, Persönlichkeitsentwicklung, Beruflicher Kontext, Ressourcenaktivierung, Selbstmanagement, Selbstreflexion, Spannungsfeld, Praxis, Theorie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Coaching, Testverfahren, Interventionserfolg. Coaching-Techniken wie der Work-Ability-Index (WAI) und die Allgemeine Depressionsskala (ADS), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1271766