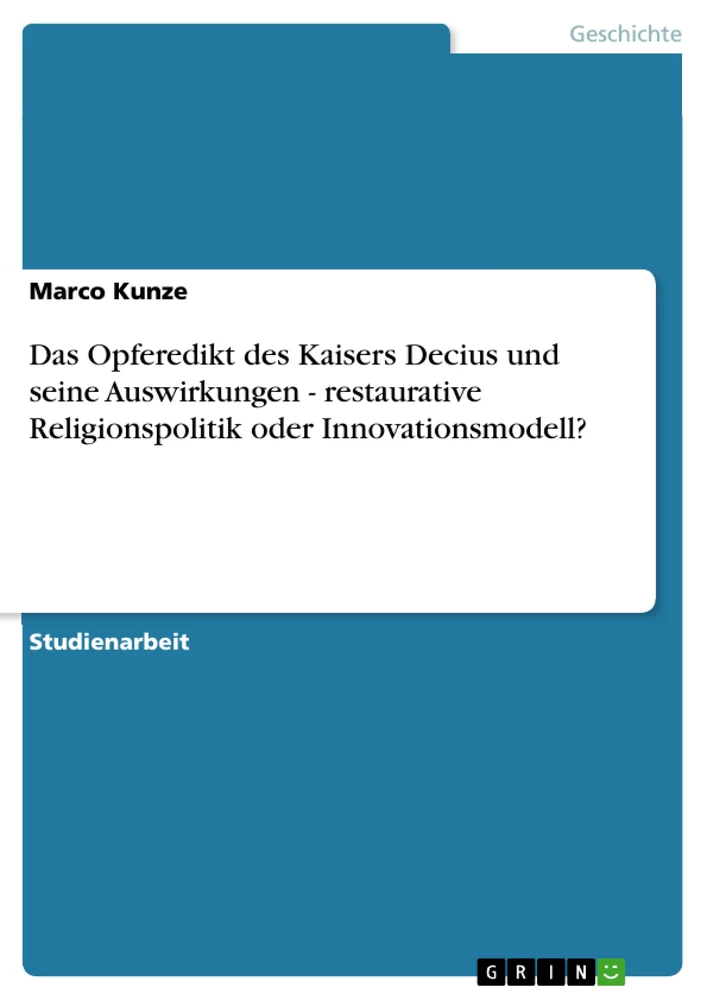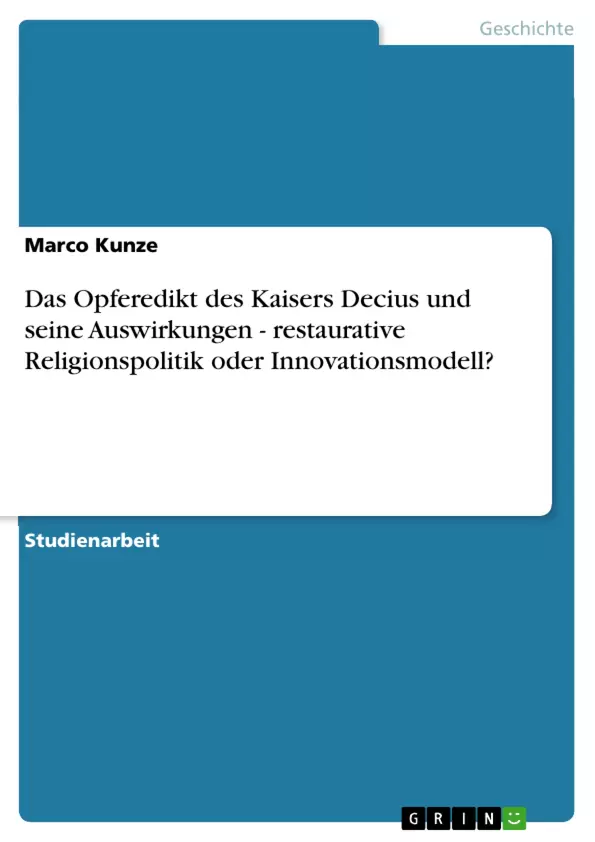Das Konservative und Traditionelle hat in Zeiten der Krise Hochkonjunktur. Die Menschen sehen gerade dann gern auf die vermeintlich goldenen Zeiten vergangener Epochen zurück und wünschen sich diesen alten Glanz zurück. Positive wie negative Beispiele für solche Versuche der Anknüpfung und Erneuerung sind in der Geschichte immer wieder anzutreffen. So erleben auch wir gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich schwieriger Zeit einen Trend zugunsten konservativer Werte und Ideale. Die Umsetzung und Übermittlung erfolgt dabei jedoch immer mittels gegenwärtiger Methoden. So ist es auch zu verstehen, dass Religion und Kirche, wie z.B. die Euphorie beim Besuch des Papstes zeigt, nach langer Zeit wieder regen Zulauf zu verzeichnen haben. In der Antike war gerade die Religion das zentrale Element zur Weltdeutung und es war in unserem heutigen Wortsinne fortschrittlich auf althergebrachte Werte und Normen zurückzugreifen. So ist das Opferedikt des Kaisers Decius, das die gesamte Reichsbevölkerung zwangsweise dazu auffordert, den traditionellen Göttern zum Zeichen der Verehrung zu opfern, durchaus als Rückgriff auf althergebrachte Sitten in Form einer nie da gewesenen staatlichen Maßnahme anzusehen. Ziel dieser Arbeit ist es das nicht wörtlich überlieferte Edikt dahingehend zu untersuchen, ob es von seinen Gedankenhintergrund den konservativen religiösen Tendenzen seiner Entstehungszeit folgt, oder aber neue Strukturen für die Religionsausübung und deren Überwachung im römischen Reich schafft.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1. Die Ausgangslage
- 1.1 Die Situation im römischen Reich zum Regierungsbeginn des Kaisers Decius
- 1.2 Religiöse und gesellschaftliche Tendenzen
- 1.3 Politische Maßnahmen des Kaisers vor dem Opferedikt
- 2. Das Opferedikt des Kaisers Decius
- 2.1 Die Quellenlage
- 2.2 Inhalt
- 2.3 Anwendung und Maßnahmen
- 3. Gleichberechtigung oder Vetorecht? – Die Kompetenzfrage
- 3.1 Bewahrung und Erneuerung der alten Kulte
- 3.2 Neustrukturierung und Zentralisierung der Religion
- 3.3 Verfolgung der Christen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Opferedikt des Kaisers Decius und analysiert dessen Hintergründe, Inhalte und Auswirkungen. Es wird geprüft, ob das Edikt Ausdruck konservativer religiöser Tendenzen war oder ein innovatives Modell der Religionspolitik darstellte.
- Die politische und gesellschaftliche Krise des römischen Reiches zur Zeit Decius'
- Die Rolle der traditionellen Religion im römischen Reich und die Herausforderungen durch neue Kulte
- Der Inhalt und die Anwendung des Opferedikts
- Die Debatte um die Intentionen und Folgen des Edikt (Konservierung vs. Innovation)
- Die Auswirkungen des Edikts auf die Christen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Ausgangslage: Dieses Kapitel beschreibt die innen- und außenpolitische Krise des römischen Reiches zu Beginn der Regierungszeit des Kaisers Decius. Es analysiert den wirtschaftlichen Niedergang, die militärischen Bedrohungen durch Germanen, Goten und Sasaniden, sowie die zunehmende Instabilität der kaiserlichen Macht, die durch Usurpationen und die Unfähigkeit vorheriger Kaiser, die Probleme zu lösen, geprägt war. Die Kapitel betont die Rolle der religiösen Loyalität im Kontext der Krise und den schleichenden Rückgang der Verbundenheit zu traditionellen römischen Göttern, verbunden mit dem Aufkommen neuer Kulte und der lokalen Ausprägung der religiösen Praktiken. Der Fokus liegt auf dem Umfeld, das zu Decius' Religionspolitik führte.
2. Das Opferedikt des Kaisers Decius: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Opferedikt selbst. Angesichts der spärlichen Quellenlage werden die vorhandenen Informationen aus christlichen Quellen und amtlichen Opferbescheinigungen analysiert, um den Inhalt und die Anwendung des Edikts zu rekonstruieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Rekonstruktion der staatlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das Opfergebot. Die Ambivalenz der Quellen und die Schwierigkeiten bei der Interpretation des nicht erhaltenen Originals werden ausführlich diskutiert.
Häufig gestellte Fragen zum Opferedikt des Kaisers Decius
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Opferedikt des Kaisers Decius aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. Sie untersucht die Hintergründe, den Inhalt und die Auswirkungen des Edikts und beleuchtet die Frage, ob es ein konservatives oder innovatives Modell der Religionspolitik darstellte. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Beschreibung der Ausgangslage im römischen Reich, eine detaillierte Analyse des Opferedikts selbst, eine Auseinandersetzung mit der Kompetenzfrage (Gleichberechtigung oder Vetorecht der Religionen) und ein Fazit.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische und gesellschaftliche Krise im römischen Reich unter Decius, die Rolle der traditionellen Religion und Herausforderungen durch neue Kulte, den Inhalt und die Anwendung des Opferedikts, die Debatte um die Intentionen und Folgen des Edikts (Konservierung vs. Innovation) und die Auswirkungen des Edikts auf die Christen. Es wird die Quellenlage, die Maßnahmen bei Verstößen gegen das Edikt und die Ambivalenz der Quelleninterpretation ausführlich diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beschreibt die Ausgangslage, inklusive der innen- und außenpolitischen Krise, wirtschaftlichem Niedergang, militärischen Bedrohungen und dem Rückgang der Verbundenheit zu traditionellen römischen Göttern. Kapitel 2 konzentriert sich auf das Opferedikt selbst, analysiert die Quellenlage und rekonstruiert Inhalt und Anwendung des Edikts. Kapitel 3 befasst sich mit der Kompetenzfrage – Gleichberechtigung oder Vetorecht – im Kontext der Bewahrung und Erneuerung alter Kulte, der Neustrukturierung und Zentralisierung der Religion und der Verfolgung der Christen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf christliche Quellen und amtliche Opferbescheinigungen, um den Inhalt und die Anwendung des Opferedikts zu rekonstruieren. Die spärliche Quellenlage und die Schwierigkeiten bei der Interpretation des nicht erhaltenen Originals werden explizit thematisiert.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob das Opferedikt des Kaisers Decius Ausdruck konservativer religiöser Tendenzen war oder ein innovatives Modell der Religionspolitik darstellte.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn der vollständige Text der Arbeit vorliegt. Die Zusammenfassung bietet nur einen Überblick über die behandelten Themen und den Aufbau der Arbeit.)
- Arbeit zitieren
- Marco Kunze (Autor:in), 2005, Das Opferedikt des Kaisers Decius und seine Auswirkungen - restaurative Religionspolitik oder Innovationsmodell?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126869