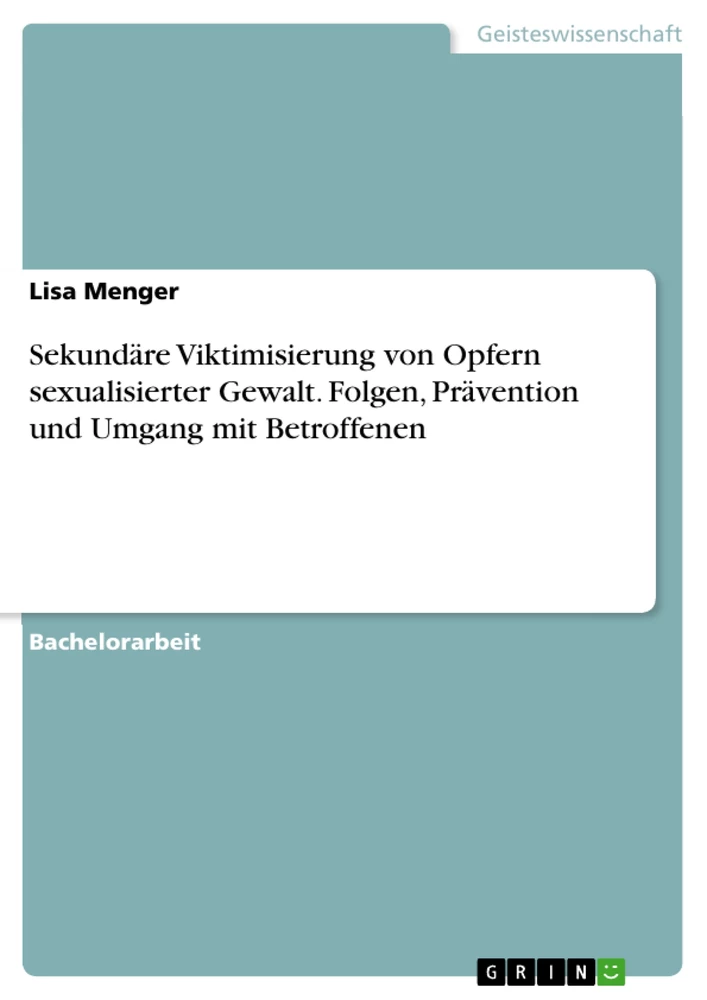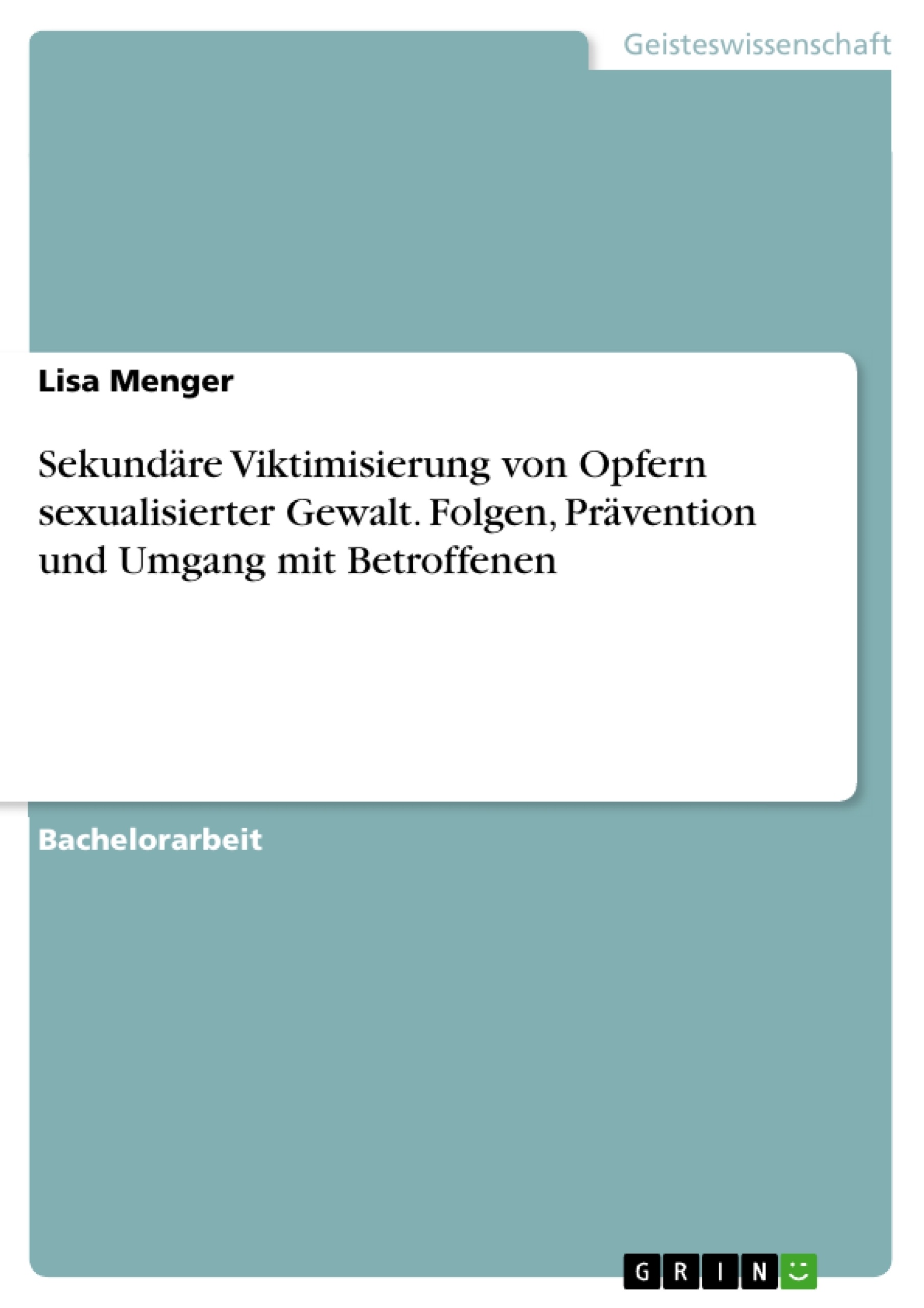Die Bachelorarbeit widmet sich den Fragen, welche Akteur_innen sekundär viktimisierend wirken und welche Auswirkungen die sekundäre Viktimisierung auf die Betroffenen hat. Weiterhin wird der Frage nachgegangen, welche Präventionsmaßnahmen eine sekundäre Viktimisierung erfolgreich verhindern können.
Laut einer Studie der Europäischen Grundrechtsagentur ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von sexualisierter und/oder physischer Gewalt betroffen und mehr als jede zweite Frau wird sexuell belästigt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht sogar davon aus, dass etwa jede siebte Frau eine Form von schwerer sexualisierte Gewalt erlebt.
Die Studienergebnisse zeigen, dass sexualisierte Gewalt nicht, wie üblich angenommen, ein Randphänomen darstellt, sondern ein Alltagsproblem, wovon Mädchen und Frauen besonders häufig betroffen sind. Das Wissen möglicherweise jederzeit und überall Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden, hat nicht nur eine Einschränkung des Verhaltens zur Folge, sondern stellt auch einen tiefgreifenden Einschnitt in die Lebensgestaltung vieler Frauen dar.
Nach wie vor stellt die Warnung vor sexualisierter Gewalt einen Teil der weiblichen Erziehung dar. Noch vor jeglicher Form von sexueller Aufklärung erfahren Mädchen, dass sie aufpassen müssen, indem sie gewisse Orte, Zeiten oder Situationen meiden und ihr Verhalten entsprechend anpassen.
Dabei ist das eigene Zuhause am gefährlichsten. Denn die meisten Übergriffe finden im sozialen Nahraum des Opfers und durch eine_n bekannte_n Täter_in statt. Neben den Folgen der primären Viktimisierung im Zuge der Straftat, fühlen sich Betroffene häufig zusätzlich mit unangemessenen und negativen Reaktionen des sozialen Umfeldes und der Instanzen sozialer Kontrolle konfrontiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Thematische Einführung
- 2 Kriminologische Einordnung sexualisierter Gewalt
- 3 Anzeigeverhalten
- 4 Viktimisierungsprozess
- 5 Folgen der Opferschädigung
- 6 Prävention
- 7 Umgang mit Betroffenen im Kontext Sozialer Arbeit
- 8 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die sekundäre Viktimisierung weiblicher Opfer sexualisierter Gewalt. Das Ziel ist es, die Akteur*innen zu identifizieren, die sekundär viktimisierend wirken, die Auswirkungen auf die Betroffenen zu beleuchten und mögliche präventive Maßnahmen zu erörtern. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Aufklärung und Sensibilisierung für dieses Thema.
- Kriminologische Einordnung sexualisierter Gewalt
- Anzeigeverhalten von Opfern sexualisierter Gewalt
- Der Viktimisierungsprozess und seine Akteur*innen
- Folgen der Opferschädigung (primäre und sekundäre Viktimisierung)
- Präventionsmaßnahmen gegen sekundäre Viktimisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Thematische Einführung: Die Arbeit beginnt mit der erschreckenden Statistik sexualisierter Gewalt in Deutschland und Europa. Sie betont das hohe Dunkelfeld und die weitreichenden Folgen für Betroffene, die nicht nur die primäre Viktimisierung durch die Tat selbst, sondern auch die sekundäre Viktimisierung durch unangemessenes Verhalten des sozialen Umfelds und Institutionen erfahren. Die Arbeit fokussiert auf die sekundäre Viktimisierung weiblicher Opfer und untersucht die beteiligten Akteur*innen, deren Auswirkungen und mögliche Präventionsmaßnahmen.
2 Kriminologische Einordnung sexualisierter Gewalt: Dieses Kapitel liefert eine kriminologische und strafrechtliche Einordnung sexualisierter Gewalt. Es fokussiert auf geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ab 18 Jahren, die von einem oder mehreren Männern verübt wurde. Der allgemeine Gewaltbegriff wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei zwischen körperlicher und psychischer Gewalt unterschieden wird. Die Arbeit betont, dass auch Männer, Kinder und LSBTIQ+ Personen von sexualisierter Gewalt betroffen sein können, dies aber nicht der Fokus dieser Arbeit ist.
3 Anzeigeverhalten: Das Kapitel analysiert das Anzeigeverhalten von Opfern sexualisierter Gewalt. Es wird untersucht, warum nur ein geringer Teil der Straftaten angezeigt wird und welche Rolle die Täter-Opfer-Beziehung dabei spielt. Die Komplexität der Entscheidung, eine Anzeige zu erstatten, wird hervorgehoben, sowie die Faktoren, die Betroffene von einer Anzeige abhalten können.
4 Viktimisierungsprozess: Dieses Kapitel behandelt den Viktimisierungsprozess im Detail, beginnend mit einer kritischen Betrachtung des Opferbegriffs. Der Schwerpunkt liegt auf der sekundären Viktimisierung, die durch das Verhalten von Polizei, Gerichten, sozialem Umfeld und Medien analysiert wird. Aus den Ergebnissen werden Ansatzpunkte für opferorientierte Prävention abgeleitet.
5 Folgen der Opferschädigung: Hier werden die Folgen der Opferschädigung auf psychischer, physischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene detailliert dargestellt, wobei die langfristigen Auswirkungen der primären und sekundären Viktimisierung hervorgehoben werden. Die vielfältigen Herausforderungen, denen Betroffene gegenüberstehen, werden beleuchtet.
6 Prävention: Dieses Kapitel befasst sich mit Präventionsmaßnahmen, die einer sekundären Viktimisierung entgegenwirken können. Es werden verschiedene Strategien und Ansätze vorgestellt, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen, um ein unterstützendes Umfeld für Betroffene zu schaffen und zukünftige Fälle zu verhindern.
7 Umgang mit Betroffenen im Kontext Sozialer Arbeit: Das Kapitel untersucht die Rolle Sozialer Arbeit im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt. Es wird analysiert, inwieweit Sozialarbeiter*innen zu einer sekundären Viktimisierung beitragen können und welche Merkmale einen professionellen Umgang kennzeichnen. Die Bedeutung einer sensiblen und trauma-informierten Betreuung wird unterstrichen.
Schlüsselwörter
Sekundäre Viktimisierung, sexualisierte Gewalt, Opfer, Frauen, Anzeigeverhalten, Viktimisierungsprozess, Prävention, Soziale Arbeit, Polizei, Gericht, Medien, psychische Folgen, physische Folgen, soziale Folgen, wirtschaftliche Folgen, Trauma.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Sekundäre Viktimisierung weiblicher Opfer sexualisierter Gewalt
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die sekundäre Viktimisierung weiblicher Opfer sexualisierter Gewalt. Sie analysiert die Akteur*innen, die sekundär viktimisierend wirken, beleuchtet die Auswirkungen auf die Betroffenen und erörtert mögliche präventive Maßnahmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine kriminologische Einordnung sexualisierter Gewalt, eine Analyse des Anzeigeverhaltens, eine detaillierte Betrachtung des Viktimisierungsprozesses (inkl. primärer und sekundärer Viktimisierung), die Darstellung der Folgen der Opferschädigung (psychisch, physisch, sozial, wirtschaftlich), die Erörterung von Präventionsmaßnahmen und den Umgang mit Betroffenen im Kontext Sozialer Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Akteur*innen sekundärer Viktimisierung zu identifizieren, die Auswirkungen auf die Betroffenen zu beleuchten und präventive Maßnahmen zu erörtern. Sie möchte einen Beitrag zur Aufklärung und Sensibilisierung für dieses Thema leisten.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Eine thematische Einführung, die kriminologische Einordnung sexualisierter Gewalt, die Analyse des Anzeigeverhaltens, die Darstellung des Viktimisierungsprozesses, die Folgen der Opferschädigung, die Erörterung von Präventionsmaßnahmen, der Umgang mit Betroffenen in der Sozialen Arbeit und abschließende Schlussfolgerungen.
Wer wird in der Arbeit als Akteur*in sekundärer Viktimisierung betrachtet?
Die Arbeit untersucht das Verhalten von Polizei, Gerichten, dem sozialen Umfeld und den Medien im Hinblick auf sekundäre Viktimisierung. Es wird analysiert, inwieweit diese Akteur*innen durch ihr Handeln zu einer weiteren Viktimisierung der Betroffenen beitragen.
Welche Folgen der Opferschädigung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die psychischen, physischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der primären und sekundären Viktimisierung. Die langfristigen Auswirkungen auf die Betroffenen werden detailliert dargestellt.
Welche Präventionsmaßnahmen werden diskutiert?
Die Arbeit stellt verschiedene Strategien und Ansätze vor, die auf verschiedenen Ebenen ansetzen, um ein unterstützendes Umfeld für Betroffene zu schaffen und zukünftige Fälle von sekundärer Viktimisierung zu verhindern.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit im Kontext der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle Sozialer Arbeit im Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt. Sie analysiert, wie Sozialarbeiter*innen zu einer sekundären Viktimisierung beitragen können und welche Merkmale einen professionellen und trauma-informierten Umgang kennzeichnen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Sekundäre Viktimisierung, sexualisierte Gewalt, Opfer, Frauen, Anzeigeverhalten, Viktimisierungsprozess, Prävention, Soziale Arbeit, Polizei, Gericht, Medien, psychische Folgen, physische Folgen, soziale Folgen, wirtschaftliche Folgen, Trauma.
- Quote paper
- Lisa Menger (Author), 2022, Sekundäre Viktimisierung von Opfern sexualisierter Gewalt. Folgen, Prävention und Umgang mit Betroffenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1267607