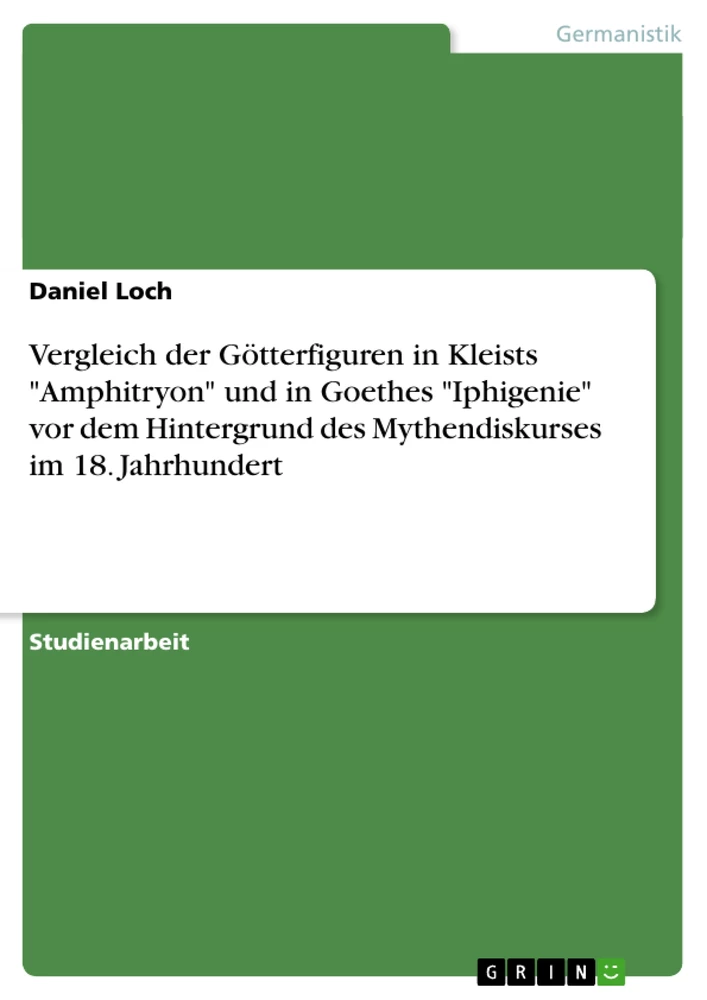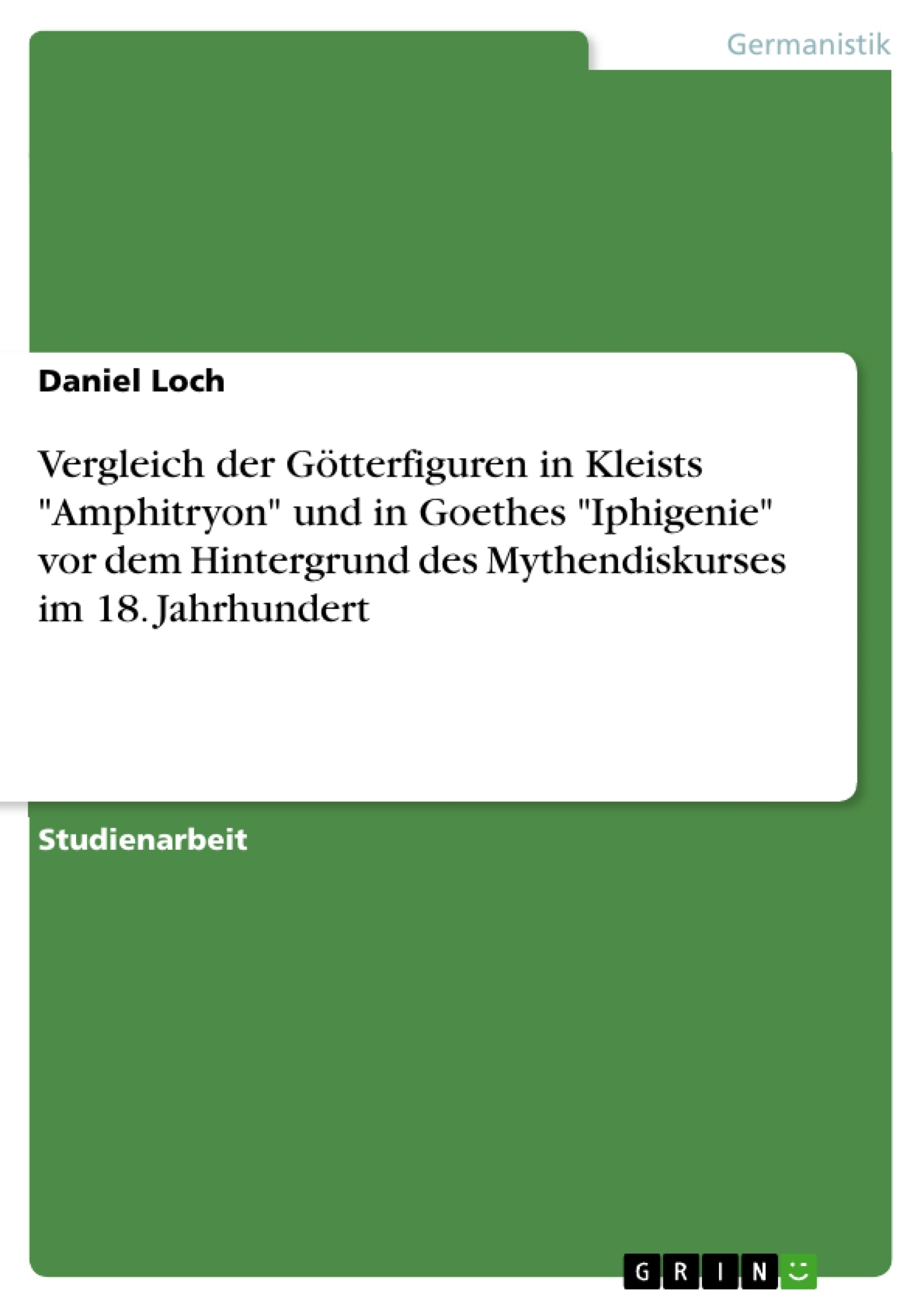Aller Interpretationsvielfalt der vergangenen Jahrhunderte zum Trotz verbindet ein gattungsübergreifendes literaturhistorisches Merkmal Kleists "Amphitryon" mit vielen anderen Werken jener Zeit um 1800 und bildet somit ein unverrückbares Fundament für ein offenes hermeneutisches Verfahren: Der antike Mythos und seine Gottheiten sind nicht nur fester Stoffbestandteil von Kleists Verwechselungskomödie, sondern auch Goethes "Iphigenie auf Tauris" verweist auf eine mythische Symbolik als Symptom der Mythologiedebatte im 18. Jahrhundert. Ganz unzweifelhaft sind der antike Mythos auf der einen Seite und seine Gottheiten auf der anderen, untrennbar miteinander verknüpft. Eine genauere Betrachtung der Götter kann demnach nur im Kontext ihrer spezifischen Einbettung in den Mythenstoff fruchtbar gestaltet werden.
Diesen theoretischen Überlegungen folgend sollen die Götterfiguren der beiden Dramen miteinander verglichen werden. Die zentrale Leitfrage dieser Arbeit lautet: Welche Unterschiede bestehen in der mythopoetischen Stoffverarbeitung beider Werke und welche kunsttheoretischen Auffassungen ihrer Autoren lassen sich daraus ableiten?
Im Hauptteil dieser Ausarbeitung soll eine textintentionale Analyse der Götterfiguren durchgeführt werden. Hierbei liegt der Deutungsschwerpunkt auf dem Mensch-Gott-Verhältnis, um das poetologische Wirken der mythischen Götter in Relation zu ihren antiken Vorbildern zu betrachten. Im Schussteil soll - auf Grundlage des Vergleichs der Götterfiguren - der autorspezifische und kunstphilosophische Charakter des Mythos freigelegt werden. Doch zunächst muss in einem literaturhistorischen Abriss der Frage nachgegangen werden, warum eine ganze Literaturepoche eine starke Affinität zu antiken Stoffen signalisierte und aus welchem Grund auf die altgriechische Mythenwelt zurückgegriffen wurde?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der antike Mythos in der Dichtung des 18. Jahrhunderts
- 3. Gegenüberstellung der Götterfiguren
- 3.1 Götterfiguren im "Amphitryon": Jupiter, Merkur, Herkules
- 3.2 Gottesfigur in der "Iphigenie": Diana
- 4. Divergierende Dimensionen der Mythenrezeption: Kleist vs. Goethe
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Darstellung von Götterfiguren in Kleists "Amphitryon" und Goethes "Iphigenie" vor dem Hintergrund des Mythendiskurses des 18. Jahrhunderts. Die zentrale Fragestellung untersucht die Unterschiede in der mythopoetischen Stoffverarbeitung beider Werke und die daraus ableitbaren kunsttheoretischen Auffassungen der Autoren.
- Der antike Mythos in der Literatur des 18. Jahrhunderts
- Vergleich der Götterfiguren in Kleists "Amphitryon" und Goethes "Iphigenie"
- Das Mensch-Gott-Verhältnis in beiden Dramen
- Die kunsttheoretischen Auffassungen von Goethe und Kleist
- Die Rolle des Mythos als Vermittlungsmedium zwischen Tradition und Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die unterschiedlichen Rezeptionen von Kleists "Amphitryon", von höchstem Lob bis zu didaktisch begründeter Zurückhaltung. Sie hebt die zentrale Rolle des antiken Mythos und seiner Gottheiten in beiden Dramen hervor und kündigt den Vergleich der Götterfiguren und die Analyse der kunsttheoretischen Auffassungen der Autoren an. Die Arbeit untersucht, warum die Literaturepoche eine starke Affinität zu antiken Stoffen zeigte und wie diese in der Dichtung verarbeitet wurden.
2. Der antike Mythos in der Dichtung des 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption des antiken Mythos im 18. Jahrhundert, beginnend mit Winckelmanns Einfluss und Lessings Übertragung auf die Poesie. Es beschreibt den dynamischen Prozess der Mythenverarbeitung, der Modifikation und Weiterentwicklung historischer Traditionsstränge. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen der Kunsttheorie der Weimarer Klassik und der Frühromantik, wobei Gemeinsamkeiten in der Mythologiedebatte herausgearbeitet werden. Es wird gezeigt, wie griechische Götter als Medium der Poesie dienten und wie sich das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen im Laufe der Zeit veränderte, mit einer zunehmenden Annäherung göttlicher Figuren an die menschliche Sphäre und einem dialektischen Verhältnis zwischen menschlichem Handeln und göttlichem Ratschluss.
3. Gegenüberstellung der Götterfiguren: Dieses Kapitel vergleicht die Götterfiguren in "Amphitryon" (Jupiter, Merkur, Herkules) und "Iphigenie" (Diana). Es analysiert die Darstellung der Götter, ihr Wirken und ihre Rolle in den jeweiligen Dramen. Es wird darauf eingegangen, wie die Götterfiguren in der Mythenrezeption der Goethezeit die Stellung omnipräsenter metaphysischer Wesen verlieren und sich eine Annäherung an die menschliche Sphäre vollzieht. Die Analyse der Götterfiguren dient als Grundlage für den Vergleich der kunstphilosophischen Auffassungen der Autoren.
Schlüsselwörter
Kleist, Goethe, Amphitryon, Iphigenie, antiker Mythos, Götterfiguren, Mythologiedebatte 18. Jahrhundert, Mensch-Gott-Verhältnis, Kunsttheorie, Mythenrezeption, Weimarer Klassik, Frühromantik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Götterfiguren in Kleists "Amphitryon" und Goethes "Iphigenie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit vergleicht die Darstellung von Götterfiguren in Heinrich von Kleists "Amphitryon" und Johann Wolfgang von Goethes "Iphigenie auf Tauris". Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der mythopoetischen Stoffverarbeitung beider Werke und den daraus resultierenden kunsttheoretischen Auffassungen der Autoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rezeption des antiken Mythos im 18. Jahrhundert, insbesondere den Einfluss von Winckelmann und Lessing. Sie analysiert das Mensch-Gott-Verhältnis in beiden Dramen, vergleicht die Götterfiguren (Jupiter, Merkur, Herkules in "Amphitryon"; Diana in "Iphigenie") und beleuchtet die kunsttheoretischen Positionen von Goethe und Kleist im Kontext der Weimarer Klassik und der Frühromantik. Ein zentrales Thema ist die Rolle des Mythos als Bindeglied zwischen Tradition und Moderne.
Welche Götterfiguren werden im Detail verglichen?
Im Kapitel 3 werden die Götterfiguren in "Amphitryon" (Jupiter, Merkur, Herkules) und "Iphigenie" (Diana) detailliert gegenübergestellt. Die Analyse umfasst die Darstellung der Götter, ihr Wirken und ihre Rolle innerhalb der jeweiligen Dramen. Es wird untersucht, wie sich die Vorstellung von Göttern im Laufe der Zeit veränderte und wie sie sich der menschlichen Sphäre annäherten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der antike Mythos in der Dichtung des 18. Jahrhunderts, Gegenüberstellung der Götterfiguren, Divergierende Dimensionen der Mythenrezeption: Kleist vs. Goethe und Fazit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kleist, Goethe, Amphitryon, Iphigenie, antiker Mythos, Götterfiguren, Mythologiedebatte 18. Jahrhundert, Mensch-Gott-Verhältnis, Kunsttheorie, Mythenrezeption, Weimarer Klassik, Frühromantik.
Welche zentrale Fragestellung wird untersucht?
Die zentrale Fragestellung untersucht die Unterschiede in der mythopoetischen Stoffverarbeitung in Kleists "Amphitryon" und Goethes "Iphigenie" und die daraus ableitbaren kunsttheoretischen Auffassungen der Autoren.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der Kapitel?
Die HTML-Datei enthält detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung und endend mit einer Zusammenfassung der Gegenüberstellung der Götterfiguren.
- Quote paper
- Daniel Loch (Author), 2008, Vergleich der Götterfiguren in Kleists "Amphitryon" und in Goethes "Iphigenie" vor dem Hintergrund des Mythendiskurses im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126673