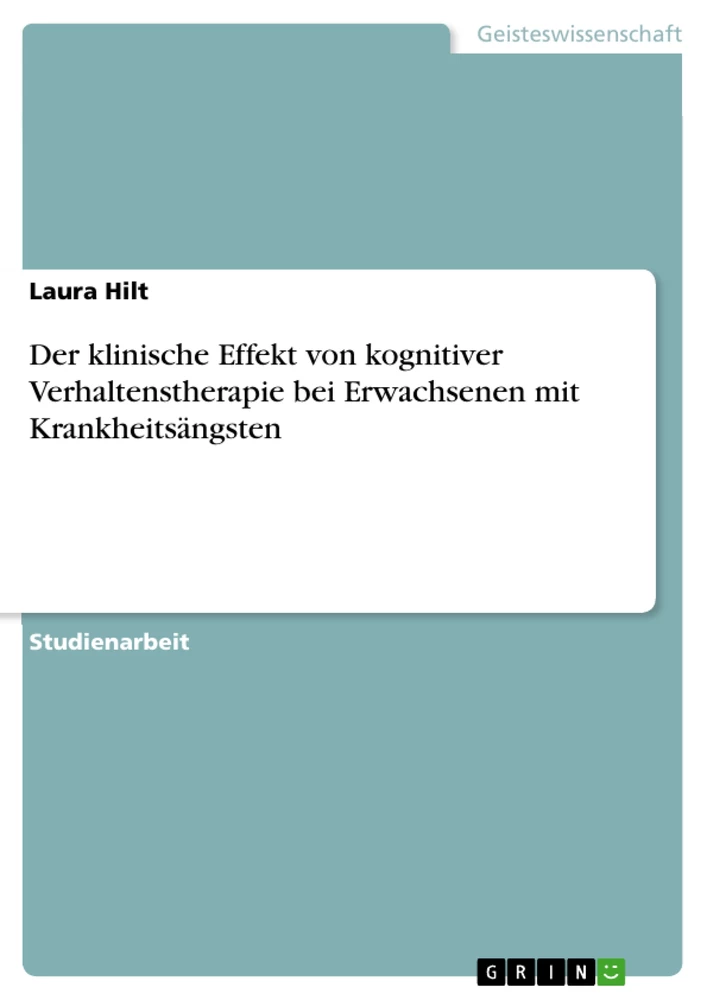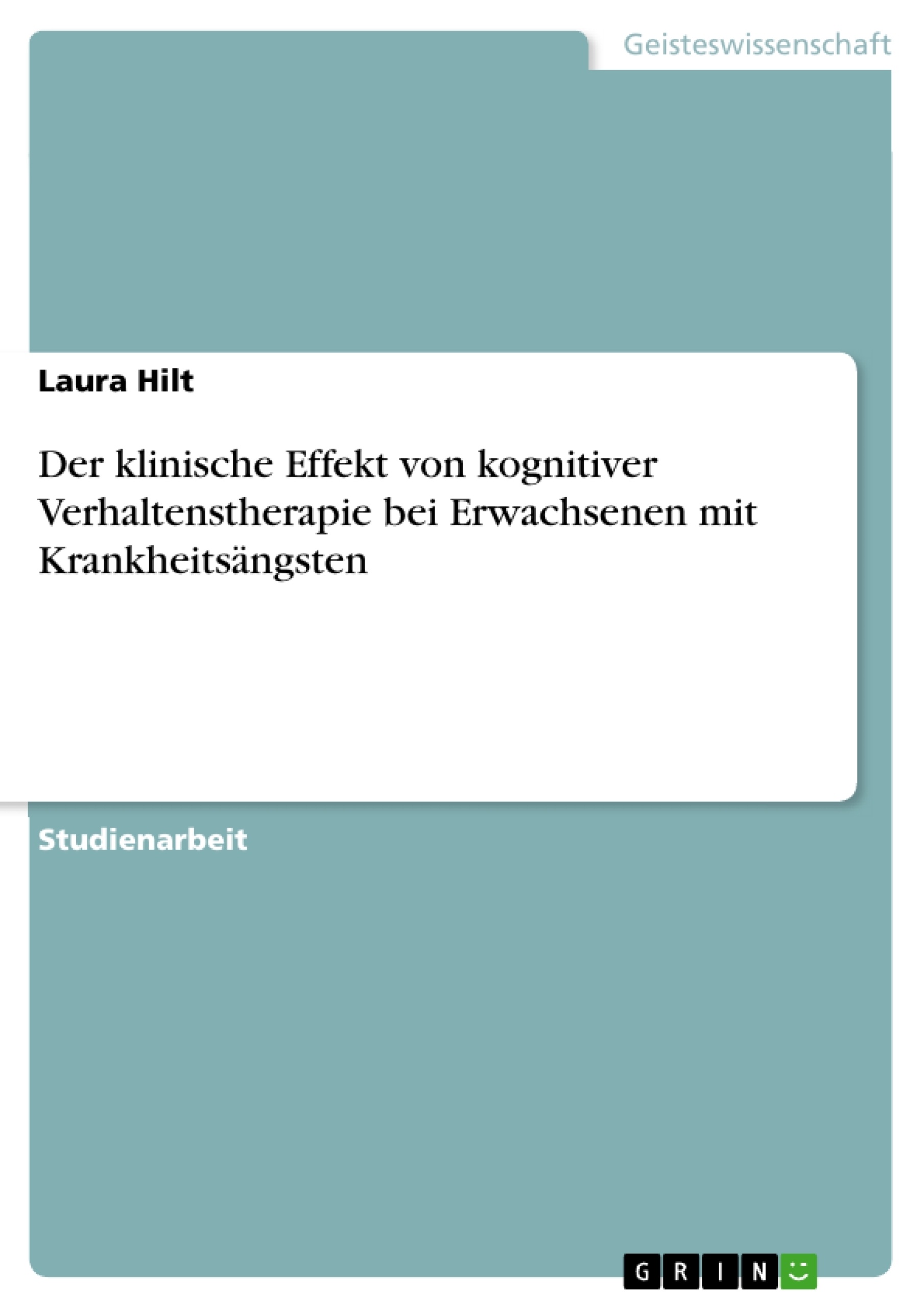Diese Hausarbeit untersucht die Wirkung der kognitiven Verhaltenstherapie auf Krankheitsangst bei Erwachsenen und versucht, folgende Forschungsfrage zu beantworten: Wie groß ist der klinische Effekt von kognitiver Verhaltenstherapie bei Erwachsenen mit Krankheitsängsten? Die Arbeit stützt sich dabei auf drei experimentelle Studien, welche in den folgenden Abschnitten im Hinblick auf diese Forschungsfrage untersucht werden.
Krankheitsangst, auch Hypochondrie oder Hypochondrische Störung, ist häufig und verursacht erhebliches Leiden. Betroffene leiden unter einer anhaltenden Angst, an einer schweren körperlichen Krankheit (wie beispielsweise Krebs) zu leiden, diese Überzeugung wird aber nicht durch eine medizinische Diagnose gestützt. Diese Störung führt zu Beeinträchtigungen sowie möglicherweise zu Arbeitsunfähigkeit, depressiver Folgestörung und Aufenthalten in Klinken. Die Erkrankung ist sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärversorgung zu finden, als Lebenszeitprävalenz wird 5% angenommen. Es wird geschätzt, dass bis zu 5% der ambulant behandelten Patienten und zwischen 0,3 und 8,5% der Patienten in medizinischen Kliniken an pathologischer Krankheitsangst leiden. In der Allgemeinbevölkerung variieren die Prävalenzraten je nach Land, Studie und Schärfe der Diagnosekriterien stark. Die Prävalenzraten von „Krankheitsangst“ liegen mit einer Spanne von 2,1% bis 13,1 % über denen für Hypochondrie mit einer Spanne von 0,0% bis 4,5 %, da der Begriff Hypochondrie diagnostisch schärfer gefasst ist.
In der deutschen Allgemeinbevölkerung ergab eine fragebogenbasierte Studie eine Prävalenz von 0,4 %. Die Relevanz des Themas ergibt sich auch aus der erheblichen Belastung, die diese Störung für das Gesundheitssystem darstellt. Die Befürchtung Betroffener, schwer krank zu sein, führt zu häufigen ärztlichen Konsultationen und Untersuchungen sowie einem Rotieren zwischen verschiedenen Ärzten und Kliniken. Die Symptome Betroffener halten dabei allerdings oft über Jahre an, weil die eigentliche psychische Erkrankung unerkannt bleibt (Tyrer et al., 2014). Es wird angenommen, dass Betroffene von Krankheitsangst in der Primärversorgung 41-78% mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen als Patienten mit einem „gut definierten medizinischen Zustand“. Relevanz ergibt sich zudem dadurch, dass die Erkrankung laut Expertenschätzungen in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben könnte sowie bisher keine spezifische Behandlung eindeutig als wirksam erwiesen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung
- Relevanz des Themas
- Zielsetzung der Arbeit und Fragestellung
- Theoretischer Hauptteil
- Einführung
- Hauptteil
- Methodik
- Literaturrecherche
- Kriterien der Inhaltlichen Zusammenfassungen
- Ergebnisse
- Ergebnisse der Literaturrecherche
- Inhaltliche Zusammenfassung
- Synthese
- Methodik
- Schlussteil
- Interpretation der wichtigsten Erkenntnisse
- Schlussfolgerung und Bezug zur Forschungsfrage
- Kritische Betrachtung der eigenen Methodik
- Handlungsempfehlung und weiterer Forschungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Effektivität der kognitiven Verhaltenstherapie bei der Behandlung von Krankheitsangst bei Erwachsenen. Die Forschungsfrage lautet: "Wie groß ist der klinische Effekt von kognitiver Verhaltenstherapie bei Erwachsenen mit Krankheitsängsten?". Die Arbeit analysiert drei experimentelle Studien, um diese Frage zu beantworten.
- Die Relevanz von Krankheitsangst als häufige und belastende Störung
- Die Wirkungsweise der kognitiven Verhaltenstherapie bei der Behandlung von Krankheitsangst
- Die klinische Effektivität der kognitiven Verhaltenstherapie im Vergleich zu anderen Therapieformen
- Die Rolle von kognitiven und verhaltensbezogenen Komponenten in der Behandlung von Krankheitsangst
- Die Ergebnisse von Forschungsstudien zur Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie bei Krankheitsangst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Krankheitsangst und ihre Relevanz vor. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und die Forschungsfrage. Der theoretische Hauptteil beschreibt die Definition und Klassifikation der Krankheitsangst sowie die Wirkungsweise der kognitiven Verhaltenstherapie. Im Hauptteil wird die Methodik der Literaturrecherche und die Kriterien für die Auswahl der Studien vorgestellt. Die Ergebnisse der Literaturrecherche, die inhaltliche Zusammenfassung und die Synthese der Studien werden im folgenden Abschnitt behandelt.
Schlüsselwörter
Krankheitsangst, Hypochondrie, kognitive Verhaltenstherapie, klinische Effektivität, Symptomstärke, klinische Parameter, Studien, Forschungsfrage, Literaturrecherche, Ergebnisse, Synthese, Interpretation, Schlussfolgerung, Methodik, Handlungsempfehlung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Krankheitsangst (Hypochondrie)?
Es ist eine psychische Störung, bei der Betroffene unter der anhaltenden Angst leiden, an einer schweren Krankheit zu leiden, obwohl medizinische Befunde dies nicht bestätigen.
Wie wirksam ist kognitive Verhaltenstherapie (KVT) bei Krankheitsangst?
Studien zeigen, dass die KVT einen signifikanten klinischen Effekt erzielt, indem sie dysfunktionale Denkmuster korrigiert und das Vermeidungsverhalten reduziert.
Warum stellt Krankheitsangst eine Belastung für das Gesundheitssystem dar?
Betroffene nehmen 41-78 % mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch als Patienten mit klaren medizinischen Diagnosen, da sie häufig zwischen Ärzten und Kliniken rotieren.
Wie hoch ist die Prävalenz von Krankheitsangst in Deutschland?
Schätzungen variieren stark; fragebogenbasierte Studien ergaben eine Prävalenz von etwa 0,4 % in der Allgemeinbevölkerung, in medizinischen Kliniken jedoch bis zu 8,5 %.
Welche Ziele verfolgt die KVT in der Behandlung?
Ziele sind die Reduzierung der Symptomstärke, die Verbesserung der Lebensqualität und die Vermittlung von Strategien zum Umgang mit körperlichen Missempfindungen.
- Citation du texte
- Laura Hilt (Auteur), 2021, Der klinische Effekt von kognitiver Verhaltenstherapie bei Erwachsenen mit Krankheitsängsten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1265540