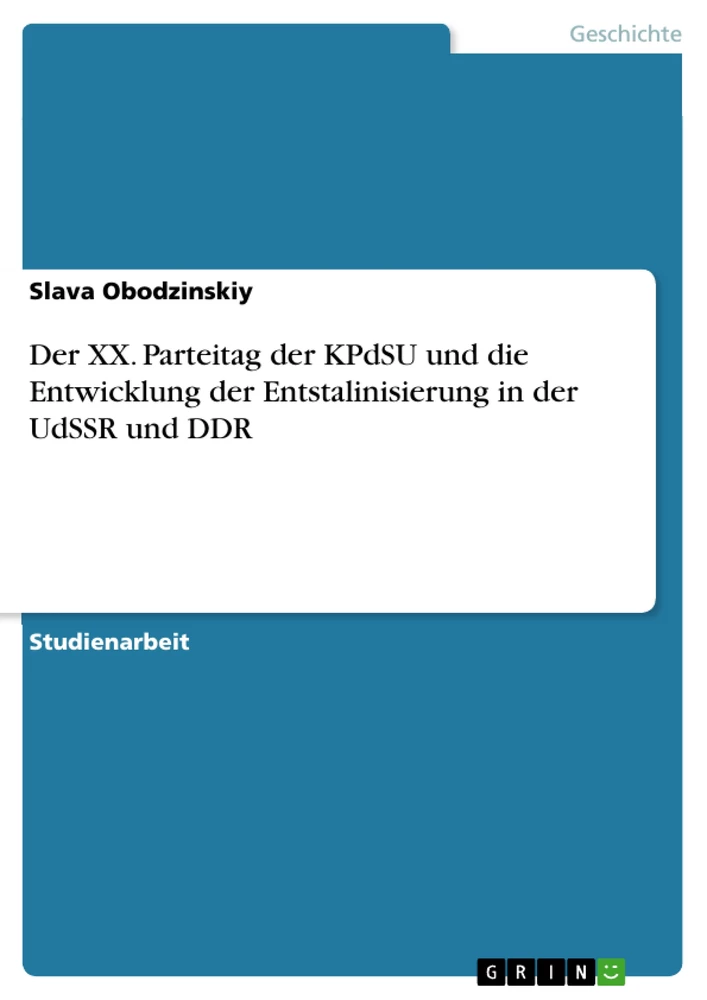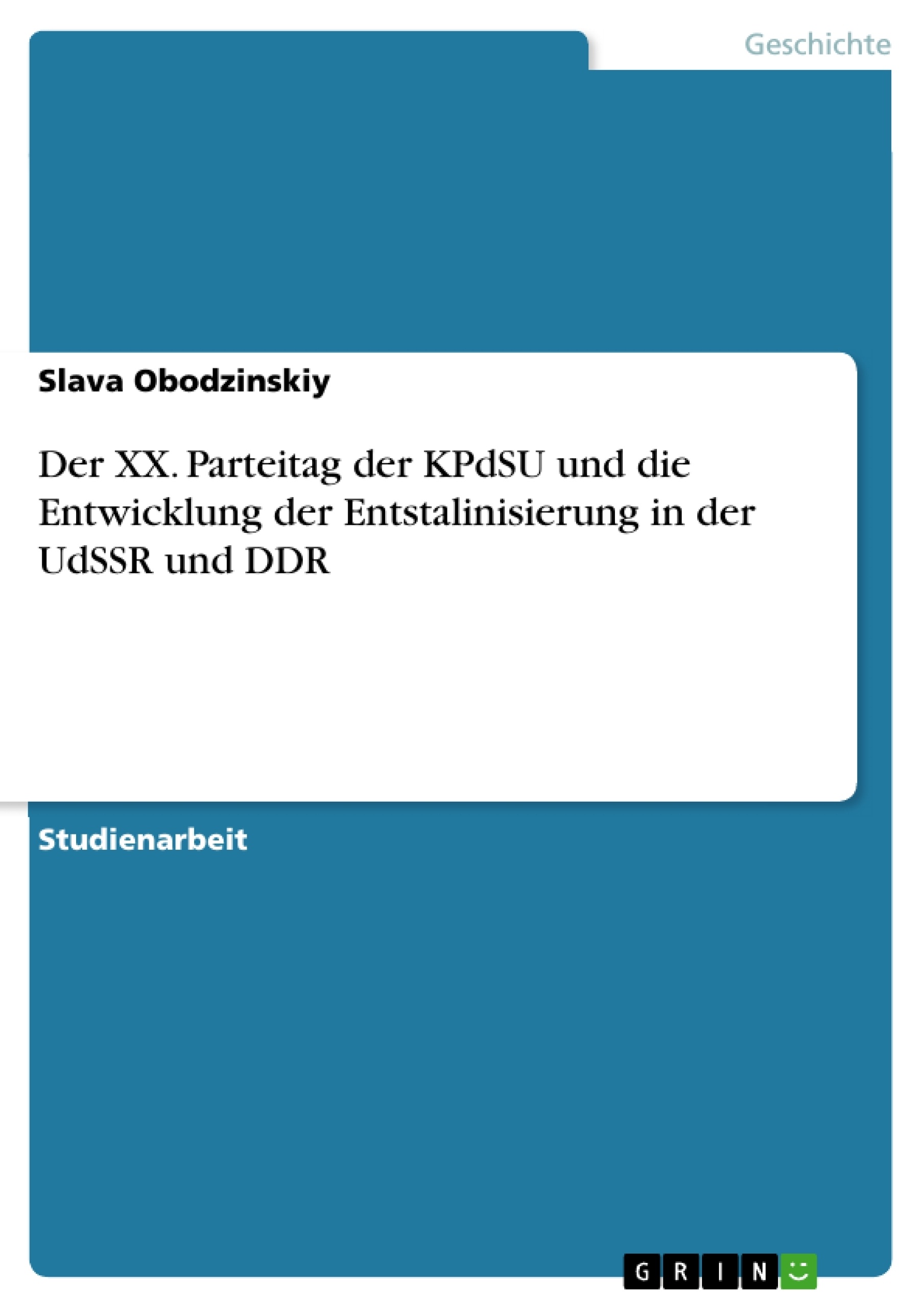In den knapp 30 Jahren seiner Herrschaft gelingt es Josef Wissarionowitsch Stalin, in der Sowjetunion ein totalitäres Regime zu etablieren. Kennzeichnend für sein System sind, unter anderem, das absolute politische Entscheidungsmonopol Stalins und willkürlicher Terror gegen die Bevölkerung. Trotzdem wird Stalin nach jahrelang betriebenem Führerkult von vielen Menschen in der Sowjetunion verehrt. Nach dem Tod Stalins am 5. März 1953 kommt Nikita Sergejewitsch Chruschtschow an die Macht und wird Anfang September 1953 zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU ernannt. Er beginnt eine langsame Abkehr von den Methoden und der Politik seines Vorgängers. Bereits 1953 wird der von Stalin organisierte Prozess gegen jüdische Staatsärzte gestoppt. Im selben Jahr finden auch erste, wenn auch nur sehr wenige, Rehabilitierungen von Opfern des Terrors statt. Gleichzeitig werden eine Beschränkung von Einflussmöglichkeiten des Staatssicherheitsdienstes und seine Neuorganisierung vorbereitet. Dafür werden der Chef der Sicherheitsorgane Lawrentij Berija und seine engsten Mitarbeiter verhaftet und anschließend in einem Geheimprozess verurteilt, was jedoch den „alten“ Methoden Stalins entspricht. Außerdem beginnt die Regierung in dieser Phase, mehr auf die Bedürfnisse der Landwirtschaft und die Konsumwünsche der Bevölkerung einzugehen und auch in der Wirtschaftspolitik wird der „Neue Kurs“ eingeschlagen. Es wird in der Zeit auch der Anfang für das „Tauwetter“ in der Literatur gemacht. Die ersten, allerdings sehr zurückhaltenden, kritischen Töne bezüglich des „Personenkults“, kommen von der Partei in einem „Prawda“-Artikel vom 10. Juni 1953. Ansonsten wird Stalin nach seinem Tod in der Presse kaum erwähnt, was in einem starken Kontrast zu seiner früheren Präsenz in den Medien steht. Vom 14. bis zum 25. Februar 1956 findet dann der XX. Parteitag der KPdSU statt, der erste nach dem Tod Stalins. Sein Tod findet beim Parteitag kaum Beachtung. Chruschtschow (aber zum Teil auch andere Referenten) bringt neue politische Ansätze, die sich deutlich von der Weltanschauung Stalins unterscheiden. Er redet unter anderem über die Vermeidbarkeit von Kriegen, Möglichkeiten der Kooperation zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, neue Formen des Übergangs zum Sozialismus und über die Notwendigkeit eines friedlichen wirtschaftlichen Wettstreits. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die Entwicklung der Entstalinisierung in der Sowjetunion
- Die DDR nach dem Tod Stalins
- Die „Entstalinisierungskrise“ in der DDR nach dem XX. Parteitag der KPdSU
- Die historische Bedeutung des XX. Parteitages der KPdSU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Todes Stalins und die darauffolgende Entstalinisierung in der Sowjetunion und der DDR. Sie analysiert die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die diese Prozesse auslösten, und die Reaktionen der Bevölkerung und der Führungen beider Staaten.
- Die Entstalinisierung in der Sowjetunion unter Chruschtschow
- Der XX. Parteitag der KPdSU und die Geheimrede Chruschtschows
- Die Reaktionen auf die Entstalinisierung in der Sowjetunion und Osteuropa
- Die innenpolitische und wirtschaftliche Lage der DDR nach Stalins Tod
- Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Entwicklung der Entstalinisierung in der Sowjetunion: Nach Stalins Tod im März 1953 begann unter Chruschtschow eine langsame Abkehr von Stalins Politik. Erste Schritte waren das Einstellen des Prozesses gegen jüdische Ärzte und vereinzelte Rehabilitierungen. Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 markierte einen Wendepunkt mit Chruschtschows Geheimrede über Stalins Verbrechen. Obwohl die Rede zu intensiven Diskussionen und Unruhen führte, wurde die Entstalinisierung bald aus Gründen der Machtsicherung und Stabilität in Osteuropa gestoppt. Der anfängliche Impuls zur Dekommunisierung wurde durch pragmatische Überlegungen der sowjetischen Führung gebremst.
Die DDR nach dem Tod Stalins: Der Tod Stalins traf die DDR in einer wirtschaftlich und politisch prekären Situation, geprägt von hoher Flüchtlingszahl, Repression und der misslungenen Kollektivierung der Landwirtschaft. Der im Jahr 1952 beschlossene Kurs zum „Aufbau des Sozialismus“ verschlimmerte die Lage. Die Normerhöhung von 1953 führte zu Protesten und dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953, der vom sowjetischen Militär niedergeschlagen wurde. Die SED-Führung reagierte mit begrenzten Reformen, um die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu lindern und ihre Macht zu sichern, während gleichzeitig die Armee ausgebaut wurde, um zukünftige Aufstände zu verhindern. Die wirtschaftliche und soziale Krise der DDR nach dem Tod Stalins verdeutlichte die Abhängigkeit von der Sowjetunion und das Scheitern der bisherigen Politik.
Schlüsselwörter
Entstalinisierung, Sowjetunion, DDR, XX. Parteitag der KPdSU, Chruschtschow, Geheimrede, Personenkult, Volksaufstand 17. Juni 1953, Massenrepressalien, ökonomische Reformen, politische Repression.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Auswirkungen des Todes Stalins auf die Sowjetunion und die DDR
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt die Auswirkungen des Todes Stalins und die nachfolgende Entstalinisierung in der Sowjetunion und der DDR. Es analysiert die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen sowie die Reaktionen der Bevölkerung und der Führungen beider Staaten.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zur Entwicklung der Entstalinisierung in der Sowjetunion, zur Situation in der DDR nach Stalins Tod, zur „Entstalinisierungskrise“ in der DDR nach dem XX. Parteitag der KPdSU und zur historischen Bedeutung dieses Parteitages.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themen sind die Entstalinisierung unter Chruschtschow, der XX. Parteitag der KPdSU und Chruschtschows Geheimrede, die Reaktionen auf die Entstalinisierung in der Sowjetunion und Osteuropa, die innenpolitische und wirtschaftliche Lage der DDR nach Stalins Tod sowie der Volksaufstand vom 17. Juni 1953.
Wie beschreibt das Dokument die Entstalinisierung in der Sowjetunion?
Nach Stalins Tod begann unter Chruschtschow eine langsame Abkehr von Stalins Politik. Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 mit Chruschtschows Geheimrede markierte einen Wendepunkt. Obwohl die Rede zu Unruhen führte, wurde die Entstalinisierung bald aus Gründen der Machtsicherung gebremst.
Wie beschreibt das Dokument die Situation in der DDR nach Stalins Tod?
Die DDR befand sich nach Stalins Tod in einer prekären wirtschaftlichen und politischen Lage. Der „Aufbau des Sozialismus“ verschlimmerte die Lage. Die Normerhöhung von 1953 führte zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953, der niedergeschlagen wurde. Die SED reagierte mit begrenzten Reformen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Entstalinisierung, Sowjetunion, DDR, XX. Parteitag der KPdSU, Chruschtschow, Geheimrede, Personenkult, Volksaufstand 17. Juni 1953, Massenrepressalien, ökonomische Reformen, politische Repression.
Welche Bedeutung hatte der XX. Parteitag der KPdSU?
Der XX. Parteitag der KPdSU markierte einen Wendepunkt in der Entstalinisierung mit Chruschtschows Geheimrede über Stalins Verbrechen. Er führte zu intensiven Diskussionen und Unruhen, beeinflusste aber auch die weitere politische Entwicklung in der Sowjetunion und den Satellitenstaaten.
Welche Rolle spielte der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR?
Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 war eine Reaktion auf die wirtschaftliche und politische Misere in der DDR. Er wurde vom sowjetischen Militär niedergeschlagen, führte aber zu begrenzten Reformen der SED zur Stabilisierung der Machtverhältnisse.
- Quote paper
- Slava Obodzinskiy (Author), 2009, Der XX. Parteitag der KPdSU und die Entwicklung der Entstalinisierung in der UdSSR und DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126256