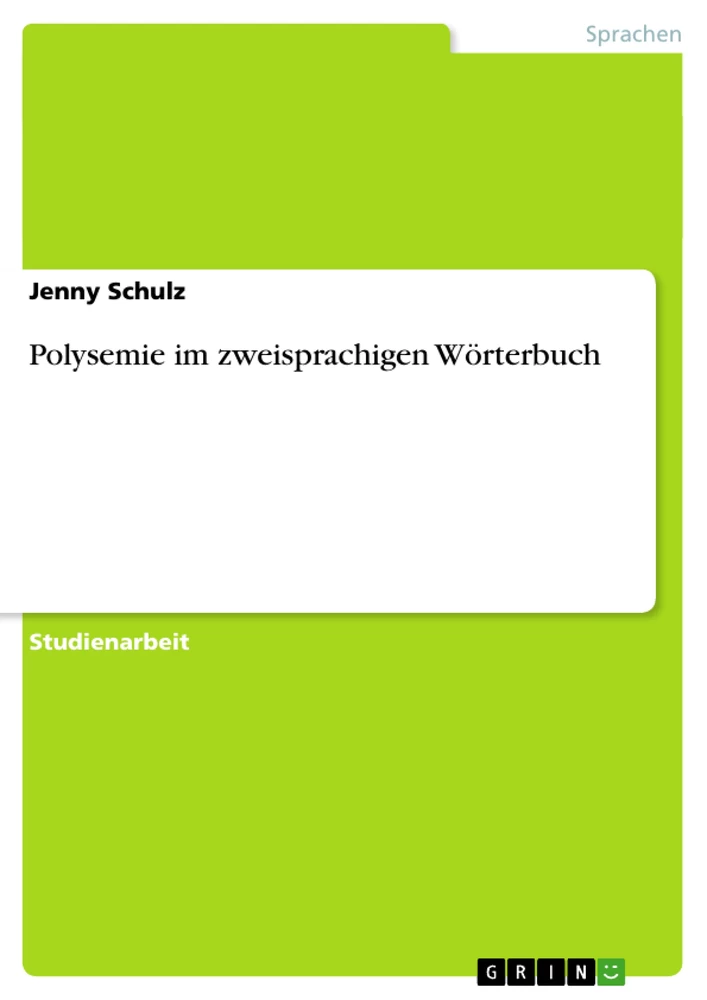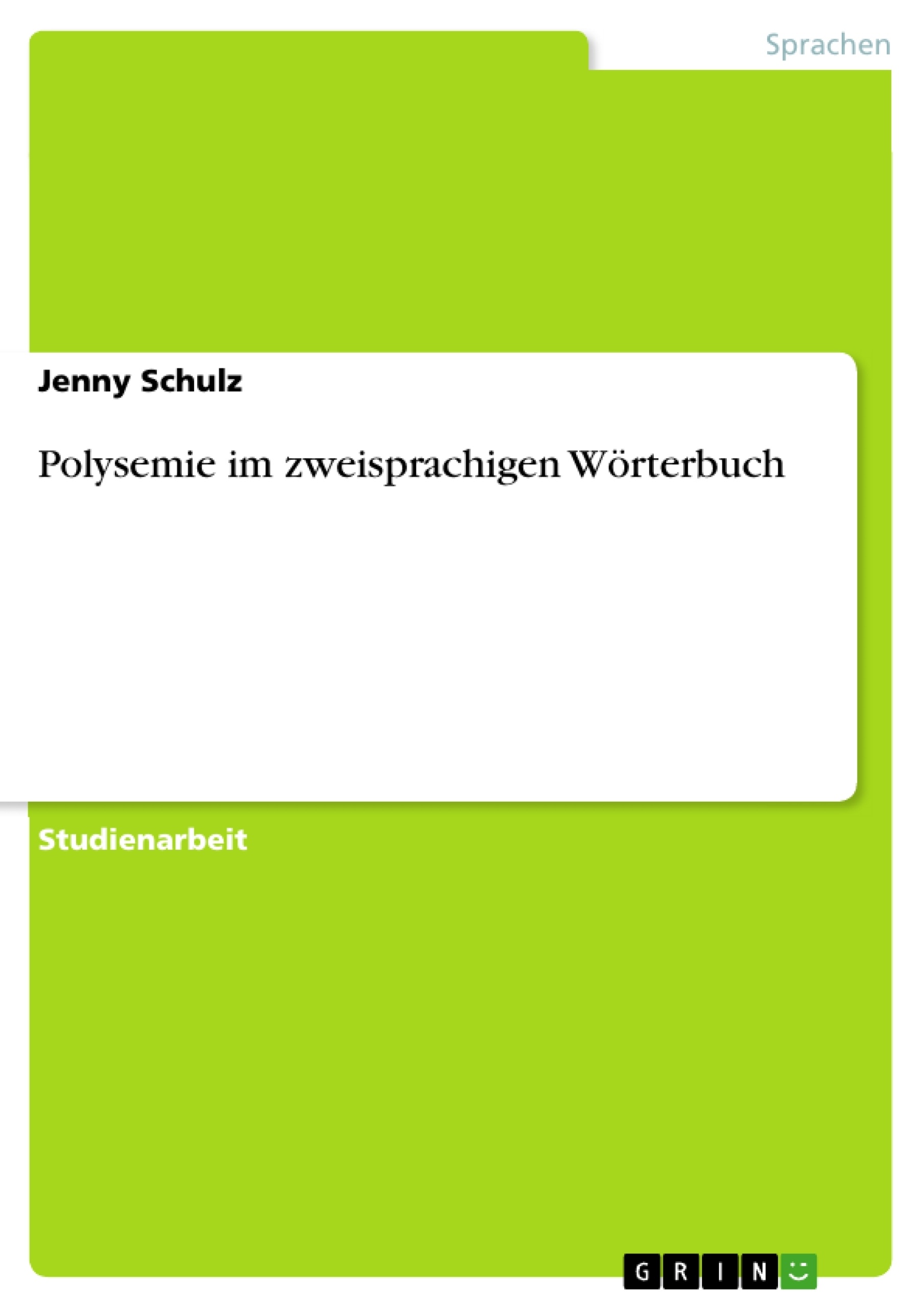Betrachtet man eine Sprache, wird man merken, dass nicht jedem Wort nur eine einzige Bedeutung anhaftet. Einige Worte haben mehrere Bedeutungen, die in ihrer Aussage sehr variieren können. Somit kann es in einer Sprache nicht nur ein korrektes Verständnis geben, sondern Feinheiten, mit denen man Aussagen differenzieren und zu etwas ganz Individuellem gestalten kann. Diese Mehrfachbedeutung einzelner Worte kann zwar zu Verwechslungen führen, doch ist sie Sprechern der gleichen Muttersprache oft nicht einmal wirklich bewusst. Wie ändert sich dieses Verständnis jedoch, wenn man eine zweite Sprache hinzufügt? Fremdsprachenlernende stehen nicht selten vor der Frage, was eine Aussage zu bedeuten hat, wenn sie einem bestimmten Wort nur die eine seiner vielfältigen Bedeutungen zuordnen können. Dadurch entsteht eine gewisse Schwierigkeit beim Vergleich zweier Sprachen. Mehrdeutige Begrifflichkeiten werden in keiner Sprache zu 100% mit der anderen verwendeten Sprache übereinstimmen. Man muss die spezifische Mehrfachbedeutung der Worte einer Sprache zu erkennen und anzuwenden lernen. Beim Blick in ein zweisprachiges Wörterbuch wird einem dieser Schritt ganz besonders bewusst. Daher möchte diese Hausarbeit dem Phänomen der Polysemie in einem zweisprachigen Wörterbuch genauer auf den Grund gehen. Was ist eigentlich Polysemie, und wie erkennt man sie zwischen zwei Sprachen? Wo liegen die Gefahren bei der Verwendung von Polysemie?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Polysemie - was ist das?
- Versuch einer Definition
- Entstehung der Polysemie
- Die Erfassung der Polysemie in einem Wörterbuch
- Polysemie erfassen
- Die Problematik der Indexierung
- Die Problematik der Übersetzung
- Daum/Schenk und Leyn im Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen der Polysemie in zweisprachigen Wörterbüchern. Ziel ist es, Polysemie zu definieren, ihre Entstehung zu beleuchten und die Herausforderungen ihrer Erfassung und Übersetzung in Wörterbüchern zu analysieren. Die Arbeit vergleicht verschiedene Ansätze im Umgang mit Polysemie.
- Definition und Abgrenzung von Polysemie zu verwandten linguistischen Phänomenen (Homonymie, Paronymie)
- Etymologische Ursachen und Entstehung von Polysemie
- Probleme der Darstellung von Polysemie in zweisprachigen Wörterbüchern
- Herausforderungen der Indexierung und Übersetzung polysemer Wörter
- Vergleich verschiedener lexikographischer Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Polysemie ein und beschreibt die Herausforderungen, die die Mehrdeutigkeit von Wörtern, insbesondere im Kontext des zweisprachigen Wörterbuchs, mit sich bringt. Sie betont die Notwendigkeit, die spezifische Mehrfachbedeutung von Wörtern zu verstehen und anzuwenden, sowie die Schwierigkeiten, die sich für Fremdsprachenlernende ergeben können. Die Arbeit kündigt an, sich mit der Definition von Polysemie, ihrer Entstehung und den damit verbundenen Problemen in der Lexikografie auseinanderzusetzen.
Polysemie - was ist das?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Polysemie und grenzt sie von ähnlichen Phänomenen wie Homonymie und Paronymie ab. Es wird erläutert, dass Polysemie nicht einfach nur die Mehrdeutigkeit eines Wortes ist, sondern auf einer gemeinsamen etymologischen Wurzel beruht. Der Unterschied zwischen Homonymen (gleiche Lautform, unterschiedliche Bedeutung) und Polysemen (verschiedene Bedeutungen, aber gemeinsame Wurzel) wird detailliert dargestellt, wobei die Beispiele von Homografen und Homophonen beleuchtet werden. Die Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von Polysemie und Homonymie, besonders im schriftlichen Kontext, werden hervorgehoben. Der Abschnitt über Paronyme erklärt, dass diese, obwohl ähnlich klingend, unterschiedliche Wortstämme und somit keine Polyseme darstellen.
Die Erfassung der Polysemie in einem Wörterbuch: Dieses Kapitel befasst sich mit den praktischen Herausforderungen der Darstellung von Polysemie in zweisprachigen Wörterbüchern. Es analysiert die Problematik der Indexierung polysemer Einträge, da eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Bedeutungen notwendig ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Schwierigkeiten der Übersetzung polysemer Wörter, da die Entsprechungen in der Zielsprache nicht immer exakt den verschiedenen Bedeutungen im Ausgangswort entsprechen. Der Text verdeutlicht, wie die spezifischen Herausforderungen der Polysemie in der Lexikografie gemeistert werden müssen.
Schlüsselwörter
Polysemie, Homonymie, Paronymie, zweisprachiges Wörterbuch, Lexikografie, Übersetzung, Indexierung, Etymologie, Mehrdeutigkeit, Bedeutung, Wortbedeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Polysemie in zweisprachigen Wörterbüchern
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Phänomen der Polysemie in zweisprachigen Wörterbüchern. Sie analysiert die Definition, Entstehung und die Herausforderungen der Erfassung und Übersetzung polysemer Wörter in Wörterbüchern. Ein Vergleich verschiedener Ansätze im Umgang mit Polysemie ist ebenfalls Bestandteil der Arbeit.
Was ist Polysemie?
Die Hausarbeit definiert Polysemie und grenzt sie von verwandten linguistischen Phänomenen wie Homonymie (gleiche Lautform, unterschiedliche Bedeutung) und Paronymie (ähnlich klingende Wörter mit unterschiedlichen Wortstämmen) ab. Polysemie bezeichnet die Mehrdeutigkeit eines Wortes, die jedoch auf einer gemeinsamen etymologischen Wurzel beruht. Die Unterscheidung zwischen Polysemie und Homonymie, insbesondere schriftlich, wird als schwierig dargestellt.
Welche Probleme werden bei der Erfassung von Polysemie in Wörterbüchern behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Indexierung und Übersetzung polysemer Wörter in zweisprachigen Wörterbüchern. Eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Bedeutungen bei der Indexierung ist notwendig, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Übersetzung polysemer Wörter gestaltet sich schwierig, da die Entsprechungen in der Zielsprache nicht immer exakt den verschiedenen Bedeutungen im Ausgangswort entsprechen.
Welche Aspekte der Polysemie werden im Detail untersucht?
Die Hausarbeit behandelt folgende Aspekte: Definition und Abgrenzung von Polysemie, etymologische Ursachen und Entstehung von Polysemie, Probleme der Darstellung von Polysemie in zweisprachigen Wörterbüchern, Herausforderungen der Indexierung und Übersetzung polysemer Wörter, und einen Vergleich verschiedener lexikographischer Ansätze.
Welche Wörterbücher werden verglichen?
Die Hausarbeit nennt explizit Daum/Schenk und Leyn als Wörterbücher, die im Vergleich betrachtet werden. Die genauen Details des Vergleichs sind im Text der Hausarbeit nachzulesen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Polysemie - was ist das?, Die Erfassung der Polysemie in einem Wörterbuch, Daum/Schenk und Leyn im Vergleich, und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Polysemie, Homonymie, Paronymie, zweisprachiges Wörterbuch, Lexikografie, Übersetzung, Indexierung, Etymologie, Mehrdeutigkeit, Bedeutung, Wortbedeutung.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, das Phänomen der Polysemie zu definieren, ihre Entstehung zu beleuchten und die Herausforderungen ihrer Erfassung und Übersetzung in zweisprachigen Wörterbüchern zu analysieren. Die Arbeit vergleicht verschiedene Ansätze im Umgang mit Polysemie, um ein umfassendes Verständnis dieses linguistischen Phänomens zu vermitteln.
- Citar trabajo
- BA Jenny Schulz (Autor), 2007, Polysemie im zweisprachigen Wörterbuch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126152