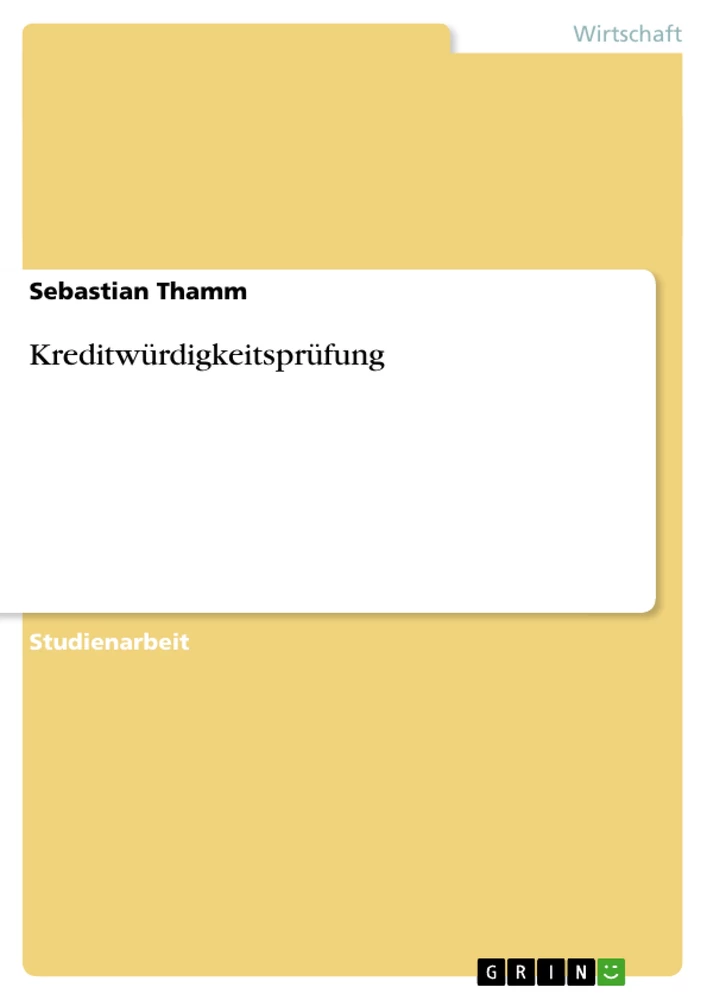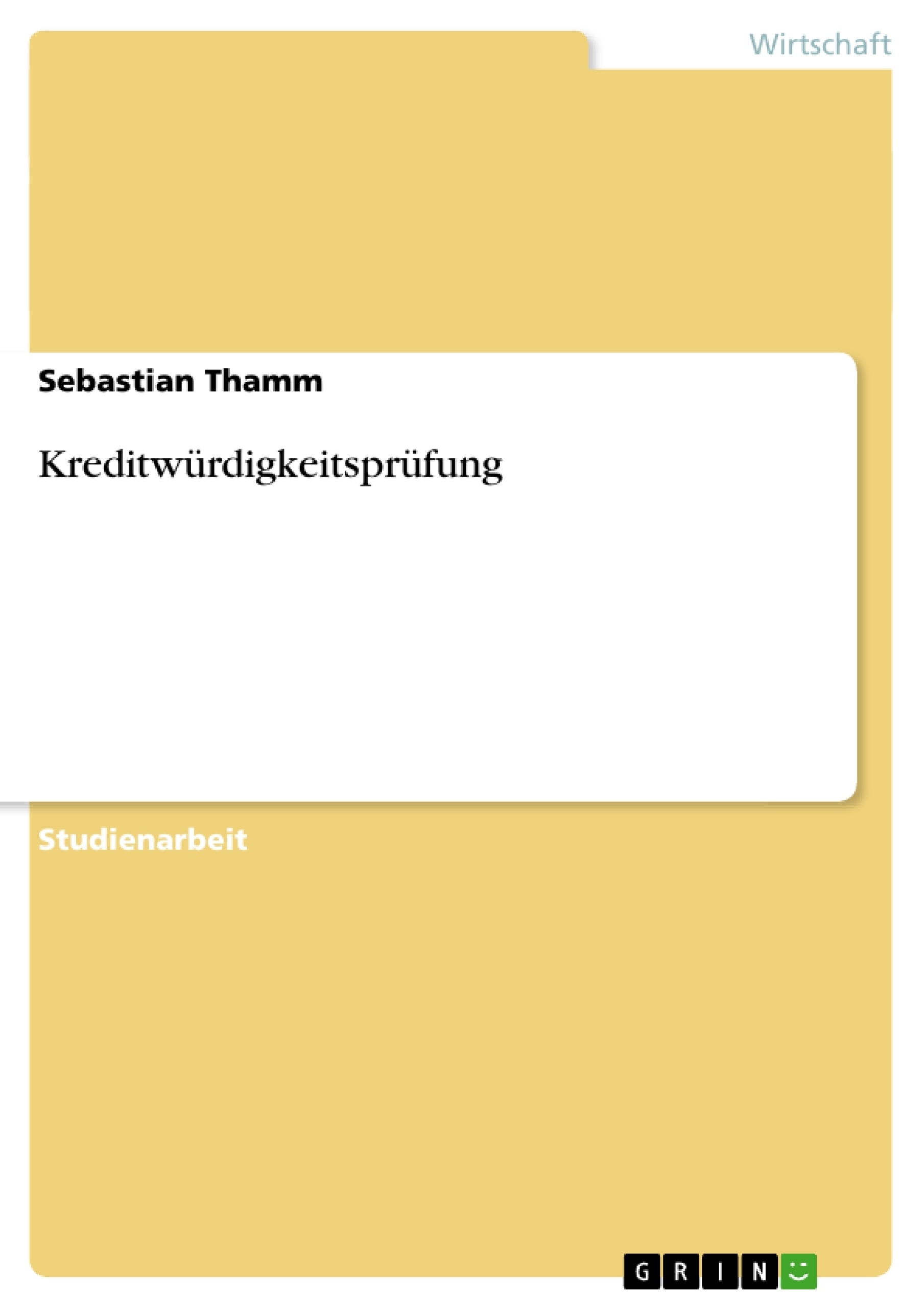Ein Kredit stellt aus der Sicht des Kreditgebers eine Investition dar. Dieser erhofft sich,mit der Kreditgewährung einen Gewinn zu erzielen. Daher wird er den Kredit nur dann vergeben, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dieser nebst Zinsen pünktlich zurückgezahlt wird.
Deshalb ist es notwendig, vor der Kreditvergabe eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchzuführen. Diese ist nach wie vor sehr wichtig, das zeigt die aktuelle Finanz- bzw. Subprime-Krise. Auch gab es im 1. Halbjahr 2007 14.100 Unternehmensinsolvenzen und 51.600 Verbraucherinsolvenzen. Zusätzlich gilt seit dem 1. Januar 2007 für Kreditinstitute Basel II, welcher eine bonitätsabhängige Eigenkapital-Hinterlegung fordert.
In dieser Arbeit wird zunächst der Begriff der Kreditwürdigkeitsprüfung erklärt. Es soll gezeigt werden, welche Arten es gibt und wie die Prüfung abläuft. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Kreditwürdigkeitsprüfung von Unternehmen. Es werden die Bilanzanalyse als traditionelles Verfahren und wichtige moderne Verfahren gezeigt und beurteilt. Den Abschluss bildet die Vorstellung des Ratings, welches diese Verfahren verknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kreditwürdigkeitsprüfung
- 2.1 Kreditwürdigkeitsprüfung i. w. S.
- 2.2 Kreditwürdigkeitsprüfung i. e. S.
- 3. Arten der Kreditwürdigkeitsprüfung i. e. S.
- 4. Bilanzanalyse als traditionelles Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung
- 4.1 Beurteilung der Vermögenslage
- 4.2 Beurteilung der Finanzlage
- 4.3 Beurteilung der Ertragslage
- 4.4 Gesamturteilsbildung
- 5. Moderne Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung
- 5.1 Scoring
- 5.2 Diskriminanzanalyse
- 5.3 Künstliche Neuronale Netzanalyse
- 6. Rating als Kombination traditioneller und moderner Verfahren
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Kreditwürdigkeitsprüfung, einem essentiellen Bestandteil der Kreditvergabe. Ziel ist es, verschiedene Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung, sowohl traditionelle als auch moderne, zu erläutern und zu bewerten. Der Fokus liegt dabei auf der Prüfung von Unternehmen.
- Definition und Abgrenzung der Kreditwürdigkeitsprüfung
- Traditionelle Verfahren (Bilanzanalyse)
- Moderne Verfahren (Scoring, Diskriminanzanalyse, Künstliche Neuronale Netze)
- Kombination traditioneller und moderner Verfahren im Rating
- Bedeutung der Kreditwürdigkeitsprüfung im Kontext aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung ein und betont deren Bedeutung vor dem Hintergrund der aktuellen Banken- und Hypothekenkrise sowie der gesetzlichen Vorgaben wie Basel II. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Erläuterung des Begriffs, verschiedener Verfahren und des Ratings konzentriert, mit besonderem Fokus auf die Kreditwürdigkeitsprüfung von Unternehmen.
2. Kreditwürdigkeitsprüfung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Kreditwürdigkeitsprüfung und beschreibt deren freiwilligen Charakter sowie die Auswahl der Prüfer (interne oder externe Wirtschaftsprüfer). Es wird auf die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 18 KWG hingewiesen, die die Offenlegung wirtschaftlicher Verhältnisse bei Krediten über EUR 750.000,00 vorschreiben, und auf die Praxis, Kreditwürdigkeitsprüfungen auch bei geringeren Beträgen durchzuführen. Zusätzlich wird die Überwachung der Kredite nach Ausreichung zur frühzeitigen Erkennung von Bonitätsverschlechterungen erwähnt.
2.1 Kreditwürdigkeitsprüfung i. w. S.: Dieses Unterkapitel beschreibt die Kreditwürdigkeitsprüfung im weiteren Sinne, welche die Prüfung der Kreditfähigkeit, der Sicherheiten und der Kreditwürdigkeit im engeren Sinne umfasst. Die Kreditfähigkeit wird im Kontext der Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen und der Vertretungsbefugnis juristischer Personen erläutert. Die Prüfung der Sicherheiten differenziert zwischen Personen- und Sachsicherheiten, mit Beispielen wie Bürgschaften und Sicherungsübereignungen.
2.2 Kreditwürdigkeitsprüfung i. e. S.: Hier wird die Kreditwürdigkeitsprüfung im engeren Sinne behandelt, die sich auf die Risikofeststellung bei der Kreditvergabe konzentriert. Es werden die Informations-, Ausfall- und Terminrisiken detailliert beschrieben. Das Ziel der Prüfung ist die Feststellung, ob ein potenzieller Kreditnehmer sowohl willens als auch in der Lage ist, den Kapitaldienst zu leisten. Die Prävention von Verlusten durch die Vergabe von Krediten an nicht kreditwürdige Kunden wird hervorgehoben.
4. Bilanzanalyse als traditionelles Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung: Dieses Kapitel beschreibt die Bilanzanalyse als ein traditionelles Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung. Es werden die Beurteilung der Vermögenslage, Finanzlage und Ertragslage eines Unternehmens detailliert erläutert. Die Gesamturteilsbildung aus den einzelnen Analysen wird ebenfalls thematisiert, unterstreichend wie die einzelnen Aspekte zusammenwirken um ein Gesamtbild der Kreditwürdigkeit zu erhalten. Es wird auf die Interpretation der Kennzahlen und deren Aussagekraft für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eingegangen.
5. Moderne Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung: Das Kapitel beschreibt moderne Verfahren wie Scoring, Diskriminanzanalyse und Künstliche Neuronale Netze. Jeder dieser Ansätze wird einzeln dargestellt, wobei auf die jeweiligen Methoden, Vorteile und Nachteile eingegangen wird. Die Kapitel betonen die Möglichkeiten, die diese modernen Verfahren bieten, um die Kreditwürdigkeit effizienter und genauer zu beurteilen als durch rein traditionelle Methoden. Der Vergleich der unterschiedlichen Ansätze wird angeregt.
6. Rating als Kombination traditioneller und moderner Verfahren: Das Kapitel beschreibt das Rating als ein Verfahren, das sowohl traditionelle als auch moderne Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung kombiniert. Es verdeutlicht den Nutzen und die Vorteile dieses kombinierten Ansatzes für eine umfassendere und fundiertere Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Es werden die verschiedenen Rating-Kategorien und deren Bedeutung im Kontext der Kreditvergabe erörtert.
Schlüsselwörter
Kreditwürdigkeitsprüfung, Bonitätsprüfung, Bilanzanalyse, Scoring, Diskriminanzanalyse, Künstliche Neuronale Netze, Rating, Basel II, Risikomanagement, Kreditfähigkeit, Sicherheiten, Ausfallrisiko, Informationsrisiko, Terminrisiko, KWG.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Kreditwürdigkeitsprüfung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Kreditwürdigkeitsprüfung, einem zentralen Thema der Kreditvergabe. Sie untersucht sowohl traditionelle als auch moderne Verfahren zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen und bewertet deren jeweilige Vor- und Nachteile.
Welche Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl traditionelle Verfahren wie die Bilanzanalyse (Beurteilung von Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) als auch moderne Methoden wie Scoring, Diskriminanzanalyse und Künstliche Neuronale Netze. Zusätzlich wird das Rating als Kombination aus traditionellen und modernen Verfahren ausführlich erläutert.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition und Abgrenzung der Kreditwürdigkeitsprüfung (im weiteren und engeren Sinne), detaillierte Beschreibung der Bilanzanalyse, Erläuterung moderner Verfahren, Darstellung des Ratings und ein abschließendes Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung, um die wesentlichen Inhalte prägnant darzustellen.
Was versteht man unter Kreditwürdigkeitsprüfung im weiteren und engeren Sinne?
Die Kreditwürdigkeitsprüfung im weiteren Sinne (i. w. S.) umfasst die Prüfung der Kreditfähigkeit (Geschäftsfähigkeit, Vertretungsbefugnis), der Sicherheiten (z.B. Bürgschaften, Sicherungsübereignungen) und der Kreditwürdigkeit im engeren Sinne (i. e. S.). Die Kreditwürdigkeitsprüfung im engeren Sinne (i. e. S.) konzentriert sich auf die Risikofeststellung bei der Kreditvergabe, insbesondere auf die Einschätzung der Zahlungsfähigkeit und des Zahlungswillens des Kreditnehmers.
Welche Risiken werden bei der Kreditwürdigkeitsprüfung im engeren Sinne betrachtet?
Die Kreditwürdigkeitsprüfung im engeren Sinne berücksichtigt Informations-, Ausfall- und Terminrisiken. Ziel ist es, Verluste durch die Vergabe von Krediten an nicht kreditwürdige Kunden zu vermeiden.
Wie funktioniert die Bilanzanalyse im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung?
Die Bilanzanalyse ist ein traditionelles Verfahren, das die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens anhand von Kennzahlen beurteilt. Die einzelnen Analysen werden zu einem Gesamturteil über die Kreditwürdigkeit zusammengefügt.
Welche modernen Verfahren der Kreditwürdigkeitsprüfung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Scoring, Diskriminanzanalyse und Künstliche Neuronale Netze als moderne Verfahren. Diese Verfahren bieten im Vergleich zu traditionellen Methoden oft eine effizientere und genauere Beurteilung der Kreditwürdigkeit.
Welche Rolle spielt das Rating?
Das Rating wird als Kombination aus traditionellen und modernen Verfahren dargestellt, die zu einer umfassenderen und fundierteren Beurteilung der Kreditwürdigkeit führt. Es werden verschiedene Rating-Kategorien und deren Bedeutung im Kontext der Kreditvergabe erläutert.
Welche gesetzlichen Vorgaben sind relevant?
Die Arbeit erwähnt die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 18 KWG, die die Offenlegung wirtschaftlicher Verhältnisse bei Krediten über EUR 750.000,00 vorschreiben. Sie betont aber auch, dass Kreditwürdigkeitsprüfungen in der Praxis auch bei geringeren Beträgen durchgeführt werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind unter anderem: Kreditwürdigkeitsprüfung, Bonitätsprüfung, Bilanzanalyse, Scoring, Diskriminanzanalyse, Künstliche Neuronale Netze, Rating, Basel II, Risikomanagement, Kreditfähigkeit, Sicherheiten, Ausfallrisiko, Informationsrisiko, Terminrisiko, KWG.
- Quote paper
- Sebastian Thamm (Author), 2007, Kreditwürdigkeitsprüfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125844