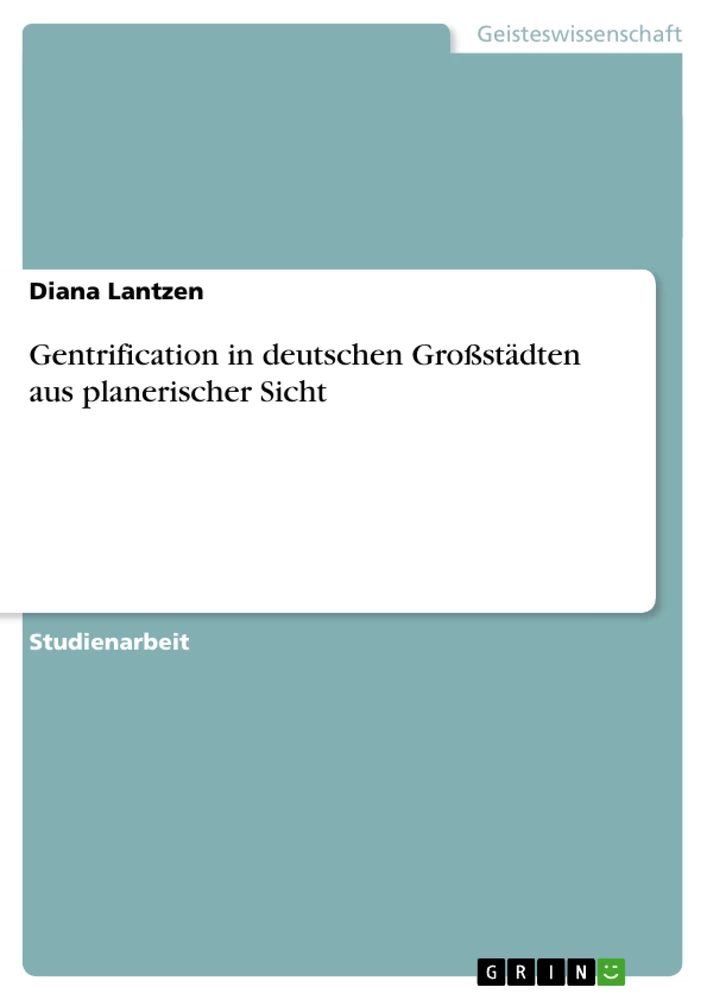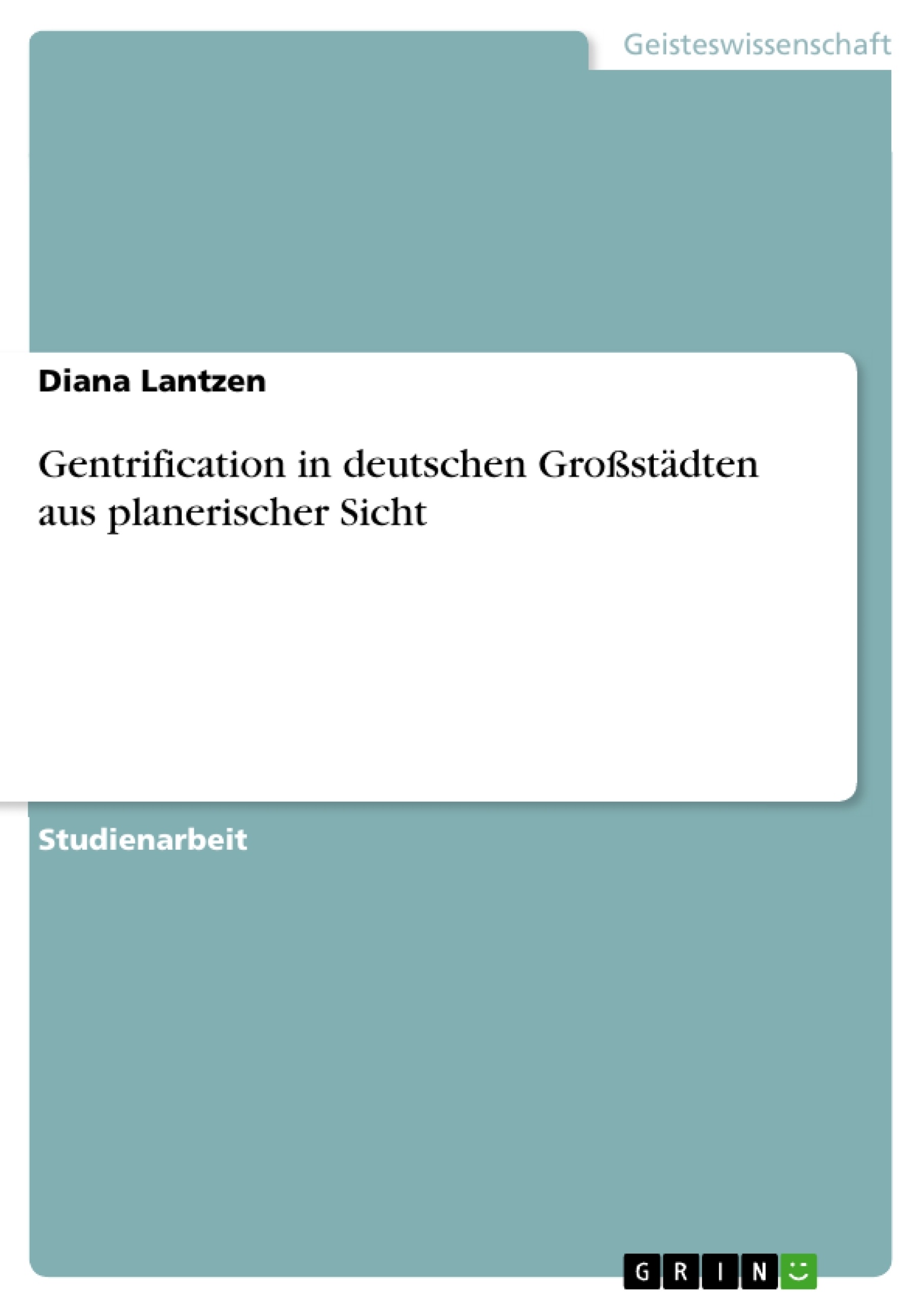Mit dem Begriff Gentrification, den Ruth Glass 1964 prägte, ist allgemein der Prozess der Aufwertung von innenstadtnahen Wohngebieten gemeint. Eng verbunden mit dem Verlauf der Aufwertung von Stadtteilen in der Innenstadt sind in den meisten Fällen Verdrängungsprozesse von bestimmten sozialen Gruppen.
Spätestens seit den 1970er Jahren, ab dem Zeitpunkt, wo von einer Umkehrung des Prozesses der Suburbanisierung in Deutschland gesprochen werden kann, fand der Begriff Gentrification Eingang in die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit den Veränderungen von Siedlungsstrukturen, Wandlungsprozessen in Innenstädten und Problemfeldern wie Segregation und Niedergang von innenstadtnahen Wohngebieten auseinandersetzen. Gleichzeitig geriet das Phänomen eines „Wiedererwachens der Innenstädte“ auch in den Blick der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und Politik und wurde auf verschiedenen Ebenen, insbesondere in der kommunalen Verwaltung im Bereich der Stadtplanung zu einer neuen Herausforderung.
Gentrification ist ein „schillernder“ Begriff. Während er manchen Kommunalpolitikern in strukturschwachen Räumen als Stabilisator kommunaler Wirtschaftskraft entgegen kommt, verkörpert er heute für die meisten Stadtteilinitiativen der Ballungsräume neue Verdrängungsprozesse [vgl. Wingenfeld 1990, S. 95].
Nach einem schon in den 1950er Jahren beginnenden Prozess der Stadt- (Um)Land-Wanderungen, der zur Planung und dem Bau von großen Neubaugebieten im peripheren Raum sowie Eigenheimsiedlungen „im Grünen“ führte, erfährt ab Mitte der 1970er Jahre (teilweise auch schon früher) innerstädtischer Wohnraum wieder eine wachsende Nachfrage. Das 1971 erlassene Städtebauförderungsgesetz, als Ergänzung zum allgemeinen Städtebaurecht, bildet seitdem den rechtlichen Handlungsrahmen der Stadtplaner und manifestiert seitens der Rechtsprechung den entstandenen und wachsenden Handlungsbedarf auf kommunaler Ebene.
In der Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, welchen Grundsätzen und Leitlinien die Stadtplanung in Deutschland folgt? Konnten neue Erkenntnisse zu Veränderungen in den Planungsstrategien beitragen und wie sind die Entwicklungen, die mit Gentrification einhergehen und die Art der Maßnahmen, die durchgeführt worden sind, heute zu bewerten? Gibt es Alternativen zu herkömmlichen Planungsstrategien, die Wohnraum sicherstellen können?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Gentrification aus planerischer Sicht
- Stadtplanung in Deutschland und der gesetzliche Handlungsrahmen
- Gentrification und Stadterneuerung
- Strategien der Stadtplanung in Deutschland
- 2. Sanierungsgebiete und Leitvorstellungen in der Stadtplanung
- Merkmale der Sanierungsgebiete
- Leitvorstellungen und Grundsätze der Stadterneuerungsplanung
- Klassische Städtebauförderung und ihre Kritik
- 3. Fallbeispiele
- Fallbeispiel Frankfurt-Bockenheim
- Fallbeispiel Hamburg: Stadtteil St. Georg
- Fallbeispiel Berlin/Prenzlauer Berg - Wohnungsbaugenossenschaften und ihr Einfluss auf zentrale städtische Handlungsfelder
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Grundsätze und Leitlinien der Stadtplanung in Deutschland im Kontext von Gentrification. Sie analysiert, inwieweit neue Erkenntnisse zu Veränderungen in den Planungsstrategien beigetragen haben und wie die mit Gentrification verbundenen Entwicklungen und Maßnahmen heute zu bewerten sind. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Alternativen zu herkömmlichen Planungsstrategien zur Sicherstellung von Wohnraum.
- Der gesetzliche Handlungsrahmen der Stadtplanung in Deutschland
- Gentrification und Stadterneuerung als planungsrelevante Prozesse
- Analyse von Sanierungsgebieten und deren Leitvorstellungen
- Bewertung der Strategien der Stadtplanung im Umgang mit Gentrification
- Fallstudien zur Veranschaulichung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gentrification ein und beschreibt deren Bedeutung im Kontext der Stadtentwicklung. Kapitel 1 beschreibt den Handlungsrahmen der Stadtplanung in Deutschland und beleuchtet die Begriffe Gentrification und Stadterneuerung. Kapitel 2 befasst sich mit den Merkmalen von Sanierungsgebieten und den Leitvorstellungen der Stadterneuerungsplanung, inklusive einer kritischen Auseinandersetzung mit der klassischen Städtebauförderung. Kapitel 3 präsentiert Fallbeispiele aus Frankfurt, Hamburg und Berlin, die die komplexen Herausforderungen der Stadtplanung im Umgang mit Gentrification veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Gentrification, Stadtplanung, Stadterneuerung, Sanierungsgebiete, Wohnungsbau, soziale Verträglichkeit, Städtebauförderungsgesetz, Fallbeispiele, Deutschland, Planungsstrategien, Verdrängungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Gentrification?
Gentrification bezeichnet die Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete, die oft mit der Verdrängung einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen einhergeht.
Was ist das Städtebauförderungsgesetz von 1971?
Es bildet den rechtlichen Rahmen für Stadtplaner in Deutschland, um Sanierungsgebiete festzulegen und die Stadterneuerung finanziell zu fördern.
Welche Rolle spielt die Stadtplanung bei der Gentrification?
Stadtplanung kann Gentrification sowohl fördern (durch Aufwertung) als auch steuern (durch Milieuschutzsatzungen oder soziale Erhaltungsverordnungen).
Was sind Sanierungsgebiete?
Dies sind Stadtteile mit städtebaulichen Missständen, in denen gezielte Maßnahmen zur Erneuerung der Bausubstanz und Infrastruktur durchgeführt werden.
Gibt es Alternativen zur herkömmlichen Stadterneuerungsplanung?
Die Arbeit untersucht Ansätze wie Wohnungsbaugenossenschaften und Strategien zur Sicherung von bezahlbarem Wohnraum in Ballungsräumen.
- Quote paper
- Diplom Geographin Diana Lantzen (Author), 2007, Gentrification in deutschen Großstädten aus planerischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125725