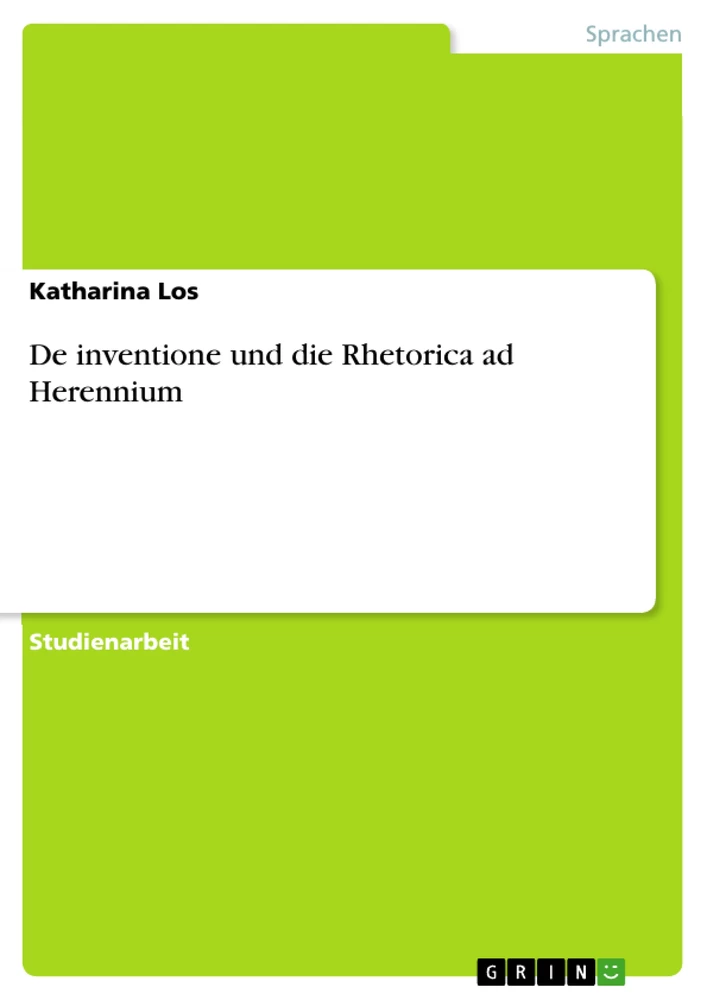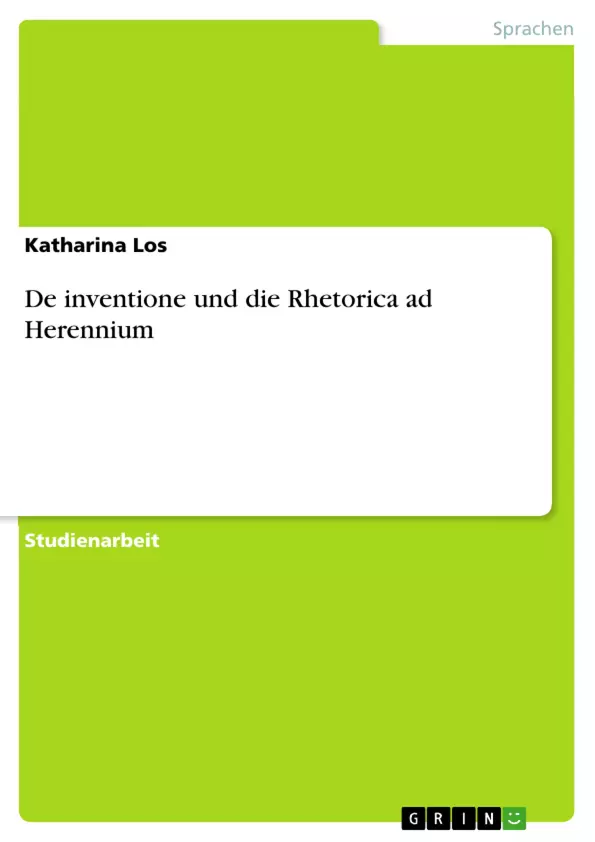In seinem Werk „Politik der Würde“ setzt der Jerusalemer Avishai Margalit neue
Maßstäbe, indem er den Versuch unternimmt, das bisherige Idealbild einer
Gesellschaft zu ersetzen. Schien doch lange Zeit die Gerechtigkeit ein
Paradekriterium für eine vorbildliche Gesellschaft zu sein, so betitelt Margalit nun die
ideale Gesellschaft als anständige, die jeden Menschen ausgehend von politischen,
sozialen und rechtlichen Institutionen menschenwürdig behandelt. Diese Behandlung
gründet vor allen Dingen auf einer Nicht-Verletzung der Selbstachtung und einer
daraus resultierenden Nicht-Demütigung eines jeden Menschen.
Im dritten Kapitel dieser Schrift erläutert der Philosoph das Thema „Ehre“. Nachdem
er in den ersten beiden Kapiteln den Begriff „Selbstachtung“ als Gegenbegriff zur
„Demütigung“ entworfen und folglich eine anständige Gesellschaft als eine
nichtdemütigende charakterisiert hat, macht Margalit sich nun Gedanken darüber, ob
die Selbstachtung das einzig mögliche Charakteristikum einer solchen Gesellschaft
sei oder ob dieser Begriff beispielsweise durch den der Ehre nicht erweitert oder gar
ersetzt werden könne. Doch was versteht man überhaupt unter „Selbstachtung“?
Und was ist der Unterschied zum so genannten „Selbstwertgefühl“, einem Ausdruck,
der zumindest umgangssprachlich oft in ähnlichen Kontexten zu finden ist und
dessen Bedeutungsspektrum fälschlicherweise oft dem der „Selbstachtung“
gleichgesetzt wird?
Eben diese Unterscheidung soll nachfolgend - sowohl in Anlehnung an Margalits
philosophische Erörterung, als auch anhand alltäglicher Beispiele - erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- I) DIE TEXTE
- Rhetorica ad Herennium, I, 17
- De inventione, I, 31-32
- II) VISUALISIERUNGEN
- Rhetorica ad Herennium 1,17
- De inventione 1,31-32
- III) TEXTSICHERUNG
- Phänomen 1
- Phänomen 2
- IV) INHALTLICHE INTERPRETATION
- V) RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte der inventio in der Rhetorica ad Herennium und Ciceros De inventione. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der jeweiligen Ansätze zur Gliederung und Darstellung von Argumenten im Kontext der Gerichtsrede.
- Vergleich der inventio-Konzepte in Rhetorica ad Herennium und De inventione
- Analyse der Gliederungsstrukturen (partitio/divisio) in beiden Texten
- Untersuchung der Darstellung von Argumenten und Übereinstimmungen/Differenzen
- Textkritische Betrachtung der Quellen
- Visualisierung der rhetorischen Strukturen
Zusammenfassung der Kapitel
I) Die Texte: Dieser Abschnitt analysiert relevante Passagen aus der Rhetorica ad Herennium (I, 17) und De inventione (I, 31-32), die sich mit der Gliederung der Argumentation (partitio/divisio) in Gerichtsreden befassen. Es werden die unterschiedlichen Ansätze zur Darstellung von Übereinstimmungen und strittigen Punkten verglichen.
II) Visualisierungen: Dieser Teil bietet eine grafische Darstellung der in den Texten beschriebenen rhetorischen Strukturen, um die Gliederungsmodelle der inventio zu veranschaulichen.
III) Textsicherung: Dieser Abschnitt befasst sich mit textkritischen Aspekten der untersuchten Quellen, wobei zwei spezifische Phänomene näher beleuchtet werden.
IV) Inhaltliche Interpretation: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte inhaltliche Analyse der verglichenen Textpassagen und deren Bedeutung im Kontext der antiken Rhetorik.
Schlüsselwörter
Inventio, Rhetorica ad Herennium, De inventione, Partitio, Divisio, Gerichtsrede, Argumentationsstruktur, Textkritik, Rhetorik, Antike.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „Rhetorica ad Herennium“ und Ciceros „De inventione“?
Beide sind antike Lehrwerke der Rhetorik. Die Arbeit vergleicht ihre Ansätze zur „inventio“, also der Findung von Argumenten für eine Rede.
Was bedeuten „partitio“ und „divisio“ in der Rhetorik?
Es handelt sich um die Gliederung einer Rede, bei der Übereinstimmungen und strittige Punkte des Falles dargelegt werden.
Wie wird die „inventio“ in der Gerichtsrede angewendet?
Sie dient dazu, die stärksten Argumente für den eigenen Standpunkt zu finden und die Gliederung so aufzubauen, dass sie den Richter überzeugt.
Welche Rolle spielt die Visualisierung in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt grafische Darstellungen, um die komplexen rhetorischen Strukturen und Gliederungsmodelle beider Werke verständlich zu machen.
Worum geht es in den Kapiteln zur Textsicherung?
Dort werden textkritische Phänomene der antiken Quellen untersucht, um die Verlässlichkeit der überlieferten Texte zu prüfen.
- Citation du texte
- Katharina Los (Auteur), 2007, De inventione und die Rhetorica ad Herennium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125611