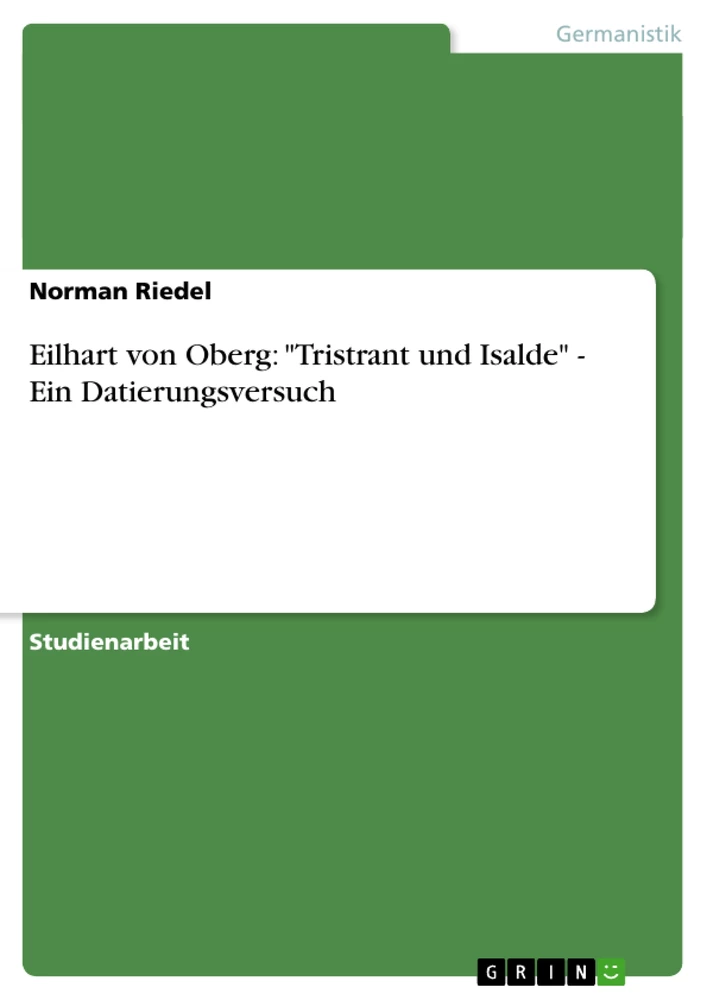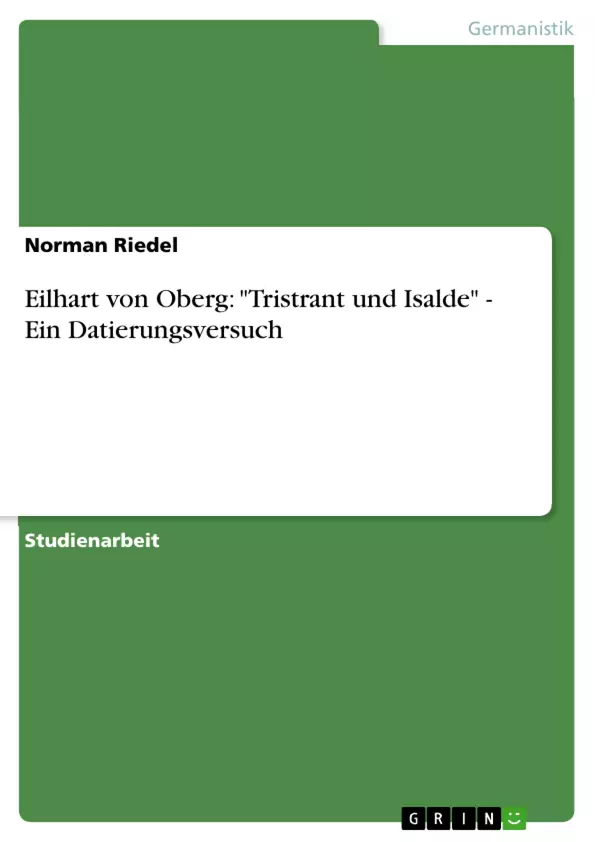Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem höfischen Roman „Tristrant und Isalde“, verfasst von Eilhart von Oberg.
Eilharts Werk nimmt unter den Tristandichtungen des Mittelalters eine Schlüsselposition ein. Zum einen hat seine Übertragung die Tristan-Sage als literarischen Stoff in Deutschland eingeführt, zum anderen ist sie die einzige, die die vollständige Fassung des Stoffes bietet. Die Datierung des Werks stellt die Forschung seit jeher vor große Probleme. Aus den verschiedenen Thesen haben sich zwei Datierungsmöglichkeiten ergeben. Eine Früh- um 1170 sowie eine Spätdatierung um 1190.
Im ersten Teil der Arbeit wird ein Überblick über die Ursprünge des Tristanstoffes gegeben und auf die handschriftliche Überlieferung Eilharts „Tristrant“ eingegangen.
Danach werden verschiedene Meinungen und Thesen zu beiden Datierungsmöglichkeiten diskutiert und versucht, eine von beiden zu favorisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ursprünge des Tristanstoffes
- Handschriftliche Überlieferung des „Tristrant“
- Datierungsversuch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Eilhart von Obergs höfischen Roman „Tristrant und Isalde“ und konzentriert sich auf die Datierung des Werks. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Datierung und diskutiert verschiedene Thesen. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Romans im Kontext der Tristan-Tradition.
- Ursprünge des Tristanstoffes und die „Estoire“
- Handschriftliche Überlieferung von Eilharts „Tristrant“
- Diskussion verschiedener Datierungstheorien (um 1170 und um 1190)
- Eilharts „Tristrant“ im Vergleich zu anderen Tristan-Dichtungen
- Bedeutung von Eilharts Werk für die deutsche Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung von Eilharts „Tristrant und Isalde“ innerhalb der mittelalterlichen Tristan-Literatur. Die Schwierigkeiten bei der Datierung des Werkes werden hervorgehoben.
Die Ursprünge des Tristanstoffes: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Tristanstoffes, seine keltischen Wurzeln und seine Verbreitung in der mittelalterlichen Literatur. Es wird auf die „Estoire“, die hypothetische altfranzösische Urquelle, eingegangen.
Handschriftliche Überlieferung des „Tristrant“: Hier wird die Überlieferung von Eilharts Roman in verschiedenen Handschriften aus dem 12. bis 15. Jahrhundert beschrieben. Die verschiedenen Versionen und ihre Bedeutung für die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes werden erörtert.
Schlüsselwörter
Eilhart von Oberg, Tristrant und Isalde, Tristan-Sage, mittelalterliche Literatur, höfischer Roman, Datierung, Handschriftenüberlieferung, „Estoire“, altfranzösische Literatur, keltische Einflüsse.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Eilhart von Oberg?
Eilhart von Oberg war ein mittelalterlicher Dichter, der mit "Tristrant und Isalde" die Tristan-Sage als literarischen Stoff in Deutschland einführte.
Was ist das Besondere an Eilharts Fassung des Tristanstoffs?
Es ist die einzige mittelalterliche deutsche Bearbeitung, die die vollständige Erzählung des Stoffes von der Geburt bis zum Tod der Protagonisten bietet.
Wann wurde "Tristrant und Isalde" verfasst?
Die Datierung ist umstritten; in der Forschung werden zwei Hauptthesen diskutiert: eine Frühdatierung um 1170 und eine Spätdatierung um 1190.
Was ist die "Estoire" im Zusammenhang mit Tristan?
Die "Estoire" gilt als die hypothetische altfranzösische Urquelle, auf der Eilharts Werk und andere Tristan-Dichtungen basieren sollen.
Wie ist das Werk handschriftlich überliefert?
Das Werk ist in verschiedenen Handschriften und Fragmenten vom 12. bis zum 15. Jahrhundert überliefert, was die Rekonstruktion des Originaltextes erschwert.
Welche Einflüsse prägten den Tristanstoff?
Der Stoff hat starke keltische Wurzeln und wurde über die altfranzösische Literatur in den höfischen Roman eingeführt.
- Citar trabajo
- Norman Riedel (Autor), 2008, Eilhart von Oberg: "Tristrant und Isalde" - Ein Datierungsversuch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125600