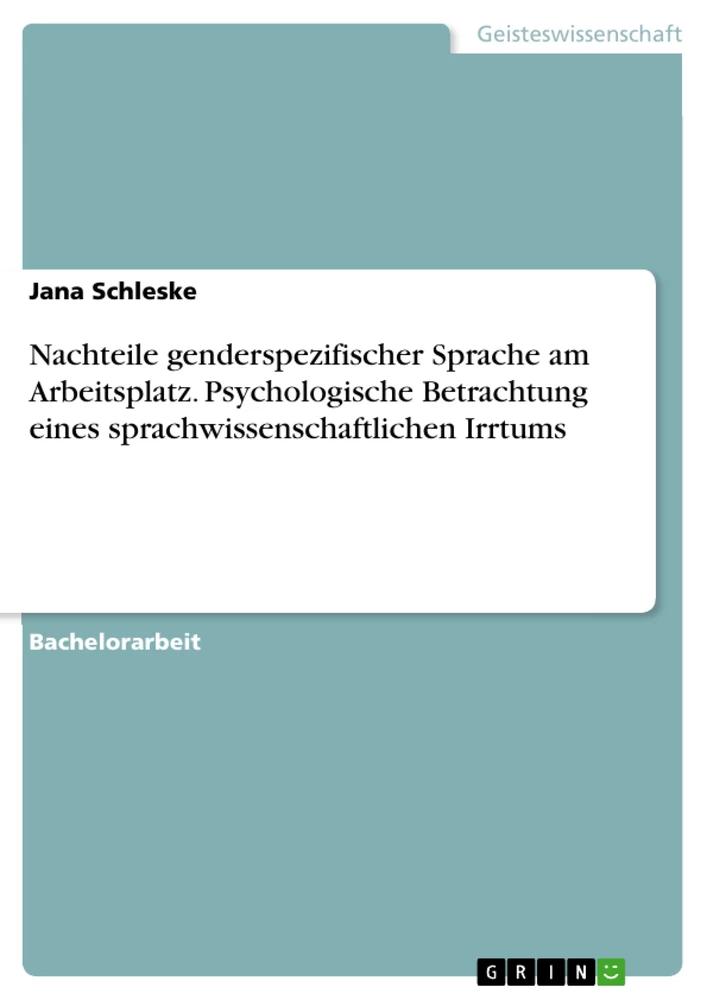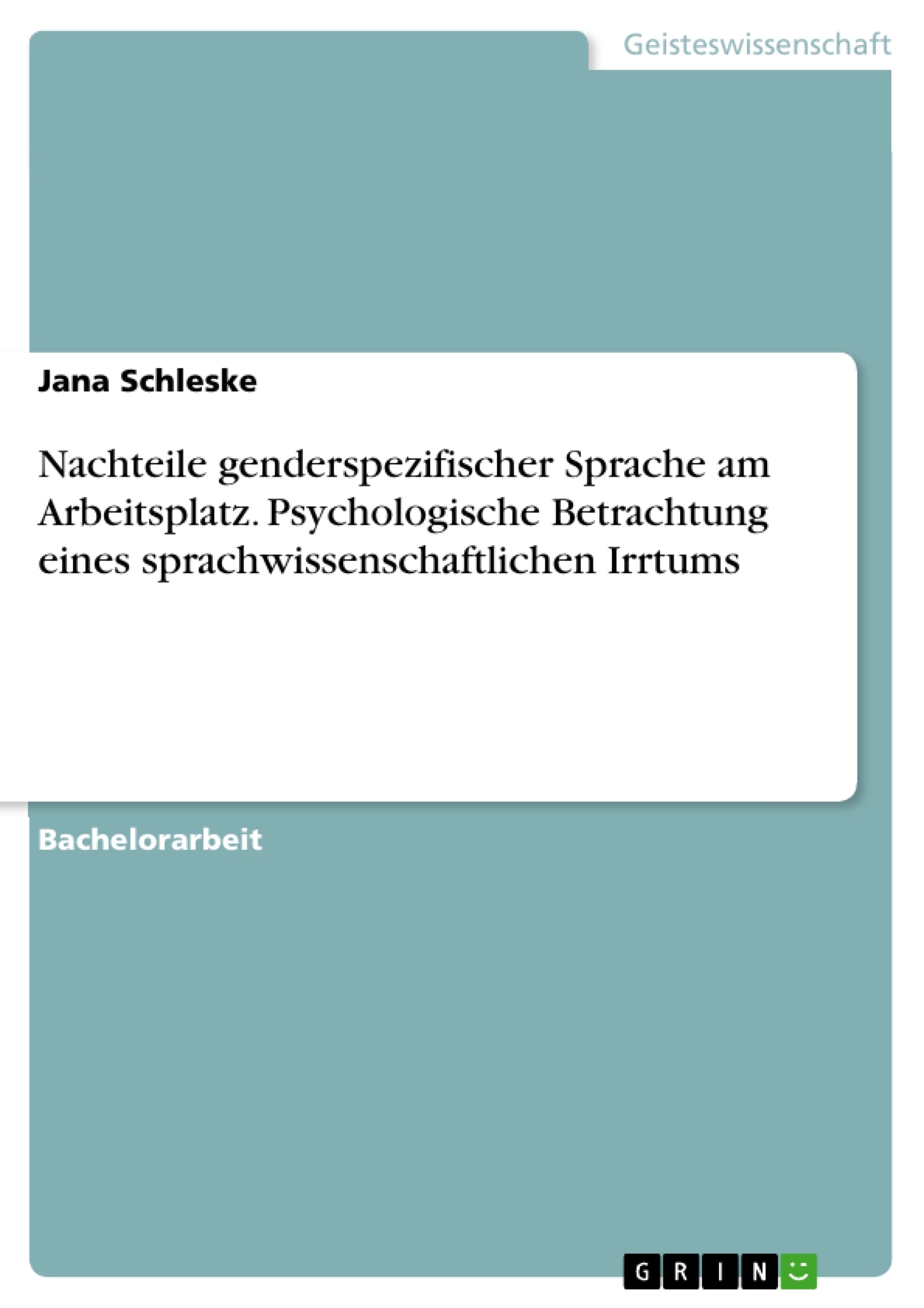Diese Arbeit beleuchtet im theoretischen Teil die unterschiedlichen Teilprobleme der Verwendung genderspezifischer Sprache am Arbeitsplatz. Sie behandelt neben den wirtschaftspsychologischen Modellen, die eine Stereotypisierung der Geschlechter belegen, auch die sprachliche Problematik der Umsetzung einer geschlechtertrennenden Sprache. Mit der Absicht, die Gleichstellung von Mann und Frau weiter voranzutreiben, wird in immer mehr Unternehmen genderspezifische Sprache richtungsweisend eingeführt. Obwohl zahlreiche Studien dahingehend interpretiert werden, dass die Anwendung genderspezifischer Sprache Frauen sichtbarer macht, steigt die Ablehnung in der Bevölkerung. Studien zur unterschiedlichen Wahrnehmung von männlichen und weiblichen Führungskräften haben belegt, dass Frauen allein aufgrund ihrer Weiblichkeit im Karrierebestreben im Nachteil sind.
Die Ursachen für die Benachteiligung sind in der Stereotypisierung der Geschlechter zu suchen. Es stellt sich die Frage, ob die verpflichtende Verwendung einer genderspezifischen Sprache das richtige Mittel ist, um diese Ungleichbehandlung zu beseitigen und die ökonomische Gleichstellung der Geschlechter zu beschleunigen. Wenn Stereotypen die Benachteiligung von Frauen im Berufsleben bewirken, führt der permanente Verweis auf das Geschlecht möglicherweise zu einer Verstärkung der oben genannten Modelle. Wenn das tatsächlich der Fall ist, schadet die Verwendung genderspezifischer Sprache der Gleichstellung der Geschlechter, in dem sie die ständige Sichtbarmachung oder Umgehung des Geschlechtes thematisiert, in den Fokus rückt und so die Stereotypisierung begünstigt.
Folge davon sind möglicherweise Kategorisierung in Eigen- und Fremdgruppe, Bevorzugung der Eigengruppe, Ablehnung der Fremdgruppe. Dieses Zerfallen der Angehörigen eines Unternehmens, einer Berufsgruppe, in Geschlechter verstärkt möglicherweise Probleme von Frauen in oft männlich dominierten Netzwerken. Weiteren Eingang in die Gemengelage finden die nicht konsequent anwendbaren sprach- und schreibpraktischen Umsetzungen genderspezifischer Sprache. Hier wurde mit einer Vielzahl von Schreib- und Sprechvarianten experimentiert, von denen keine eine zufriedenstellende Lösung findet. Die Debatte wird hauptsächlich populärwissenschaftlich im öffentlichen Raum geführt und verweist dennoch immer wieder auf wissenschaftliche Studien zur vermeintlichen Dysfunktionalität der communen Form. Die nähere Betrachtung dieser Studien wirft weitere Fragen auf.
Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ZUSAMMENFASSUNG
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1 WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGISCHE ERKENNTNISSE
- 2.1.1 Think-Manager-Think-Male (TMTM)
- 2.1.2 Lack of fit
- 2.1.3 Backlash
- 2.1.4 Think female think crisis
- 2.1.5 Doppelter Einfluss von Geschlecht
- 2.1.6 Stereotypisierung
- 2.2 SOZIALPSYCHOLOGISCHE PERSPEKTIVE
- 2.2.1 Das weibliche Stereotyp
- 2.2.2 Das männliche Stereotyp
- 2.3 GENDERSPEZIFISCHE SPRACHE
- 2.3.1 Formen genderspezifischer Sprache
- 2.3.2 Grammatikalische Ebene
- 2.3.3 Semantische Ebene
- 2.3.4 Sprachpraktische Ebene
- 2.3.5 Psychologische Ebene
- 2.4 STUDIEN ZU GENDERSPEZIFISCHER SPRACHE
- 3 METHODISCHER TEIL
- 3.1 WAHL DER METHODE
- 3.2 ERSTELLUNG DES FRAGEBOGENS UND ITEMS
- 3.3 HYPOTHESEN
- 3.4 BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
- 3.5 ABLAUF DER UNTERSUCHUNG
- 3.6 AUSWAHL DES STATISTISCHEN VERFAHRENS
- 4 ERGEBNIS
- 5 DISKUSSION
- 5.1 ERGEBNISDISKUSSION
- 5.2 METHODISCHE DISKUSSION
- 5.2.1 STICHPROBE
- 5.2.2 Itemauswahl
- 5.2.3 Durchführung
- 5.2.4 mögliche Verzerrungen
- 5.2.5 Fragebogen
- 5.2.6 Datenanalyse
- 6 FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie genderspezifische Sprache am Arbeitsplatz wirkt und welche Auswirkungen sie auf die Wahrnehmung und Bewertung von Personen hat. Die Arbeit untersucht dabei die psychologischen und sozialen Faktoren, die genderspezifische Sprache beeinflussen und beleuchtet verschiedene Studien zum Thema.
- Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis für genderspezifische Sprache und ihre Auswirkungen am Arbeitsplatz zu erweitern.
- Sie analysiert die psychologischen und sozialen Faktoren, die genderspezifische Sprache prägen.
- Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Stereotypisierung und Vorurteilen in Bezug auf genderspezifische Sprache.
- Sie untersucht verschiedene Studien zum Thema genderspezifische Sprache und deren Ergebnisse.
- Die Arbeit strebt danach, einen Beitrag zum Verständnis von gendergerechter Sprache im professionellen Kontext zu leisten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Themas genderspezifische Sprache am Arbeitsplatz einführt. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert, wobei die Fokusbereiche Wirtschaftpsychologie und Sozialpsychologie beleuchtet werden. Es werden wichtige Theorien und Konzepte wie „Think-Manager-Think-Male" und „Lack of fit" diskutiert, sowie die psychologischen Auswirkungen genderspezifischer Sprache auf die Wahrnehmung von Personen.
Kapitel 3 befasst sich mit der methodischen Herangehensweise der Arbeit. Hier werden die Wahl der Forschungsmethode, die Erstellung des Fragebogens und die Hypotheseformulierung beschrieben. Außerdem werden die Stichprobe der Untersuchung und die angewandten statistischen Verfahren vorgestellt. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert, die sich mit dem Einfluss genderspezifischer Sprache auf die Wahrnehmung und Bewertung von Personen am Arbeitsplatz beschäftigen.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Diskussion der Ergebnisse. Es werden die Ergebnisse der Untersuchung im Kontext der theoretischen Grundlagen interpretiert und mit den Befunden anderer Studien verglichen. Auch werden methodische Überlegungen hinsichtlich der Stichprobe, der Itemauswahl und der Datenanalyse angesprochen.
Schlüsselwörter
Genderspezifische Sprache, Arbeitsplatz, Wirtschaftpsychologie, Sozialpsychologie, Stereotypisierung, Wahrnehmung, Bewertung, Studien, Forschungsmethode, Fragebogen, Hypothese, Stichprobe, Datenanalyse, Ergebnisse, Diskussion, methodische Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kritikpunkte äußert die Arbeit an genderspezifischer Sprache?
Die Arbeit warnt davor, dass der ständige Verweis auf das Geschlecht Stereotype verstärken und Frauen im Berufsleben eher schaden könnte, indem er die Kategorisierung in Eigen- und Fremdgruppen fördert.
Was bedeutet das Modell "Think-Manager-Think-Male"?
Dieses wirtschaftspsychologische Modell beschreibt das Phänomen, dass Führungseigenschaften unbewusst eher mit männlichen als mit weiblichen Stereotypen assoziiert werden.
Warum steigt die Ablehnung genderspezifischer Sprache in der Bevölkerung?
Die Arbeit führt dies unter anderem auf die komplizierte sprachpraktische Umsetzung und die als unbefriedigend empfundenen Schreibvarianten zurück.
Was ist der "Lack of fit"-Ansatz?
Es handelt sich um ein Konzept, das die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Anforderungen einer Stelle und den den Geschlechtern zugeschriebenen Eigenschaften beschreibt.
Führt genderspezifische Sprache wirklich zu mehr Sichtbarkeit für Frauen?
Während Studien dies oft nahelegen, hinterfragt diese Arbeit, ob diese Sichtbarkeit im Karrierekontext aufgrund bestehender Vorurteile tatsächlich vorteilhaft ist.
- Quote paper
- Jana Schleske (Author), 2022, Nachteile genderspezifischer Sprache am Arbeitsplatz. Psychologische Betrachtung eines sprachwissenschaftlichen Irrtums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254819