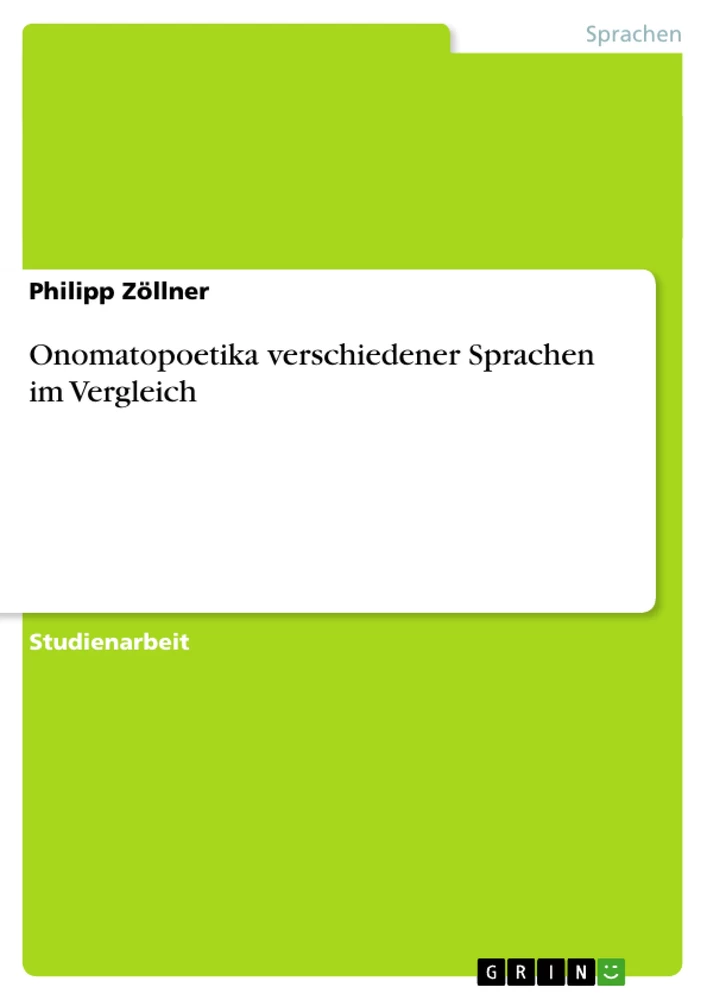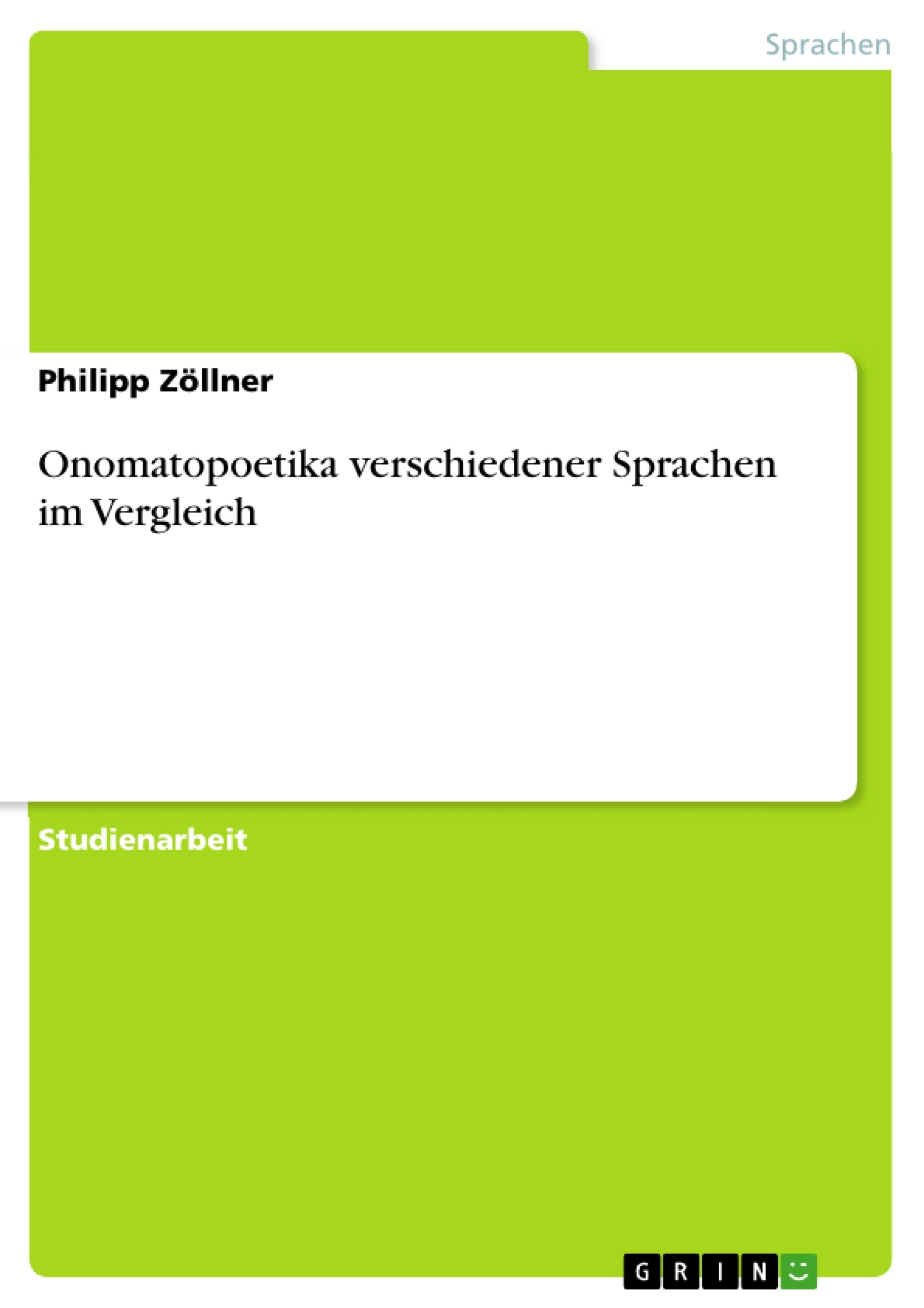„If Statements can assert, then why not sentences? If sentences, then why not phrases? If phrases, why not words? And finally if words can assert, why not sounds? (Graham 1992, S. 24)
Bestimmt hat sich jeder schon einmal gefragt, warum der Baum so heißt wie er heißt und warum er in einer anderen Sprache durch eine andere Lautfolge repräsentiert wird, obwohl diese doch das gleiche meint. Sprachwissenschaftlich gefragt könnte es heißen: Besitzen die Wörter ein naturnotwendiges Verhältnis zur Realität? Aus dieser Frage ergibt sich in weiterer Instanz der Problemkomplex der Onomatopoetika. Die vorliegende Arbeit möchte dieses Phänomen natürlicher Sprachen näher in Augenschein nehmen.
Was ist Lautmalerei? Gibt es spezifische oder sogar universell gültige Kriterien, die ein lautmalerisches Wort kennzeichnen? Wie lassen sich diese wissenschaftlich nachweisen? Um diese drei Kernfragen soll der Betrachtungsgegenstand Onomatopöie entfaltet werden.
Die Frage nach der Beziehung zwischen der Welt der Dinge und der Welt der Namen wurde bereits ab dem fünften vorchristlichen Jahrhundert in Griechenland diskutiert. Für Heraklit spiegelt die Klangstruktur eines Wortes genau seine Bedeutung wider. Demokrit dagegen geht von einer beliebigen Lautgestalt der Wörter aus und argumentiert mit den Phänomenen der Synonymie und Homonymie. Platon vertieft die Fragestellung und kommt zu dem Schluss, dass das sprachliche Zeichen vielmehr die Darstellung einer Idee sei als die Abbildung eines Gegenstands. In der Tatsache, dass unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Worte (Laute) für den gleichen Gegenstand benutzen sieht er keinen Widerspruch. Für ihn gibt es stimmige weniger stimmige und unstimmige Lautformen.1 Aristoteles negiert, wie schon Demokrit, den Zusammenhang zwischen Lautgebilden und deren Bedeutung.
Aus der antiken Diskussion lassen sich zwei hauptsächliche Thesen ableiten, welche sich in ihren Grundzügen bis heute nahezu unverändert gegenüberstehen: Zum einen die analogistische These, welche einen unmittelbare Verknüpfung zwischen Laut und Sinn annimmt und auf der anderen Seite die anomalistische These, die genau das verneint und eine willkürliche, konventionalisierte Beziehung zwischen Wort und Bedeutung sieht.
[...]
Die im Frankreich des 18. Jahrhunderts aufflammende Sprachdebatte zeigt einmal mehr wie eng die Problematik Onomatopoetika mit der Frage nach dem Sprachursprung verbunden ist...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Problemgeschichte
- 2. Onomatopöie – Lautmalerei – Lautsymbolik
- 3. Psychophonetik
- 4. Onomatopoetika im Vergleich
- a. Tiere und ihre Laute
- b. Akustische Phänomene (Geräuschlaute)
- c. Nichtakustische Phänomene
- d. Phonoästheme
- e. Variantenketten
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Onomatopoetika in natürlichen Sprachen. Die Hauptziele sind die Klärung des Begriffs Lautmalerei, die Identifizierung möglicher Kriterien zur Kennzeichnung lautmalerischer Wörter und die wissenschaftliche Überprüfung dieser Kriterien. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Theorien und Ansätzen zur Erklärung des Verhältnisses von Laut und Bedeutung.
- Die historische Entwicklung der Debatte um den Zusammenhang von Laut und Bedeutung.
- Die Gegenüberstellung analogistischer und anomalistischer Thesen zur Onomatopoie.
- Die Rolle der Onomatopoetika im Saussureschen Zeichenmodell.
- Die Untersuchung verschiedener Arten von Onomatopoetika (Tierlaute, Geräuschlaute, etc.).
- Die Bedeutung psychophonetischer Aspekte.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel "Problemgeschichte" beleuchtet die historische Debatte um das Verhältnis von Wort und Bedeutung, beginnend mit der Antike und ihren zentralen Positionen von Heraklit, Demokrit, Platon und Aristoteles. Die Entwicklung der Diskussion im 18. Jahrhundert mit den gegensätzlichen Standpunkten von Rationalisten und Sensualisten wird ebenfalls dargestellt, inklusive der Beiträge von Herder und Grammont. Kapitel 2, "Onomatopöie – Lautmalerei – Lautsymbolik", definiert zentrale Begriffe und legt den Grundstein für die weitere Analyse. Kapitel 3, "Psychophonetik", befasst sich mit den psychologischen und phonetischen Aspekten der Lautmalerei. Kapitel 4, "Onomatopoetika im Vergleich", analysiert verschiedene Kategorien von Onomatopoetika und deren Eigenschaften.
Schlüsselwörter
Onomatopoetika, Lautmalerei, Lautsymbolik, Psychophonetik, Analogistische These, Anomalistische These, Saussure, Sprachursprung, Wortbedeutung, Phonetik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Onomatopoetikum?
Ein Onomatopoetikum ist ein lautmalerisches Wort, das ein natürliches Geräusch durch sprachliche Laute nachahmt (z. B. "Kuckuck" oder "Zischen").
Besitzen Wörter ein naturnotwendiges Verhältnis zur Realität?
Diese Frage wird seit der Antike diskutiert. Die analogistische These bejaht dies für Onomatopoetika, während die anomalistische These von einer willkürlichen Beziehung ausgeht.
Warum klingen Tierlaute in verschiedenen Sprachen unterschiedlich?
Obwohl das Geräusch gleich ist, wird es durch das jeweilige Lautsystem und die kulturellen Konventionen einer Sprache unterschiedlich gefiltert und geformt.
Was untersucht die Psychophonetik?
Sie untersucht die psychologische Wirkung von Lauten und wie bestimmte Klangstrukturen mit spezifischen Emotionen oder Bedeutungen assoziiert werden.
Was sind Phonoästheme?
Phonoästheme sind Lautgruppen, die eine bestimmte Bedeutungseinheit suggerieren, ohne ein direktes Morphem zu sein (z. B. das gl- in glitzern, glänzen, glimmen für Lichteffekte).
- Citation du texte
- Magister Artium Philipp Zöllner (Auteur), 2004, Onomatopoetika verschiedener Sprachen im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125063