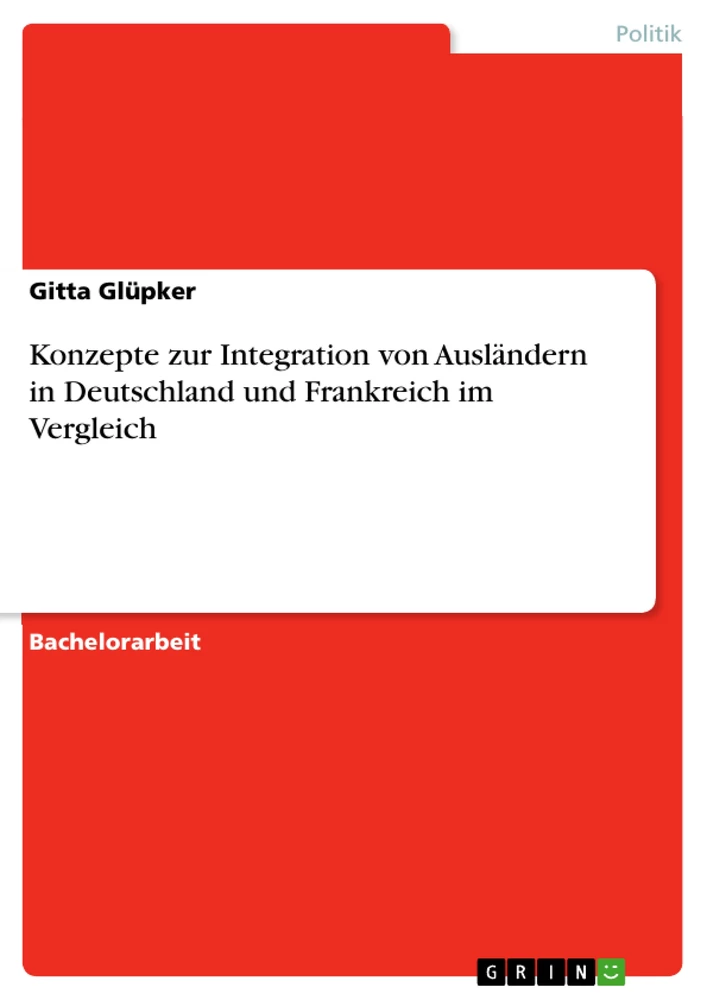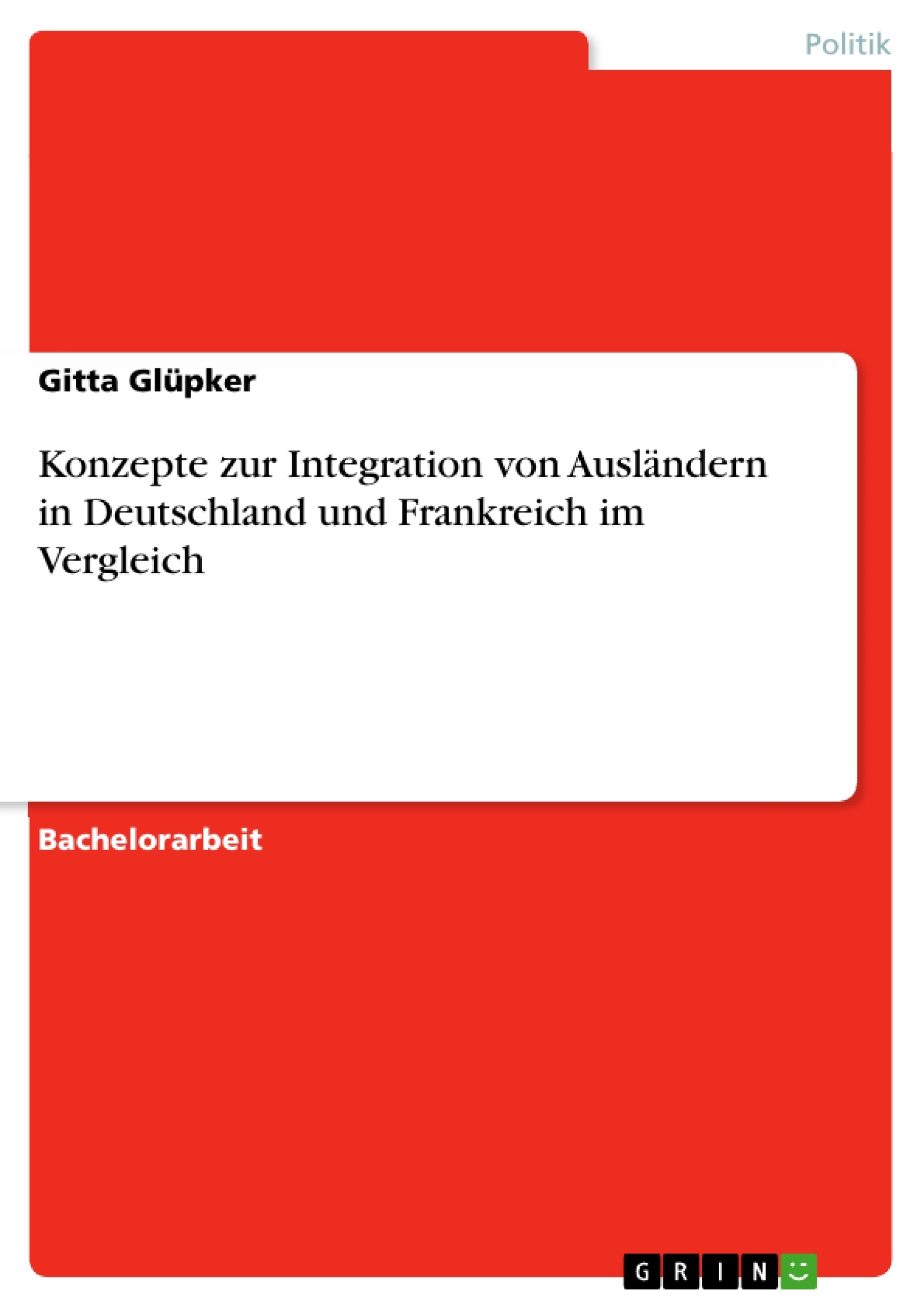Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des deutschen und des französischen Umgangs mit Immigranten waren in der Vergangenheit häufig Gegenstand der Literatur, allerdings wurden selten direkte Gegenüberstellungen erarbeitet. Die Existierenden sind selten aktuell. Dabei weisen die beiden Staaten hervorragende Ansatzpunke für einen Vergleich auf: Institutionelle Gemeinsamkeiten, ihre Existenz als stabile Demokratien mit anerkannter Religionsfreiheit, ein Säkularisierungsprozess, der in beiden Staaten nachweisbar ist, aber auch eindeutige Unterschiede in der Beziehung zwischen Staat und Religion sind hierbei zu nennen.
Diese Arbeit stellt die deutschen und französischen Konzepte zur Integration von Ausländern einander gegenüber. Der Vergleich wird die Fragen beantworten, ob zwischen ihnen ausreichend Konvergenzen bestehen, damit eine Angleichung der Integrationspolitiken und eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten möglich wäre. Ferner werden die Maßnahmen vorgestellt, die von der Europäischen Union in diesem Politikbereich ergriffen wurden, um zu untersuchen, inwiefern die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit einer gemeinsamen Integrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen in Betracht ziehen und ob sich Einflüsse eines nationalen Konzeptes auf die EU-Politik bzw. letzterer auf die nationalen Integrationsmaßnahmen feststellen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 2.1 Was ist „Integration“?
- 2.2 Was ist „Integrationspolitik“?
- 2.3 Was ist „der Islam“?
- 3. Das deutsche Integrationskonzept
- 3.1 Geschichtliche Entwicklung
- 3.1.1 „Nation“ in Deutschland: ein kulturalistischer Begriff
- 3.1.2 Religionen und der deutsche Staat: das korporatistische Modell
- 3.1.3 Islamische Einwanderung nach Deutschland
- 3.2 Integrationspolitik in Deutschland
- 3.2.1 Maßnahmen zur besseren Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte: Integration von Ausländern
- 3.2.1.1 Zuständige Institutionen
- 3.2.1.2 Integrationsmaßnahmen
- 3.2.2 Der Umgang mit Forderungen nach kulturellen Rechten: Integration von Muslimen
- 3.2.2.1 Repräsentation der Muslime in Deutschland
- 3.2.2.2 Kopftücher an öffentlichen Schulen
- 3.2.2.3 Islamischer Religionsunterricht
- 3.2.2.4 Schächten
- 3.2.2.5 Islamische Bestattungen
- 3.2.1 Maßnahmen zur besseren Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte: Integration von Ausländern
- 3.1 Geschichtliche Entwicklung
- 4. Das französische Integrationskonzept
- 4.1 Geschichtliche Entwicklung
- 4.1.1 „Nation“ in Frankreich: ein republikanisches Konzept
- 4.1.2 Religionen und der französische Staat: das etatistisch-republikanische Modell
- 4.1.3 Islamische Einwanderung nach Frankreich
- 4.2 Integrationspolitik in Frankreich
- 4.2.1 Maßnahmen zur besseren Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte: Integration von Ausländern
- 4.2.1.1 Zuständige Institutionen
- 4.2.1.2 Integrationsmaßnahmen
- 4.2.2 Der Umgang mit Forderungen nach kulturellen Rechten: Integration von Muslimen
- 4.2.2.1 Repräsentation der Muslime in Frankreich
- 4.2.2.2 Kopftücher an öffentlichen Schulen
- 4.2.2.3 Islamischer Religionsunterricht
- 4.2.2.4 Schächten und andere Nahrungsvorschriften
- 4.2.2.5 Moscheebau und Friedhöfe
- 4.2.1 Maßnahmen zur besseren Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte: Integration von Ausländern
- 4.1 Geschichtliche Entwicklung
- 5. Vergleich
- 5.1 Unterschiede
- 5.1.1 Rahmenbedingungen
- 5.1.2 Institutionen
- 5.1.3 Integrationsmaßnahmen
- 5.2 Konvergenzen
- 5.2.1 Rahmenbedingungen
- 5.2.2 Institutionen
- 5.2.3 Integrationsmaßnahmen
- 5.3 Erklärungsansätze
- 5.1 Unterschiede
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Integrationskonzepte Deutschlands und Frankreichs vergleichend zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Die Untersuchung soll klären, ob eine Angleichung der Integrationspolitiken und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten möglich ist. Die Rolle der Europäischen Union im Kontext der Integrationspolitik von Drittstaatsangehörigen wird ebenfalls beleuchtet.
- Vergleich der deutschen und französischen Integrationskonzepte
- Analyse der historischen Entwicklung der Integrationspolitik in beiden Ländern
- Untersuchung der institutionellen Rahmenbedingungen und Maßnahmen
- Bewertung der Konvergenzen und Divergenzen beider Ansätze
- Bedeutung der EU-Politik im Bereich der Integrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit vergleicht die deutschen und französischen Integrationskonzepte für Ausländer und untersucht die Möglichkeit einer Angleichung der Integrationspolitiken und Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten. Sie beleuchtet auch die Rolle der Europäischen Union und deren Einfluss auf die nationalen Integrationsmaßnahmen. Der Vergleich Deutschlands und Frankreichs ist aufgrund institutioneller Gemeinsamkeiten, stabiler Demokratien mit Religionsfreiheit und eines vergleichbaren Säkularisierungsprozesses, aber auch aufgrund eindeutiger Unterschiede in der Beziehung zwischen Staat und Religion, besonders aussagekräftig. Die "privilegierte Sonderbeziehung" zwischen beiden Ländern im europäischen Integrationsprozess wird als weiterer Grund für die Auswahl genannt.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Integration", "Integrationspolitik" und "Islam" im Kontext der Arbeit. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die verwendeten Schlüsselbegriffe präzisiert und ihre jeweilige Bedeutung im Hinblick auf den Vergleich der deutschen und französischen Integrationsmodelle erläutert. Diese präzise Begriffsbestimmung ist essenziell für eine objektive und vergleichende Analyse.
3. Das deutsche Integrationskonzept: Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung des deutschen Integrationskonzepts, beginnend mit der Betrachtung des Begriffs "Nation" als kulturelles Konzept. Es beleuchtet das korporatistische Modell der Beziehung zwischen Religion und Staat in Deutschland und die Geschichte der islamischen Einwanderung. Der Schwerpunkt liegt auf den konkreten Integrationsmaßnahmen der deutschen Politik, differenziert zwischen Maßnahmen zur Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte und dem Umgang mit Forderungen nach kulturellen Rechten von Muslimen. Die Rolle von Institutionen wie dem BAMF und die Debatten um Kopftücher, islamischen Religionsunterricht, Schächten und islamische Bestattungen werden detailliert behandelt.
4. Das französische Integrationskonzept: Ähnlich dem vorherigen Kapitel wird hier die historische Entwicklung des französischen Integrationskonzepts erörtert, wobei der Fokus auf dem republikanischen Verständnis von "Nation" liegt. Das etatistisch-republikanische Modell der Beziehung zwischen Staat und Religion wird analysiert, sowie die Geschichte der islamischen Einwanderung nach Frankreich. Die französischen Integrationsmaßnahmen werden detailliert untersucht, insbesondere im Hinblick auf die Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte sowie den Umgang mit kulturellen Forderungen der muslimischen Bevölkerung. Institutionen, Debatten um Kopftücher, islamischen Religionsunterricht, Schächten, Moscheebau und islamische Friedhöfe werden beleuchtet.
5. Vergleich: Dieses Kapitel stellt die deutschen und französischen Integrationskonzepte gegenüber. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Rahmenbedingungen, Institutionen und Integrationsmaßnahmen herausgearbeitet. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse der Konvergenzen und Divergenzen, um mögliche Erklärungen für die beobachteten Unterschiede zu finden. Die Kapitel bieten eine differenzierte vergleichende Analyse der beiden Systeme und erörtern mögliche Erklärungsansätze für die festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Schlüsselwörter
Integration, Integrationspolitik, Deutschland, Frankreich, Islam, Muslime, Einwanderung, Nation, Religion, Staat, Vergleich, Konvergenzen, Divergenzen, EU, Integrationsmaßnahmen, kulturelle Rechte, soziale Rechte, Repräsentation, Korporatismus, Republikanismus.
FAQ: Vergleichende Analyse der Integrationskonzepte Deutschlands und Frankreichs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Integrationskonzepte Deutschlands und Frankreichs für Ausländer und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ein Schwerpunkt liegt auf der Möglichkeit einer Angleichung der Integrationspolitiken und einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten. Die Rolle der Europäischen Union wird ebenfalls betrachtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Integrationspolitik in beiden Ländern, untersucht die institutionellen Rahmenbedingungen und Maßnahmen, bewertet Konvergenzen und Divergenzen der Ansätze und beleuchtet die Bedeutung der EU-Politik im Bereich der Integrationspolitik. Sie definiert zentrale Begriffe wie "Integration", "Integrationspolitik" und "Islam" und untersucht detailliert den Umgang mit kulturellen und sozialen Rechten von Muslimen in beiden Ländern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung, das deutsche Integrationskonzept, das französische Integrationskonzept und ein Vergleichskapitel. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Integrationspolitik in Deutschland und Frankreich, einschließlich historischer Entwicklungen, institutioneller Rahmenbedingungen und konkreter Maßnahmen. Das letzte Kapitel vergleicht die beiden Systeme und bietet Erklärungsansätze für Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Welche Länder werden verglichen und warum?
Die Arbeit vergleicht Deutschland und Frankreich. Die Auswahl dieser beiden Länder basiert auf institutionellen Gemeinsamkeiten (stabile Demokratien mit Religionsfreiheit, vergleichbarer Säkularisierungsprozess), aber auch auf eindeutigen Unterschieden in der Beziehung zwischen Staat und Religion. Die "privilegierte Sonderbeziehung" zwischen beiden Ländern im europäischen Integrationsprozess ist ein weiterer Grund für den Vergleich.
Welche konkreten Aspekte der Integrationspolitik werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die historischen Entwicklungen der Integrationspolitik, die institutionellen Rahmenbedingungen (zuständige Institutionen, Maßnahmen), den Umgang mit kulturellen Rechten von Muslimen (Kopftücher, islamischer Religionsunterricht, Schächten, Bestattungen/Moscheebau, Friedhöfe) und die Maßnahmen zur Wahrnehmung sozialer und politischer Rechte von Ausländern. Die Arbeit untersucht sowohl Konvergenzen als auch Divergenzen.
Welche Rolle spielt die Europäische Union?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Europäischen Union im Kontext der Integrationspolitik von Drittstaatsangehörigen und deren Einfluss auf die nationalen Integrationsmaßnahmen in Deutschland und Frankreich.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Integration, Integrationspolitik, Deutschland, Frankreich, Islam, Muslime, Einwanderung, Nation, Religion, Staat, Vergleich, Konvergenzen, Divergenzen, EU, Integrationsmaßnahmen, kulturelle Rechte, soziale Rechte, Repräsentation, Korporatismus, Republikanismus.
Was ist das Fazit der Arbeit (in Kürze)?
Die Arbeit analysiert die Integrationskonzepte Deutschlands und Frankreichs, identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede und untersucht die Möglichkeit einer Angleichung der Integrationspolitiken und verstärkter Zusammenarbeit. Die Ergebnisse bieten eine differenzierte vergleichende Analyse und erörtern mögliche Erklärungsansätze für die festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Quote paper
- B. A. Gitta Glüpker (Author), 2007, Konzepte zur Integration von Ausländern in Deutschland und Frankreich im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124567