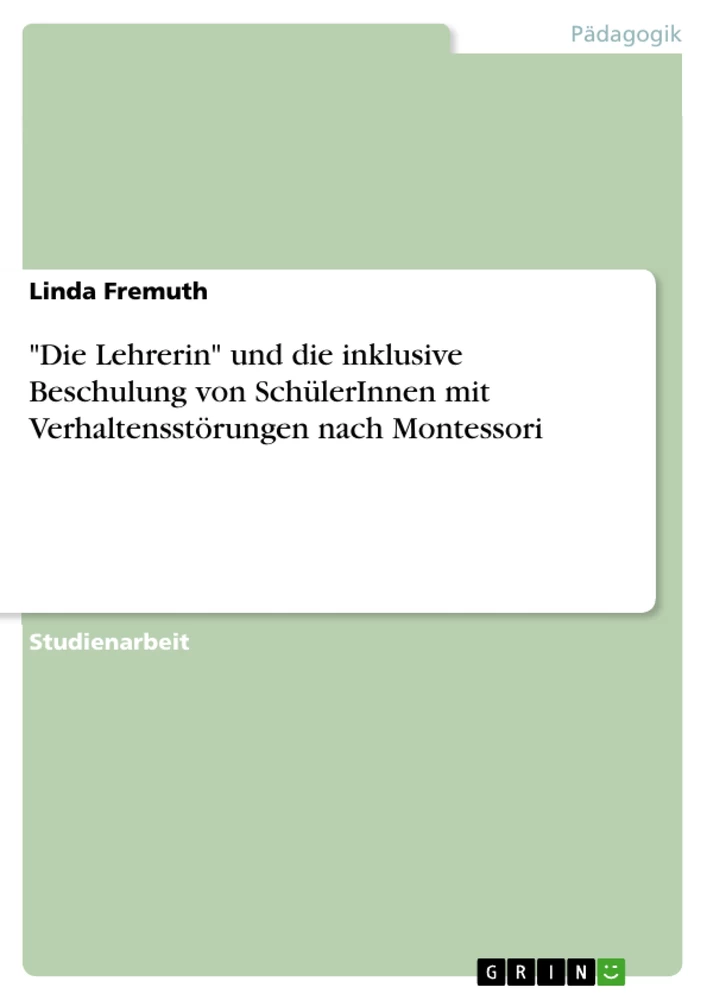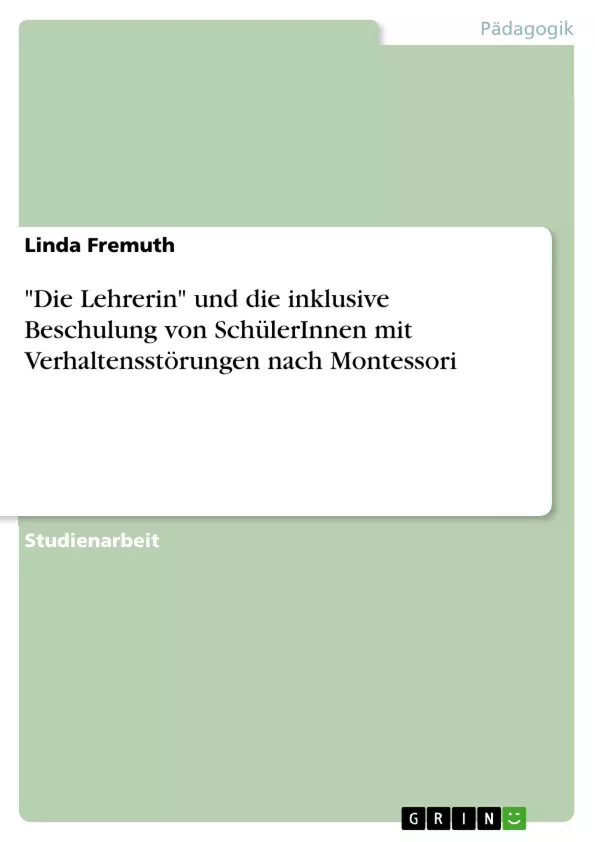Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Position der "Lehrerin" nach Montessori, als Pädagogin, Therapeutin und Autoritätsfigur. Montessoris "Lehrerin" als Chance für die inklusive Beschulung von SchülerInnen mit Verhaltensstörungen.
Die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870-1952) zählt international zu den bedeutendsten VertreterInnen der reformpädagogischen Bewegung, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer „Pädagogik vom Kinde aus“ verschrieben hat. An autoritären Ansichten Kritik übend, wird hier von Strafen und unnötigem Eingreifen des Erwachsenen abgesehen, um dem Kind ein „Wachsen lassen“ zu gewähren.
Inwiefern „die Lehrerin“ als Autorität nach Montessoris Vorstellungen den Anforderungen einer pädagogischen Führung genügt und wie förderlich ihre Haltung für die Integration verhaltensauffälliger SchülerInnen ist, soll untersucht werden. Welche Chancen ergeben sich dadurch für verhaltensauffällige SchülerInnen an Montessori-Schulen?
Jedes Kind ist anders. So einfach diese Aussage auch klingen mag: dieser Verschiedenheit in einer großen, heterogenen Gruppe gerecht zu werden, stellt vor allem Lehrerinnen vor eine schwierige Herausforderung. Eine gemeinsame Beschulung, unabhängig von der jeweils individuellen Ausgangslage, ist ein zentraler Gedanke inklusiver Schulpädagogik und verlangt ein pädagogisches Handeln, das an dieser Individualität ausgerichtet ist. Doch was ist, wenn das Kind der schulischen Situation scheinbar nicht gewachsen ist und ein Verhalten an den Tag legt, das so gar nicht in das Unterrichtsgeschehen passt?
Wenn Verhaltensstörungen in der Schule offenbart werden, sind vor allem die LehrerInnen betroffen und gefragt, sich intensiv mit der Problematik auseinanderzusetzen. Göppel spricht hier mit Nohls Worten von einem „Ernstfall der Pädagogik“, der allzu häufig in therapeutischen Maßnahmen oder sonderpädagogischen Ansätzen mündet. Allerdings stellt sich die Frage, ob die allgemeine Pädagogik hier tatsächlich schon an ihre Grenzen stößt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verhaltensstörungen und Montessoris Devianztheorie
- Förderliches Verhalten von LehrerInnen – PädagogIn, TherapeutIn, Autorität?
- Montessoris Grundgedanken
- Das Kind
- Kindliches Lernen
- Die Lehrerin nach Montessori
- Haltung der Lehrerin
- Die Lehrerin als Autorität
- Die Lehrerin und Kinder mit Verhaltensstörungen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Integration verhaltensauffälliger SchülerInnen in den schulischen Alltag. Sie untersucht die Rolle der Lehrerin als Autorität im Sinne Maria Montessoris und beleuchtet, wie die von ihr propagierte Pädagogik vom Kinde aus dazu beitragen kann, Verhaltensstörungen zu überwinden und inklusive Beschulung zu ermöglichen. Die Arbeit betrachtet die Devianztheorie Montessoris im Kontext aktueller pädagogischer Ansätze und stellt die Frage, ob die Lehrerin gleichzeitig PädagogIn, TherapeutIn und Autorität sein kann.
- Verhaltensstörungen und deren interaktionistische Betrachtungsweise
- Montessoris Devianztheorie und der Prozess der Normalisation
- Die Rolle der Lehrerin als Autorität im Sinne Montessoris
- Förderliches Verhalten von LehrerInnen und die Bedeutung von Akzeptanz, Empathie und Kongruenz
- Chancen für verhaltensauffällige SchülerInnen an Montessori-Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik von Verhaltensstörungen in der Schule dar und verdeutlicht die Bedeutung inklusiver Pädagogik. Sie führt Maria Montessori als Vertreterin der reformpädagogischen Bewegung ein und beleuchtet den Konflikt zwischen „Führen“ und „Wachsenlassen“ im pädagogischen Kontext.
- Verhaltensstörungen und Montessoris Devianztheorie: Dieses Kapitel beschreibt den Begriff der Verhaltensstörung aus interaktionistischer Sicht und stellt die Devianztheorie Montessoris vor. Maria Montessori unterscheidet zwischen „normalen“ und „devianten“ Kindern und argumentiert, dass die Problematik in der Pädagogik liegt.
- Förderliches Verhalten von LehrerInnen – PädagogIn, TherapeutIn, Autorität?: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Beziehungen in der Erziehung und die besondere Verantwortung der LehrerInnen im Umgang mit Verhaltensstörungen hervorgehoben. Die Arbeit greift die Forschungsergebnisse von Annette Textor auf, die die Bedeutung von Akzeptanz, Empathie und Kongruenz in der Lehrer-Schüler-Beziehung betont.
- Montessoris Grundgedanken: Dieses Kapitel stellt Montessoris Pädagogik vom Kinde aus dar und beleuchtet ihre Konzepte zum Kind, kindlichem Lernen und der Rolle der Lehrerin. Die Lehrerin soll eine autoritäre Haltung vermeiden und das Kind in seiner Entwicklung unterstützen.
- Die Lehrerin und Kinder mit Verhaltensstörungen: Dieses Kapitel untersucht die Chancen für verhaltensauffällige SchülerInnen an Montessori-Schulen. Es wird angenommen, dass Montessoris Pädagogik einen positiven Einfluss auf die Integration und Entwicklung dieser SchülerInnen haben kann.
Schlüsselwörter
Inklusion, Verhaltensstörungen, Montessori-Pädagogik, Devianztheorie, Normalisation, Lehrerrolle, Autorität, Akzeptanz, Empathie, Kongruenz, Beziehungspädagogik, Förderung, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Lehrerin in der Montessori-Pädagogik?
Die Lehrerin fungiert als Beobachterin und Begleiterin, die dem Kind hilft, sich selbst zu entwickeln ("Hilf mir, es selbst zu tun"), statt autoritär einzugreifen.
Was besagt Montessoris Devianztheorie?
Montessori sieht Verhaltensstörungen (Devianzen) oft als Folge einer unpassenden Umgebung. Durch den Prozess der "Normalisation" in einer vorbereiteten Umgebung können diese überwunden werden.
Wie unterstützt Montessori die Inklusion von Kindern mit Verhaltensstörungen?
Durch individuelle Förderung, Akzeptanz und eine Umgebung, die dem Kind ermöglicht, zur Ruhe zu kommen und konzentriert zu arbeiten, wird Inklusion erleichtert.
Kann eine Lehrerin gleichzeitig Pädagogin und Therapeutin sein?
Die Arbeit untersucht, ob die heilpädagogische Haltung der Montessori-Lehrerin therapeutische Züge trägt, die besonders bei Verhaltensauffälligkeiten wirksam sind.
Was sind die wichtigsten Werte in der Lehrer-Schüler-Beziehung nach Montessori?
Akzeptanz, Empathie und Kongruenz sind entscheidend, um eine vertrauensvolle Basis für das kindliche Wachstum zu schaffen.
- Citation du texte
- Linda Fremuth (Auteur), 2022, "Die Lehrerin" und die inklusive Beschulung von SchülerInnen mit Verhaltensstörungen nach Montessori, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1242852