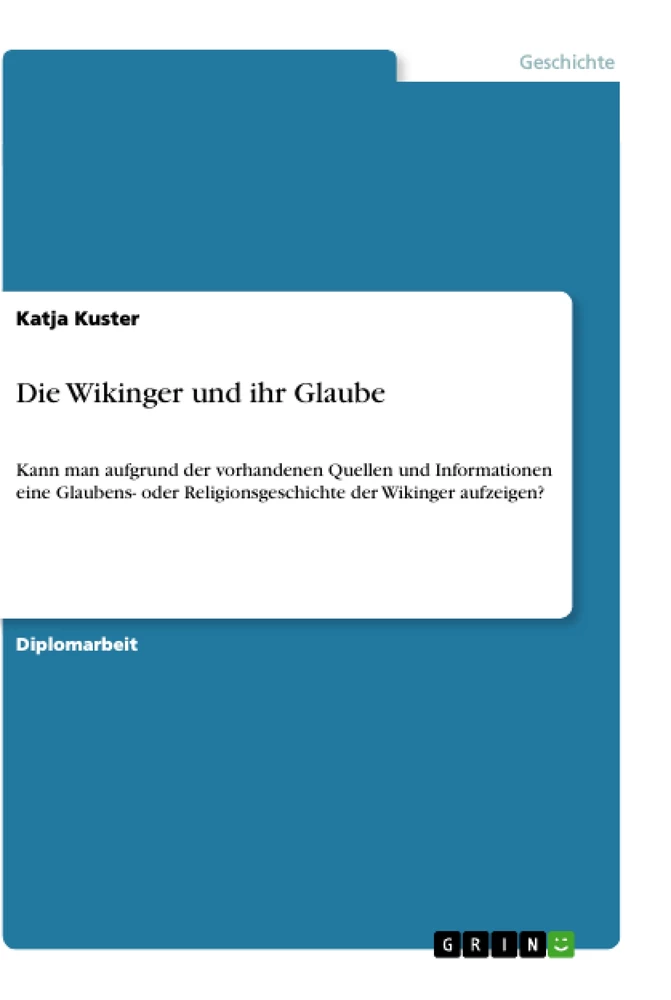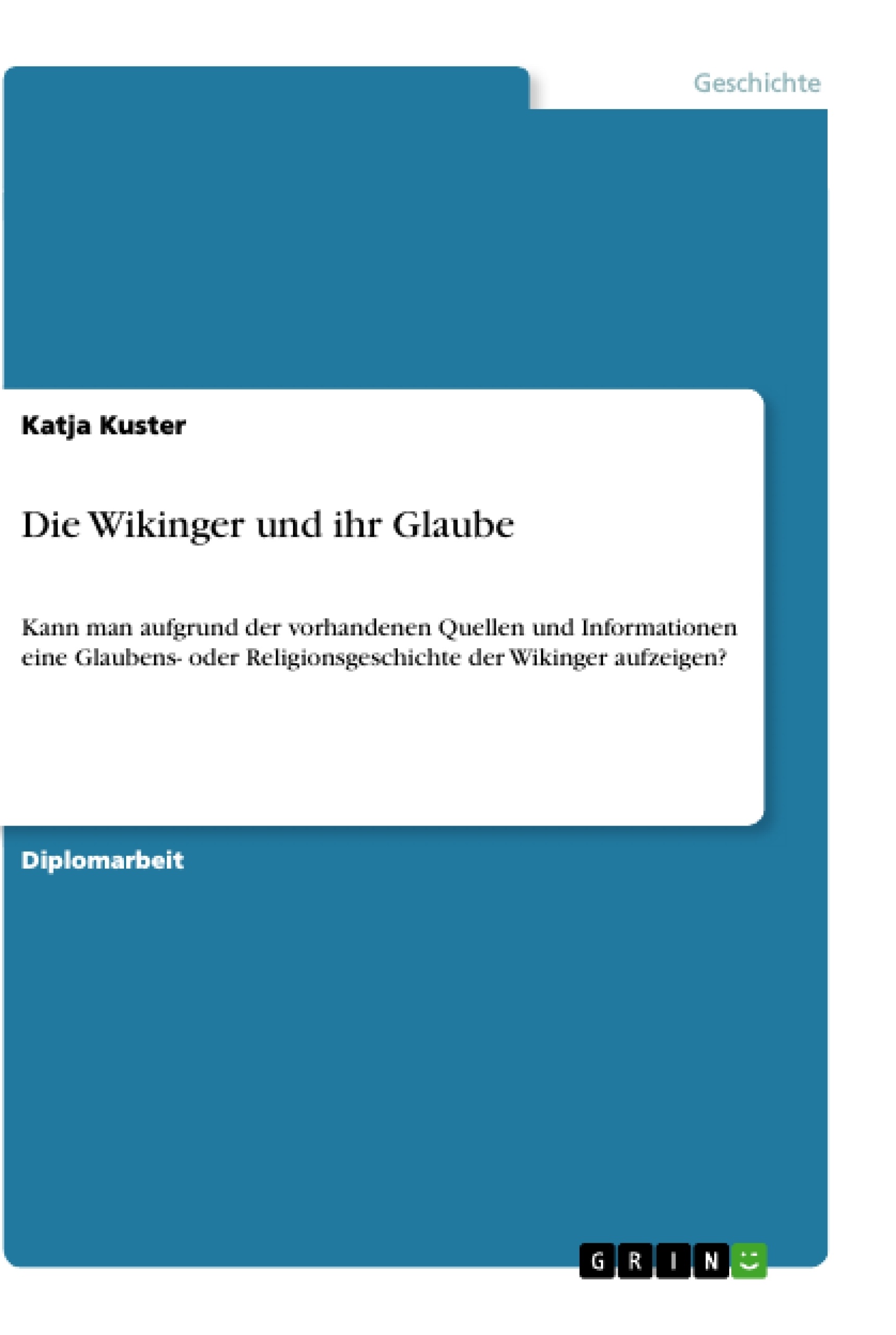Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich dem Glauben und der Religion der Wikinger, die vor allem zwischen dem achten und elften Jahrhundert mit dem Christentum in Berührung kamen. Die Christianisierung Skandinaviens zog sich über mehrere Jahrhunderte hin und selbst heute gibt es in Island oder Norwegen noch Gemeinschaften, die heidnische Kulte ausüben und die alten Götter des Nordens verehren. Es soll daher erörtert werden, wie viele Informationen man aus den vorhandenen Quellen ziehen kann, die Aufschlüsse über die Glaubensvorstellungen der Wikinger geben können und ob diese nachvollziehbar sind oder rein spekulativ. Kann man aufgrund der vorhandenen Quellen und Informationen eine Glaubens- oder Religionsgeschichte der Wikinger aufzeigen? Ist das Heidentum wirklich vom christlichen Glauben verdrängt worden oder konnten sich einige Insignien und Rituale des Heidentums im Christentum manifestieren?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Begriffserläuterungen
- 1.1. Religion
- 1.2. Wikinger
- 2. Quellenlage / Quellenproblematik
- 2.1. Archäologische Quellen
- 2.1.1. Kultplätze
- 2.2. Runen
- 2.3. Altnordische Überlieferungen
- 2.3.1. Edda des Snorri Sturluson
- 2.3.2. Skaldendichtung
- 3. Religiöse und gesellschaftliche Grundlagen der Wikinger
- 3.1. Sippe bzw. Familie der Wikinger
- 3.2. Menschliches Zusammenleben
- 3.3. Gesellschaftsordnung
- 4. Vorchristliche Religion im Norden
- 4.1. Wikingerzeitliches Weltbild
- 4.1.1. Entstehung der Welt
- 4.1.2. Ragnarök
- 4.1.3. Schicksal
- 4.2. Götter und Gottheiten
- 4.2.1. Odin
- 4.2.2. Thor
- 4.2.3. Balder
- 4.2.4. Loki
- 4.2.5. Freyr und Freyja
- 4.3. Mythische Wesen und Erscheinungen
- 4.3.1. Riesen
- 4.3.2. Alben
- 4.3.3. Zwerge
- 4.3.4. Disen
- 4.3.5. Walküren
- 4.4. Kulte und Riten der vorchristlichen Wikinger
- 5. Das Leben nach dem Tod
- 5.1. Grabformen
- 5.2. Grabbeigaben
- 5.2.1. Waffen als Grabbeigabe
- 5.2.2. Pferdegräber
- 5.2.3. Bedeutung der Schiffe als Grabbeigabe
- 5.3. Bestattungsriten
- 5.4. Totenreiche im wikingischen Heidentum
- 5.4.1. Walhalla
- 5.4.2. Hel
- 5.4.3. Ran
- 6. Frühe Kontakte mit dem Christentum
- 6.1. Mögliche Ursachen der wikingischen Expansion
- 6.2. Frühe Handelszentren in Skandinavien
- 6.2.1. Haithabu
- 6.3. Erste Raubzüge
- 6.4. Wikingische Expansionsvorhaben
- 7. Der Einzug des Christentums im Norden
- 7.1. Missionstätigkeiten im Norden
- 7.2. Missionierungen in Dänemark und Schweden
- 7.2.1. Ansgar – der Apostel des Nordens
- 7.3. Integration der Wikinger in England
- 7.4. Wikinger werden zu Normannen
- 8. Christianisierung Skandinaviens
- 8.1. Dänemarks Christianisierung
- 8.2. Norwegens Christianisierung
- 8.2.1. Bekehrung Islands
- 8.3. Schwedens Christianisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Glauben der Wikinger und deren Kontakt mit dem Christentum zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert. Ziel ist es, die vorhandenen Quellen (archäologische Funde, Runen, altnordische Überlieferungen) auf ihre Aussagekraft bezüglich der wikingischen Glaubensvorstellungen zu prüfen und eine mögliche Religionsgeschichte zu rekonstruieren. Die Arbeit fragt nach dem Ausmaß der Verdrängung des Heidentums durch das Christentum und nach möglichen Überresten heidnischer Elemente im christlichen Glauben.
- Rekonstruktion der vorchristlichen Religion der Wikinger anhand verschiedener Quellen.
- Analyse der Quellenlage und der damit verbundenen Problematik.
- Untersuchung der religiösen und gesellschaftlichen Strukturen der Wikinger.
- Beschreibung des Prozesses der Christianisierung Skandinaviens.
- Erforschung des Verhältnisses zwischen heidnischen und christlichen Glaubensvorstellungen.
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Erforschung des Glaubens der Wikinger und ihres Kontakts mit dem Christentum, die Herausforderungen bei der Quelleninterpretation und die Forschungsfrage nach einer möglichen Rekonstruktion der wikingischen Religionsgeschichte und dem Einfluss des Heidentums auf das sich etablierende Christentum. Es wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.
1. Begriffserläuterungen: Dieses Kapitel klärt die verwendeten Begriffe "Religion" und "Wikinger", um Missverständnisse zu vermeiden und den Rahmen der Untersuchung zu definieren. Es wird auf die Schwierigkeiten eingegangen, den Begriff "Religion" auf die Wikinger anzuwenden, da deren Glaubensvorstellungen möglicherweise nicht mit modernen Religionsverständnissen übereinstimmen.
2. Quellenlage / Quellenproblematik: Dieses Kapitel analysiert die verfügbaren Quellen zur Erforschung des wikingischen Glaubens. Es wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus dem Mangel an schriftlichen Quellen ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung archäologischer Funde, Runeninschriften und altnordischer Überlieferungen (Edda, Skaldendichtung) und deren jeweiligen Stärken und Schwächen als Quellen. Der indirekte Beweiswert archäologischer Funde wird hervorgehoben.
3. Religiöse und gesellschaftliche Grundlagen der Wikinger: Dieses Kapitel untersucht die Verflechtung von Religion und Gesellschaft bei den Wikingern. Es werden Aspekte wie die Bedeutung der Sippe, die soziale Ordnung und das menschliche Zusammenleben im Kontext des religiösen Systems analysiert. Die Interdependenz zwischen gesellschaftlichen Strukturen und religiösen Praktiken wird beleuchtet.
4. Vorchristliche Religion im Norden: Dieses Kapitel beschreibt das vorchristliche Weltbild der Wikinger, einschließlich der Kosmogonie, des Schicksalsglaubens und des Ragnaröks. Es werden die wichtigsten Götter (Odin, Thor, Balder, Loki, Freyr und Freyja) und mythische Wesen (Riesen, Alben, Zwerge, Disen, Walküren) vorgestellt und ihre Rollen im religiösen System erläutert. Der polytheistische Charakter des Glaubens wird betont.
5. Das Leben nach dem Tod: Dieses Kapitel widmet sich den Jenseitsvorstellungen der Wikinger. Es analysiert Grabformen, Grabbeigaben (Waffen, Pferde, Schiffe), Bestattungsriten und die verschiedenen Totenreiche (Walhalla, Hel, Ran) im wikingischen Heidentum. Die Bedeutung der Grabbeigaben wird im Kontext der Jenseitsvorstellungen erläutert.
6. Frühe Kontakte mit dem Christentum: Dieses Kapitel untersucht die ersten Kontakte der Wikinger mit dem Christentum. Es erörtert mögliche Ursachen der wikingischen Expansion und die Rolle frühmittelalterlicher Handelszentren wie Haithabu. Die ersten Raubzüge und die Ausbreitung wikingischer Einflüsse werden in Beziehung zu den religiösen Entwicklungen gesetzt.
7. Der Einzug des Christentums im Norden: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Christianisierung Skandinaviens durch verschiedene Missionstätigkeiten. Es beleuchtet die Rolle von Missionaren wie Ansgar und die Integration der Wikinger in England. Die Entstehung der Normannen aus Wikingern im Kontext religiöser Veränderungen wird diskutiert.
8. Christianisierung Skandinaviens: Dieses Kapitel analysiert die Christianisierung der skandinavischen Kernländer (Dänemark, Norwegen, Schweden), einschließlich der Bekehrung Islands. Der Fokus liegt auf den Christianisierungsvorhaben der Herrscher und deren Erfolg oder Misserfolg. Politische Aspekte werden im Kontext der religiösen Veränderungen behandelt.
Schlüsselwörter
Wikinger, Heidentum, Christentum, Christianisierung Skandinaviens, nordische Mythologie, Edda, Runen, Archäologie, Götter, Gottheiten, Jenseitsvorstellungen, Quellenkritik, Religionsgeschichte, Gesellschaftsordnung, Sippe, Expansion, Missionierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wikinger und ihr Glaube
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Glauben der Wikinger und deren Kontakt mit dem Christentum zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert. Sie untersucht die vorhandenen Quellen (archäologische Funde, Runen, altnordische Überlieferungen), um die wikingischen Glaubensvorstellungen zu rekonstruieren und den Prozess der Christianisierung Skandinaviens zu beschreiben.
Welche Quellen werden verwendet und welche Probleme ergeben sich daraus?
Die Arbeit analysiert verschiedene Quellen, darunter archäologische Funde (z.B. Kultplätze), Runeninschriften und altnordische Überlieferungen wie die Edda des Snorri Sturluson und Skaldendichtung. Ein zentrales Thema ist die Quellenkritik, da der Mangel an schriftlichen Quellen die Rekonstruktion des wikingischen Glaubens erschwert. Der indirekte Beweiswert archäologischer Funde wird hervorgehoben.
Wie wird die vorchristliche Religion der Wikinger dargestellt?
Die Arbeit beschreibt das vorchristliche Weltbild der Wikinger, inklusive der Kosmogonie (Entstehung der Welt), des Ragnaröks (Weltuntergang), und des Schicksalsglaubens. Wichtige Götter (Odin, Thor, Balder, Loki, Freyr und Freyja) und mythische Wesen (Riesen, Alben, Zwerge, Disen, Walküren) werden vorgestellt und ihre Rollen im religiösen System erläutert. Der polytheistische Charakter des Glaubens wird betont.
Wie werden die Jenseitsvorstellungen der Wikinger behandelt?
Das Kapitel zum Leben nach dem Tod analysiert Grabformen, Grabbeigaben (Waffen, Pferde, Schiffe), Bestattungsriten und die verschiedenen Totenreiche (Walhalla, Hel, Ran) im wikingischen Heidentum. Die Bedeutung der Grabbeigaben wird im Kontext der Jenseitsvorstellungen erläutert.
Wie werden die ersten Kontakte der Wikinger mit dem Christentum beschrieben?
Die Arbeit untersucht die frühen Kontakte der Wikinger mit dem Christentum, erörtert mögliche Ursachen der wikingischen Expansion und die Rolle frühmittelalterlicher Handelszentren wie Haithabu. Die ersten Raubzüge und die Ausbreitung wikingischer Einflüsse werden im Kontext der religiösen Entwicklungen betrachtet.
Wie wird der Prozess der Christianisierung Skandinaviens dargestellt?
Der Prozess der Christianisierung Skandinaviens wird anhand verschiedener Missionstätigkeiten (z.B. Ansgar) und der Integration der Wikinger in England beschrieben. Die Entstehung der Normannen aus Wikingern im Kontext religiöser Veränderungen wird diskutiert. Die Christianisierung Dänemarks, Norwegens (inkl. Island) und Schwedens wird separat analysiert, wobei auch politische Aspekte berücksichtigt werden.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden im Zusammenhang mit dem Glauben behandelt?
Die Arbeit untersucht die enge Verflechtung von Religion und Gesellschaft bei den Wikingern. Aspekte wie die Bedeutung der Sippe, die soziale Ordnung und das menschliche Zusammenleben werden im Kontext des religiösen Systems analysiert. Die Interdependenz zwischen gesellschaftlichen Strukturen und religiösen Praktiken wird beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die vorhandenen Quellen auf ihre Aussagekraft bezüglich der wikingischen Glaubensvorstellungen zu prüfen und eine mögliche Religionsgeschichte zu rekonstruieren. Ein zentrales Thema ist die Frage nach dem Ausmaß der Verdrängung des Heidentums durch das Christentum und nach möglichen Überresten heidnischer Elemente im christlichen Glauben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Wikinger, Heidentum, Christentum, Christianisierung Skandinaviens, nordische Mythologie, Edda, Runen, Archäologie, Götter, Gottheiten, Jenseitsvorstellungen, Quellenkritik, Religionsgeschichte, Gesellschaftsordnung, Sippe, Expansion, Missionierung.
- Arbeit zitieren
- Mag. Katja Kuster (Autor:in), 2019, Die Wikinger und ihr Glaube, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1240004