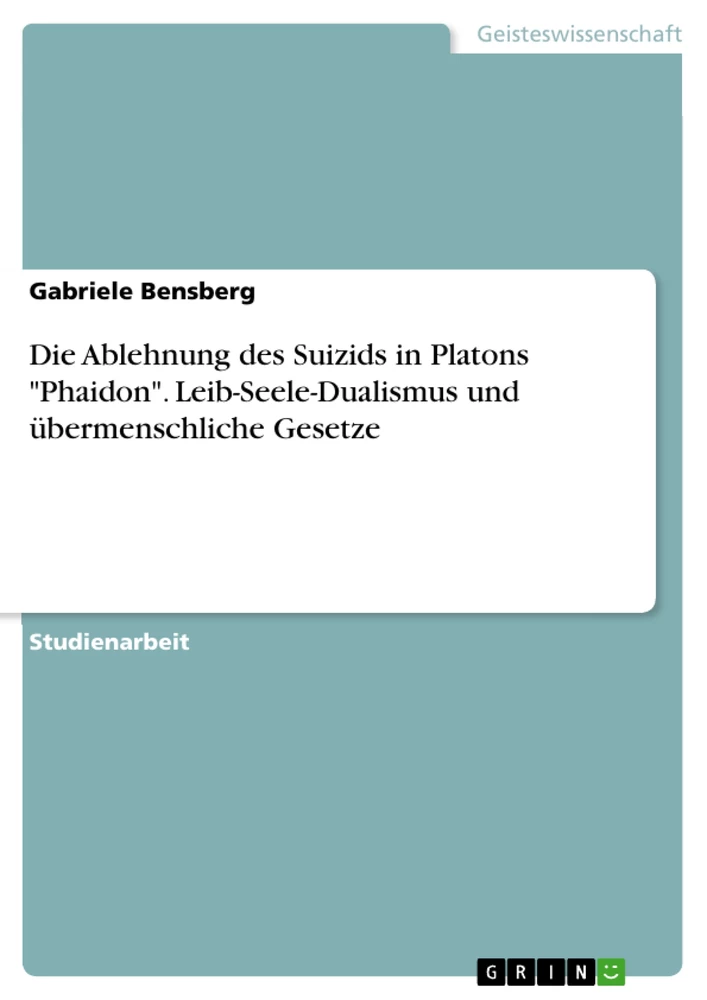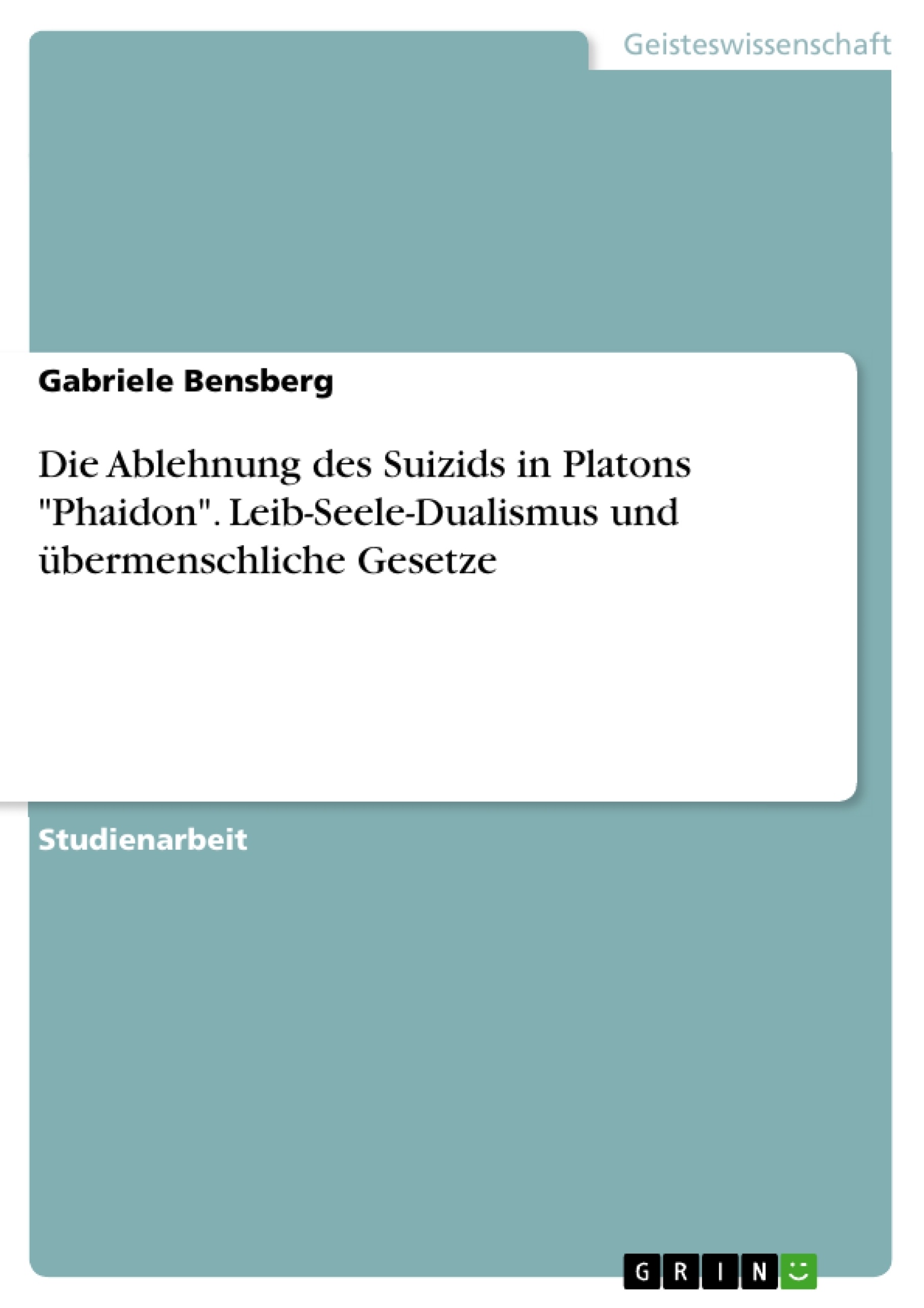Ausgehend von unterschiedlichen Haltungen gegenüber dem Suizid von der Antike bis zur Gegenwart, wird die Sichtweise des Sophokles in Platons "Phaidon" analysiert.
Sophokles lehnt den Suizid aus drei Gründen ab. Der Mensch befindet sich in einer "Feste", er ist von Geburt an eingeschränkt durch unterschiedliche Begabungen, Ressourcen etc. Wer darunter so leidet, dass er Suizid begeht, räumt dem verachtenswerten Leib Macht über die eigene Person ein und schneidet sich damit von philosophischen Erkenntnismöglichkeiten und einem philosophischen Dasein ab. Ein zweiter Grund besteht darin, dass der Mensch den Göttern untergeordnet ist und diese allein über Leben und Tod zu bestimmen haben. Ein dritter Grund ist in der Anerkennung des weltlichen Gesetzes zu sehen, das Sophokles zum Tod verurteilt hat und dem der Einzelne Respekt schuldet. Andererseits fürchtet Sophokles als Philosoph den Tod nicht, denn Platon vertritt die Auffassung, dass Philosophen, die irdische Freuden gering schätzen, ohnehin für die Welt "tot" sind. Der Tod wird sogar ersehnt aufgrund des Glaubens, nach dem Tod werde jeder so wiedergeboren, wie er gelebt habe, so dass Sophokles davon ausgehen kann, in das Göttliche, Ewige einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Disparität der Haltungen gegenüber dem Suizid
- Il Der Tod als wünschenswerter Zustand in Platons Phaidon
- II.1 Die Verachtung des Leibes
- II.2 Die Seele als Erkenntnisorgan
- II.3 Dualismus zwischen philosophischer und nichtphilosophischer...
- III Argumentative Verankerung der Ablehnung des Suizids
- III.1 Sieg des Leibes
- III.2 Rebellion gegen die Feste
- III.3 Hybris gegenüber ewigen Gesetzmäßigkeiten
- IV Fazit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Platons Argumentation gegen den Suizid im Dialog „Phaidon". Ziel ist es, die im Dialog vertretene Ablehnung des Selbstmordes im Spannungsfeld zwischen Leib-Seele-Dualismus und der Unterordnung unter übermenschliche Gesetze zu analysieren.
- Platons Leib-Seele-Dualismus und seine Bedeutung für die philosophische Erkenntnis
- Die Rolle des Todes in der philosophischen Lebensführung
- Die Argumentation gegen den Suizid im Kontext ethischer und metaphysischer Prinzipien
- Die Subordination des menschlichen Willens unter göttliche oder natürliche Gesetze
- Der Einfluss der antiken Philosophie auf die heutige Debatte um Sterbehilfe und Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Suizid in einen historischen Kontext und zeigt die verschiedenen Haltungen gegenüber dem Selbstmord auf, von der Verdammung bis zur Rechtfertigung. Das erste Kapitel analysiert die unterschiedlichen Positionen im Laufe der Geschichte, mit besonderem Fokus auf den christlichen Kontext und den Standpunkt des Thomas von Aquin. Auch Vertreter einer toleranten oder sogar befürwortenden Haltung gegenüber dem Suizid wie David Hume und Jean Améry werden beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich Platons Argumentation im „Phaidon". Hier wird die von Sokrates vertretene Todessehnsucht als ein Streben nach philosophischer Erkenntnis und einer Loslösung des Leibes betrachtet. Der Leib wird als Hindernis für die Erkenntnis und als Quelle von Last und Leid dargestellt. Die philosophische Lebensführung wird als eine Form des Asketismus und der Konzentration auf das Wesentliche vorgestellt.
Schlüsselwörter
Suizid, Platon, Phaidon, Leib-Seele-Dualismus, Philosophie, Erkenntnis, Tod, Asketismus, ethische Prinzipien, göttliche Gesetze, natürliche Gesetze, Selbstbestimmung, Sterbehilfe.
Häufig gestellte Fragen
Warum lehnt Sokrates in Platons „Phaidon“ den Suizid ab?
Sokrates nennt drei Gründe: Der Mensch befindet sich in einer „Feste“ (Bindung), er ist Eigentum der Götter und er schuldet den weltlichen Gesetzen Respekt.
Was bedeutet der Leib-Seele-Dualismus für die Erkenntnis?
Der Leib wird als Hindernis für die wahre Erkenntnis gesehen. Die Seele muss sich vom Körper lösen, um zur reinen philosophischen Einsicht zu gelangen.
Warum fürchtet ein Philosoph den Tod laut Platon nicht?
Da Philosophen bereits im Leben irdische Freuden gering schätzen, sind sie für die Welt quasi schon „tot“. Der Tod ist für sie die endgültige Befreiung der Seele.
Was versteht Platon unter der „Feste“ des Menschen?
Die „Feste“ beschreibt die gottgegebene Gebundenheit des Menschen an sein Leben und seinen Körper, aus der er sich nicht eigenmächtig durch Suizid befreien darf.
Wie beeinflusst die antike Philosophie die heutige Debatte um Sterbehilfe?
Die Hausarbeit schlägt eine Brücke von Platons metaphysischen Prinzipien zur modernen Diskussion über Selbstbestimmung und ethische Grenzen am Lebensende.
- Citar trabajo
- Gabriele Bensberg (Autor), 2019, Die Ablehnung des Suizids in Platons "Phaidon". Leib-Seele-Dualismus und übermenschliche Gesetze, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1234821