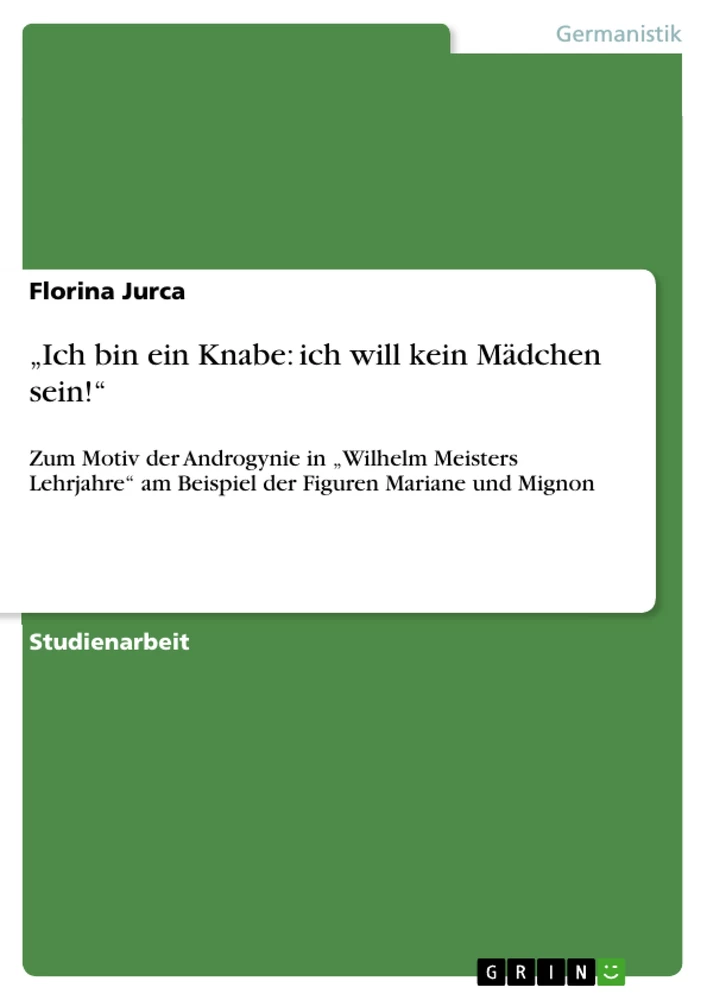Die vorliegende Arbeit knüpft an diesen Punkt an und versucht Merkmale der Androgynität an den Figuren Mariane und Mignon herauszufinden. Den Schwerpunkt dieser Analyse habe ich auf die männliche Kleidung der Frauenfiguren gelegt. Im 18. Jahrhundert waren besonders Uniformen nur den Männern vorbehalten. Anhand dieser Tatsache zeigt sich deutlich, dass die beiden Figuren sich selbst, aus unterschiedlichen Intentionen in eine männliche Rolle drängen. Ziel dieser Arbeit ist Antworten auf Ursache, Erscheinungsform und Bedeutung der androgynen Rolle zu finden. Zudem soll dargestellt werden, in wie weit die Androgynie ein wesentliches Charaktermerkmal der Figuren ist.
Der Grund, warum ich mich für diese Figuren entschieden habe liegt darin, dass sich viele Parallelen zwischen Mariane und Mignon aufzeigen. Dem Leser sticht bereits beim ersten Rezipieren die Verkleidungsmanie der beiden Figuren ins Auge. Hinzu kommt, dass beide zu der Randgruppe der wandernden Theaterspielerinnen gehören. Wichtig ist es auch, dass Mignon Wilhelm unablässig an Mariane erinnert. Schließlich verweist Martina Schwanke darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen den Namen Mignon und Mariane gibt. Als Engel verkleidet und aufgrund ihrer italienischen Herkunft, weist Mignon Ähnlichkeit mit Marienfiguren auf. Mignon als kleine Maria deute direkt auf den Namen Maria-ne hin, so Schwanke.
Die Gliederung dieser Arbeit richtet sich nach dem chronologischen Auftreten der beiden Figuren in dem Werk. Demnach beginne ich mit der Analyse der androgynen Merkmale am Beispiel von Mariane. Abschließend untersuche ich Mignons androgyne Züge.
Bei Mignon soll nicht nur ihre knabenhafte Uniform, sondern auch der Name untersucht werden. In V.1) soll herausgefunden werden, was der Name über die Figur und deren Androgynität verrät. Da der Taufname im Roman nicht erwähnt wird, muss ich mich bei der Ausarbeitung auf Mignon beschränken. Dieser Name wurde der Figur von der Seiltänzergruppe gegeben.
Anzumerken ist noch, dass die Figur Mignon aus stilistischen Gründen mit dem femininen grammatischen Geschlecht belegt ist. Im Vorfeld, bevor die Figuren auf ihre Androgynität untersucht werden, wird der Begriff Androgynie genau definiert. Dadurch sollen Kriterien und Vergleichsmöglichkeiten für die Analyse der Androgynität der Figuren aufgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsklärung: Was bedeutet Androgynie?
- III. Psychologische Androgynität nach Jacques Lacan
- 1) Die imaginäre Phase
- 2) Die Phase der symbolischen Ordnung
- IV. Das Motiv der Androgynie am Beispiel von Mariane
- 1) Marianes Offizierskleidung
- 2) Mariane das androgyne Wesen?
- 3) Mariane als Repräsentantin der imaginären Phase?
- V. Das Motiv der Androgynie am Beispiel von Mignon
- 1) „Sie heißen mich Mignon“(98)
- 2) Mignons Knabenhafte Uniform
- 3) Mignon das androgyne Wesen?
- 4) Mignon als Repräsentantin der imaginären Phase?
- VI. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Motiv der Androgynität in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, fokussiert auf die Figuren Mariane und Mignon. Die Analyse konzentriert sich auf die männliche Kleidung der Frauenfiguren als Ausdruck androgyner Tendenzen und deren Bedeutung im Kontext des 18. Jahrhunderts. Ziel ist es, Ursachen, Erscheinungsformen und die Bedeutung der androgynen Rollen zu beleuchten und deren Stellenwert als Charaktermerkmal zu erörtern.
- Androgynie als literarisches Motiv in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“
- Analyse der männlichen Kleidung der Figuren Mariane und Mignon
- Bedeutung der Kleidung als Ausdruck androgyner Identität
- Vergleich der androgynen Merkmale von Mariane und Mignon
- Zusammenhang zwischen Androgynie und der imaginären Phase nach Lacan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Androgynität von Mariane und Mignon in Goethes Werk. Der zweite Abschnitt definiert den Begriff Androgynie, unterscheidet zwischen physischer und psychologischer Androgynität und verweist auf den Androgynen-Mythos Platons. Kapitel IV analysiert Marianes androgyne Merkmale, insbesondere ihre Offizierskleidung. Kapitel V widmet sich Mignon, untersucht ihre knabenhafte Uniform und den Namen „Mignon“ im Hinblick auf dessen Bedeutung für die Figur.
Schlüsselwörter
Androgynie, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Goethe, Mariane, Mignon, männliche Kleidung, imaginäre Phase, Lacan, Geschlechterrollen, psychologische Androgynität.
- Citation du texte
- Florina Jurca (Auteur), 2008, „Ich bin ein Knabe: ich will kein Mädchen sein!“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123437