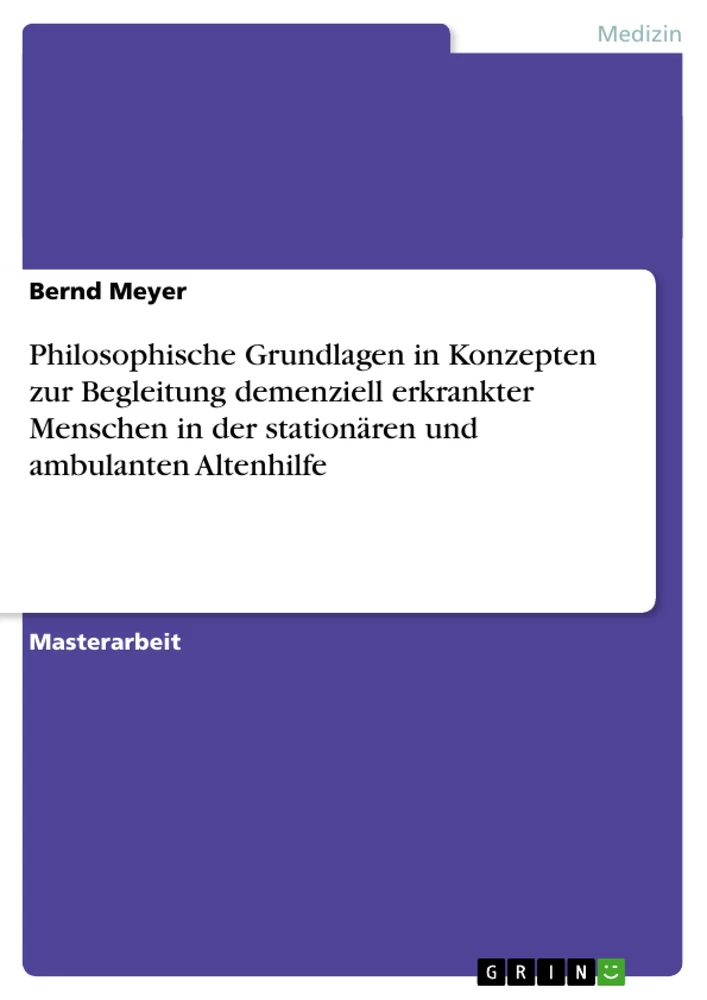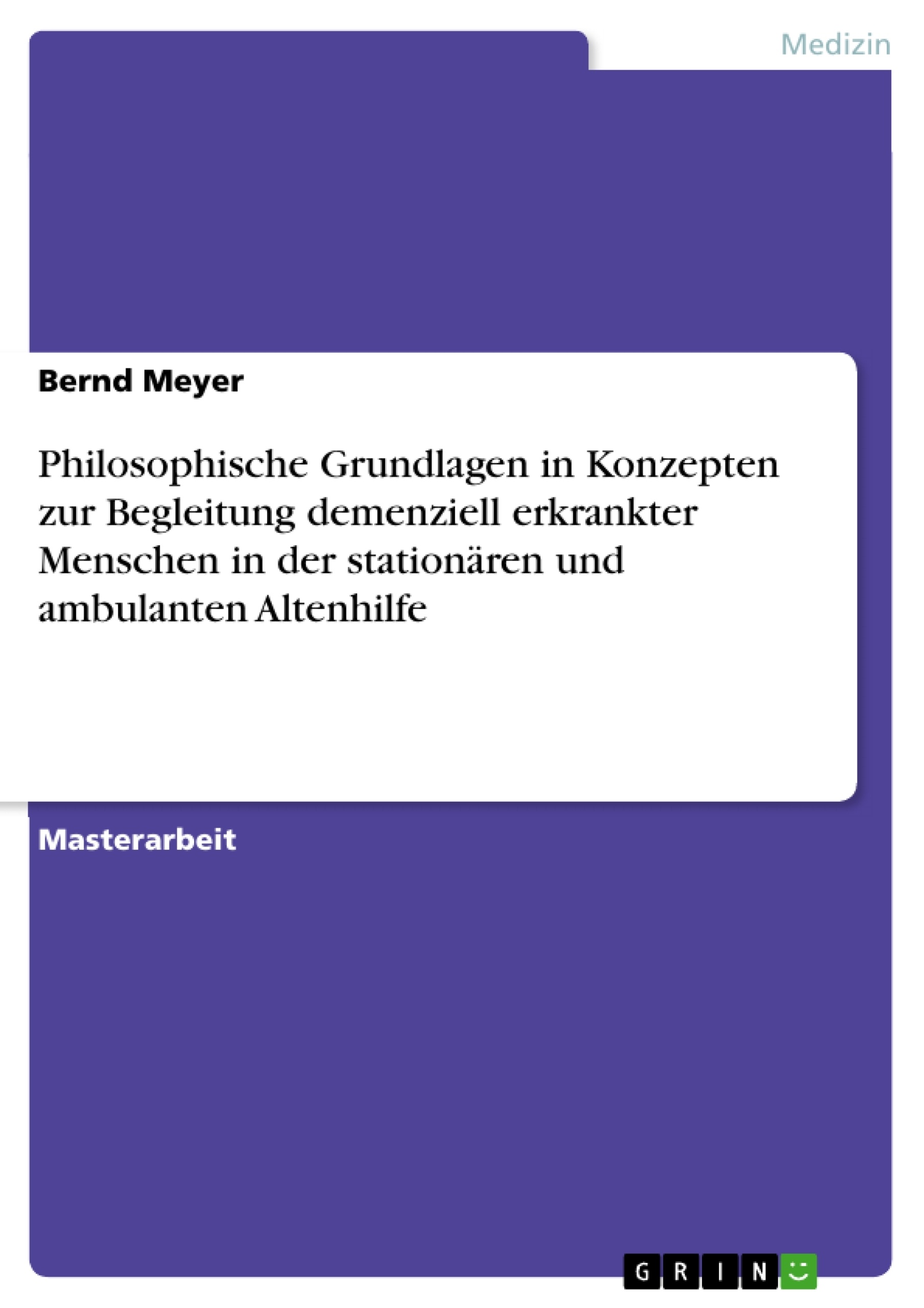Die Begleitung von Menschen mit Demenz wird zu einer der größten Herausforderungen für die Sozial- und Gesundheitssysteme der Zukunft, nicht nur in Deutschland. Während hierzulande die öffentliche Diskussion über viele Jahre nahezu ausschließlich von der Medizin geprägt wurde (vgl. Wetzstein, 2005: 12) und zu einem naturwissenschaftlichen Demenzkonzept führte (vgl. Wetzstein: 15), sind die Grenzen dieser Betrachtung nicht zu übersehen. Alternative Ansätze, die ein anderes Menschenbild und daraus folgernd ein erweitertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit beinhalten, sind gefordert. Eine besondere Bedeutung bei dem sich abzeichnenden Paradigmenwechsel kommt dabei, auf unterschiedlichen Ebenen, der Profession Pflege zu. Grundvoraussetzungen (vgl. Remmers, 2004/1: 4) sind Sachkompetenz, im Sinne einer Beherrschung wissenschaftlich fundierten Wissens sowie soziale und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen. Eine wachsende Aufmerksamkeit (vgl. ebd.) bekommt die Fähigkeit der ethischen Urteilsbildung, wenn es darum geht, nicht nur sachbezogene, sondern auch sinnbezogene Entscheidungen zu treffen. Die Frage nach dem „guten und richtigen“ Handeln im beruflichen Alltag (vgl. Höffe, 1997, S. 66), in ganz konkreten zwischenmenschlichen Situationen beinhaltet immer auch eine moralische Dimension (vgl. Fahr, 2006: 31). Dieser muss bei der Beurteilung und Entwicklung von Konzepten zur Begleitung von Menschen mit Demenz zentrales Interesses zukommen.
In dieser Arbeit werden, ausgehend von der Praxis, ethischen Anforderungen an die Begleitung von Menschen mit Demenz formuliert. Darauf aufbauend wird ein Untersuchungsinstrument zur Evaluation von diesbezüglichen Konzepten entwickelt. Exemplarisch werden die beiden Ansätze, die in Deutschland die größte Verbreitung finden, die Validation nach Feil und das Psychobiographische Pflegemodell nach Böhm, untersucht und bewertet. Entgegen den, durch die Akzeptanz in der Praxis geweckten Erwartungen, wird im Ergebnis deutlich, dass beide Konzepte sowohl aus wissenschaftlicher, als auch aus moralphilosophischer Sicht sehr fragwürdig sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Ausgangslage
- Menschenbilder in der Begleitung von Menschen mit Demenz
- Das naturwissenschaftlich – medizinische Menschenbild in der Begleitung von Menschen mit Demenz
- Pflegepraxis
- Praxisbeispiele
- Diskussion der Praxisbeispiele
- Fazit
- Grundlagen einer ethischen Reflexion für die Begleitung von Menschen mit Demenz
- Zum Stand der ethischen Diskussion in der Begleitung von Menschen mit Demenz
- Fürsorge als Leitgedanke für die Begleitung von Menschen mit Demenz
- Fürsorgebegründete Anforderungen an die praktische Begleitung von Menschen mit Demenz
- Autonomie als Leitgedanke für die Begleitung von Menschen mit Demenz
- Autonomiebegründete Anforderungen an die praktische Begleitung von Menschen mit Demenz
- Verantwortung als Leitgedanke für die Begleitung von Menschen mit Demenz
- Verantwortlichkeitsbegründete Anforderungen an die praktische Begleitung von Menschen mit Demenz
- Zusammenfassung
- Grundlagen der Konzeptualisierung
- Konzeptauswahl und Begründung
- Validation nach Feil
- Ursprung und theoretischer Hintergrund
- Zentrale Aussagen
- Zusammenfassung der zentralen Aussagen
- Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit
- Quellenkritik
- Inhaltliche Kritik
- Philosophische Ausrichtung und ethische Positionen
- Anforderungsprofil
- Zusammenfassung
- Das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm
- Ursprung und theoretischer Hintergrund
- Zentrale Aussagen
- Zusammenfassung der zentralen Aussagen
- Kritik
- Menschenbild und das Verständnis von Gesundheit und Krankheit
- Philosophische Ausrichtung und ethische Positionen
- Anforderungsprofil
- Zusammenfassung
- Diskussion und Vergleich
- Theoretische Haltbarkeit
- Praktische Brauchbarkeit
- Zusammenfassung
- Ausblick
- Persönliche Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht philosophische Grundlagen in Konzepten zur Begleitung demenziell erkrankter Menschen in der stationären und ambulanten Altenhilfe. Ziel ist es, verschiedene Konzepte zu evaluieren und deren ethische und philosophische Implikationen zu beleuchten.
- Philosophische Grundlagen der Demenzbetreuung
- Ethische Aspekte der Fürsorge, Autonomie und Verantwortung im Umgang mit Demenz
- Konzeptuelle Ansätze zur Begleitung von Menschen mit Demenz
- Evaluation von Pflegemodellen im Hinblick auf ihre philosophischen und ethischen Implikationen
- Vergleich verschiedener Pflegemodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Demenzbetreuung ein und erläutert die Bedeutung philosophischer und ethischer Reflexionen in diesem Kontext. Sie skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
Ausgangslage: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Situation der Demenzversorgung und die Herausforderungen, vor denen die Altenpflege steht. Es beleuchtet die demografische Entwicklung und die steigende Zahl von Menschen mit Demenz. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit neuer und innovativer Ansätze in der Betreuung.
Menschenbilder in der Begleitung von Menschen mit Demenz: Dieses Kapitel analysiert unterschiedliche Menschenbilder, die die Betreuung von Demenzkranken beeinflussen. Es werden verschiedene Perspektiven beleuchtet und deren Auswirkungen auf die Pflegepraxis diskutiert. Der Einfluss von medizinischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven wird kritisch hinterfragt.
Das naturwissenschaftlich – medizinische Menschenbild in der Begleitung von Menschen mit Demenz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das naturwissenschaftlich-medizinische Menschenbild und dessen Anwendung in der Demenzpflege. Es analysiert die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes und diskutiert, wie er die praktische Betreuung beeinflusst. Die Grenzen des rein medizinischen Ansatzes werden herausgestellt.
Pflegepraxis: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung der Demenzbetreuung anhand von Praxisbeispielen. Es werden konkrete Situationen dargestellt und deren Herausforderungen analysiert. Die Diskussion der Beispiele dient der Veranschaulichung der theoretischen Konzepte.
Grundlagen einer ethischen Reflexion für die Begleitung von Menschen mit Demenz: Dieses Kapitel untersucht die ethischen Grundlagen der Demenzbetreuung. Es analysiert die zentralen ethischen Prinzipien wie Fürsorge, Autonomie und Verantwortung im Kontext der Demenzpflege. Es werden konkrete Handlungsanweisungen und ethische Dilemmata diskutiert.
Grundlagen der Konzeptevaluation: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Konzeptualisierung und Evaluation von Modellen der Demenzbetreuung. Es beleuchtet die Kriterien für eine fundierte Bewertung von Pflegekonzepten.
Konzeptauswahl und Begründung: Hier wird die Auswahl der in der Arbeit analysierten Konzepte (Validation nach Feil und das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm) begründet und deren Relevanz für die Forschungsfrage dargelegt. Die Kriterien der Auswahl werden transparent gemacht.
Validation nach Feil: Dieses Kapitel analysiert das Validation-Modell nach Feil umfassend. Es untersucht den Ursprung, die zentralen Aussagen, das Menschenbild, die philosophische Ausrichtung und die ethischen Positionen des Modells. Die Stärken und Schwächen des Ansatzes werden kritisch diskutiert.
Das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des psychobiographischen Pflegemodells nach Böhm. Ähnlich wie bei der Validation wird der Ursprung, die zentralen Aussagen, das Menschenbild, die philosophische Ausrichtung und die ethischen Positionen analysiert und kritisch bewertet.
Diskussion und Vergleich: In diesem Kapitel werden die beiden analysierten Konzepte (Validation und psychobiographisches Modell) verglichen und gegeneinander abgewogen. Es werden deren theoretische und praktische Brauchbarkeit im Hinblick auf die Begleitung demenziell erkrankter Menschen diskutiert. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze werden im Kontext zueinander gesetzt.
Schlüsselwörter
Demenz, Altenpflege, Menschenbild, Ethik, Fürsorge, Autonomie, Verantwortung, Validation, psychobiographisches Pflegemodell, Konzeptevaluation, Pflegepraxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Philosophische Grundlagen in Konzepten zur Begleitung demenziell erkrankter Menschen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht philosophische Grundlagen in Konzepten zur Begleitung demenziell erkrankter Menschen in der stationären und ambulanten Altenhilfe. Ziel ist die Evaluierung verschiedener Konzepte und die Beleuchtung ihrer ethischen und philosophischen Implikationen.
Welche Konzepte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert insbesondere das Validation-Modell nach Feil und das psychobiographische Pflegemodell nach Böhm. Die Auswahl dieser Konzepte wird im Text begründet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit philosophischen Grundlagen der Demenzbetreuung, ethischen Aspekten (Fürsorge, Autonomie, Verantwortung), konzeptuellen Ansätzen zur Begleitung von Menschen mit Demenz, der Evaluation von Pflegemodellen hinsichtlich ihrer philosophischen und ethischen Implikationen und einem Vergleich verschiedener Pflegemodelle.
Welche ethischen Prinzipien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die zentralen ethischen Prinzipien Fürsorge, Autonomie und Verantwortung im Kontext der Demenzpflege und diskutiert daraus resultierende Handlungsanweisungen und ethische Dilemmata.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Ausgangslage, Menschenbildern in der Demenzbegleitung (inkl. naturwissenschaftlich-medizinischem Menschenbild), Pflegepraxis, ethischen Reflexionen, Grundlagen der Konzeptualisierung, Konzeptauswahl, detaillierten Analysen der Validation und des psychobiographischen Modells, einem Vergleich der Konzepte, Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Aspekte der Validation nach Feil werden analysiert?
Die Analyse der Validation umfasst Ursprung, zentrale Aussagen, Menschenbild, Verständnis von Gesundheit und Krankheit, philosophische Ausrichtung, ethische Positionen und Anforderungsprofil. Quellen- und inhaltliche Kritik werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Aspekte des psychobiographischen Pflegemodells nach Böhm werden analysiert?
Ähnlich wie bei der Validation werden Ursprung, zentrale Aussagen, Menschenbild, Verständnis von Gesundheit und Krankheit, philosophische Ausrichtung, ethische Positionen und Anforderungsprofil des psychobiographischen Modells analysiert und kritisch bewertet.
Wie werden die beiden Konzepte verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Validation und das psychobiographische Modell hinsichtlich ihrer theoretischen Haltbarkeit und praktischen Brauchbarkeit in der Begleitung demenziell erkrankter Menschen. Stärken und Schwächen beider Ansätze werden im Kontext zueinander gesetzt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Demenz, Altenpflege, Menschenbild, Ethik, Fürsorge, Autonomie, Verantwortung, Validation, psychobiographisches Pflegemodell, Konzeptevaluation und Pflegepraxis.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte in der Altenpflege, Studierende der Pflegewissenschaften und alle, die sich mit der ethischen und philosophischen Dimension der Demenzbetreuung auseinandersetzen.
- Quote paper
- Dipl. Pflegewirt, M.A. Bernd Meyer (Author), 2008, Philosophische Grundlagen in Konzepten zur Begleitung demenziell erkrankter Menschen in der stationären und ambulanten Altenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123313